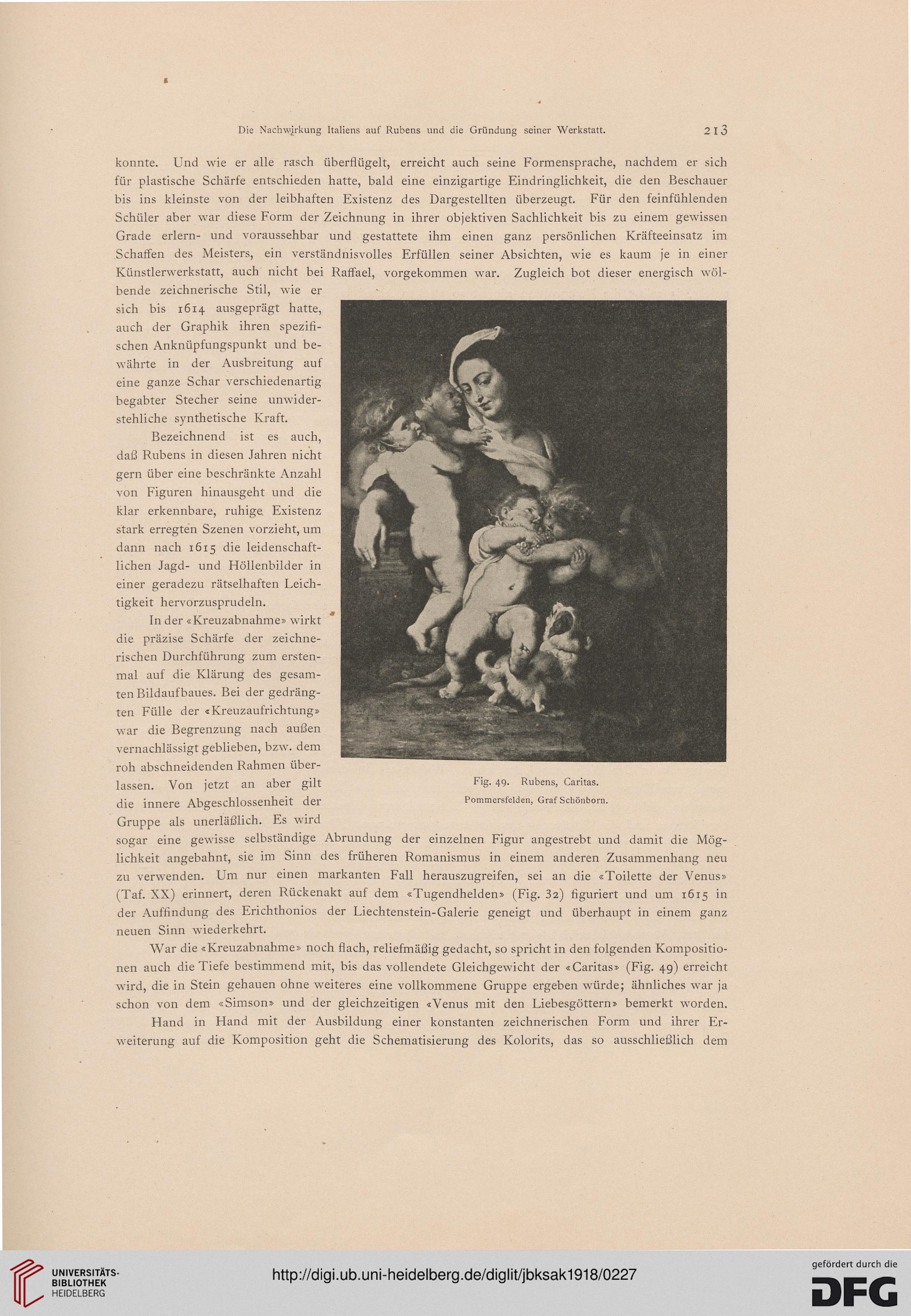Die Nachwirkung Italiens auf Rubens und die Gründung seiner Werkstatt.
213
konnte. Und wie er alle rasch überflügelt, erreicht auch seine Formensprache, nachdem er sich
für plastische Schärfe entschieden hatte, bald eine einzigartige Eindringlichkeit, die den Beschauer
bis ins kleinste von der leibhaften Existenz des Dargestellten überzeugt. Für den feinfühlenden
Schüler aber war diese Form der Zeichnung in ihrer objektiven Sachlichkeit bis zu einem gewissen
Grade erlern- und voraussehbar und gestattete ihm einen ganz persönlichen Kräfteeinsatz im
Schaffen des Meisters, ein verständnisvolles Erfüllen seiner Absichten, wie es kaum je in einer
Künstlerwerkstatt, auch nicht bei Raffael, vorgekommen war. Zugleich bot dieser energisch wöl-
bende zeichnerische Stil, wie er
sich bis 1614 ausgeprägt hatte,
auch der Graphik ihren spezifi-
schen Anknüpfungspunkt und be-
währte in der Ausbreitung auf
eine ganze Schar verschiedenartig
begabter Stecher seine unwider-
stehliche synthetische Kraft.
Bezeichnend ist es auch,
daß Rubens in diesen Jahren nicht
gern über eine beschränkte Anzahl
von Figuren hinausgeht und die
klar erkennbare, ruhige Existenz
stark erregten Szenen vorzieht, um
dann nach 1615 die leidenschaft-
lichen Jagd- und Höllenbilder in
einer geradezu rätselhaften Leich-
tigkeit hervorzusprudeln.
In der «Kreuzabnahme» wirkt
die präzise Schärfe der zeichne-
rischen Durchführung zum ersten-
mal auf die Klärung des gesam-
ten Bildaufbaues. Bei der gedräng-
ten Fülle der «Kreuzaufrichtung»
war die Begrenzung nach außen
vernachlässigt geblieben, bzw. dem
roh abschneidenden Rahmen über-
lassen. Von jetzt an aber gilt
die innere Abgeschlossenheit der
Gruppe als unerläßlich. Es wird
sogar eine gewisse selbständige Abrundung der einzelnen Figur angestrebt und damit die Mög-
lichkeit angebahnt, sie im Sinn des früheren Romanismus in einem anderen Zusammenhang neu
zu verwenden. Um nur einen markanten Fall herauszugreifen, sei an die «Toilette der Venus»
(Taf. XX) erinnert, deren Rückenakt auf dem «Tugendhelden» (Fig. 32) figuriert und um 1615 in
der Auffindung des Erichthonios der Liechtenstein-Galerie geneigt und überhaupt in einem ganz
neuen Sinn wiederkehrt.
War die «Kreuzabnahme» noch flach, reliefmäßig gedacht, so spricht in den folgenden Kompositio-
nen auch die Tiefe bestimmend mit, bis das vollendete Gleichgewicht der «Caritas» (Fig. 49) erreicht
wird, die in Stein gehauen ohne weiteres eine vollkommene Gruppe ergeben würde; ähnliches war ja
schon von dem «Simson» und der gleichzeitigen «Venus mit den Liebesgöttern» bemerkt worden.
Hand in Hand mit der Ausbildung einer konstanten zeichnerischen Form und ihrer Er-
weiterung auf die Komposition geht die Schematisierung des Kolorits, das so ausschließlich dem
Fig. 49. Rubens, Caritas.
Pommersfelden, Graf Schönborn.
213
konnte. Und wie er alle rasch überflügelt, erreicht auch seine Formensprache, nachdem er sich
für plastische Schärfe entschieden hatte, bald eine einzigartige Eindringlichkeit, die den Beschauer
bis ins kleinste von der leibhaften Existenz des Dargestellten überzeugt. Für den feinfühlenden
Schüler aber war diese Form der Zeichnung in ihrer objektiven Sachlichkeit bis zu einem gewissen
Grade erlern- und voraussehbar und gestattete ihm einen ganz persönlichen Kräfteeinsatz im
Schaffen des Meisters, ein verständnisvolles Erfüllen seiner Absichten, wie es kaum je in einer
Künstlerwerkstatt, auch nicht bei Raffael, vorgekommen war. Zugleich bot dieser energisch wöl-
bende zeichnerische Stil, wie er
sich bis 1614 ausgeprägt hatte,
auch der Graphik ihren spezifi-
schen Anknüpfungspunkt und be-
währte in der Ausbreitung auf
eine ganze Schar verschiedenartig
begabter Stecher seine unwider-
stehliche synthetische Kraft.
Bezeichnend ist es auch,
daß Rubens in diesen Jahren nicht
gern über eine beschränkte Anzahl
von Figuren hinausgeht und die
klar erkennbare, ruhige Existenz
stark erregten Szenen vorzieht, um
dann nach 1615 die leidenschaft-
lichen Jagd- und Höllenbilder in
einer geradezu rätselhaften Leich-
tigkeit hervorzusprudeln.
In der «Kreuzabnahme» wirkt
die präzise Schärfe der zeichne-
rischen Durchführung zum ersten-
mal auf die Klärung des gesam-
ten Bildaufbaues. Bei der gedräng-
ten Fülle der «Kreuzaufrichtung»
war die Begrenzung nach außen
vernachlässigt geblieben, bzw. dem
roh abschneidenden Rahmen über-
lassen. Von jetzt an aber gilt
die innere Abgeschlossenheit der
Gruppe als unerläßlich. Es wird
sogar eine gewisse selbständige Abrundung der einzelnen Figur angestrebt und damit die Mög-
lichkeit angebahnt, sie im Sinn des früheren Romanismus in einem anderen Zusammenhang neu
zu verwenden. Um nur einen markanten Fall herauszugreifen, sei an die «Toilette der Venus»
(Taf. XX) erinnert, deren Rückenakt auf dem «Tugendhelden» (Fig. 32) figuriert und um 1615 in
der Auffindung des Erichthonios der Liechtenstein-Galerie geneigt und überhaupt in einem ganz
neuen Sinn wiederkehrt.
War die «Kreuzabnahme» noch flach, reliefmäßig gedacht, so spricht in den folgenden Kompositio-
nen auch die Tiefe bestimmend mit, bis das vollendete Gleichgewicht der «Caritas» (Fig. 49) erreicht
wird, die in Stein gehauen ohne weiteres eine vollkommene Gruppe ergeben würde; ähnliches war ja
schon von dem «Simson» und der gleichzeitigen «Venus mit den Liebesgöttern» bemerkt worden.
Hand in Hand mit der Ausbildung einer konstanten zeichnerischen Form und ihrer Er-
weiterung auf die Komposition geht die Schematisierung des Kolorits, das so ausschließlich dem
Fig. 49. Rubens, Caritas.
Pommersfelden, Graf Schönborn.