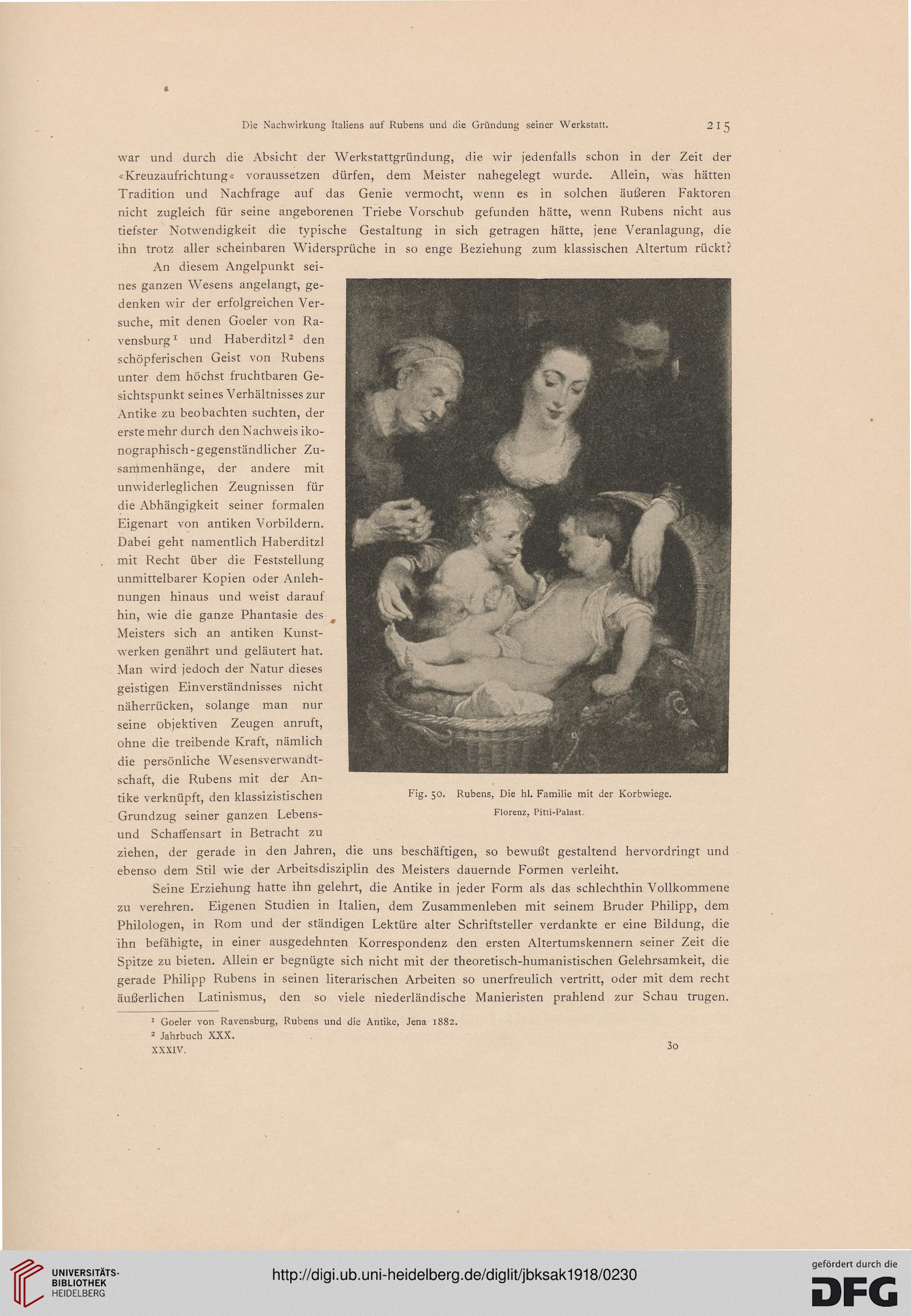Die Nachwirkung Italiens auf Rubens und die Gründung seiner Werkstatt.
215
war und durch die Absicht der Werkstattgründung, die wir jedenfalls schon in der Zeit der
«Kreuzauirichtung« voraussetzen dürfen, dem Meister nahegelegt wurde. Allein, was hätten
Tradition und Nachfrage auf das Genie vermocht, wenn es in solchen äußeren Faktoren
nicht zugleich für seine angeborenen Triebe Vorschub gefunden hätte, wenn Rubens nicht aus
tiefster Notwendigkeit die typische Gestaltung in sich getragen hätte, jene Veranlagung, die
ihn trotz aller scheinbaren Widersprüche in so enge Beziehung zum klassischen Altertum rückt?
An diesem Angelpunkt sei-
nes ganzen Wesens angelangt, ge-
denken wir der erfolgreichen Ver-
suche, mit denen Goeler von Ra-
vensburg1 und Haberditzl2 den
schöpferischen Geist von Rubens
unter dem höchst fruchtbaren Ge-
sichtspunkt seines Verhältnisses zur
Antike zu beobachten suchten, der
erste mehr durch den Nachweis iko-
nographisch-gegenständlicher Zu-
sammenhänge, der andere mit
unwiderleglichen Zeugnissen für
die Abhängigkeit seiner formalen
Eigenart von antiken Vorbildern.
Dabei geht namentlich Haberditzl
mit Recht über die Feststellung
unmittelbarer Kopien oder Anleh-
nungen hinaus und weist darauf
hin, wie die ganze Phantasie des
Meisters sich an antiken Kunst-
werken genährt und geläutert hat.
Man wird jedoch der Natur dieses
geistigen Einverständnisses nicht
näherrücken, solange man nur
seine objektiven Zeugen anruft,
ohne die treibende Kraft, nämlich
die persönliche Wesensverwandt-
schaft, die Rubens mit der An-
tike verknüpft, den klassizistischen
Grundzug seiner ganzen Lebens-
und Schaffensart in Betracht zu
ziehen, der gerade in den Jahren, die uns beschäftigen, so bewußt gestaltend hervordringt und
ebenso dem Stil wie der Arbeitsdisziplin des Meisters dauernde Formen verleiht.
Seine Erziehung hatte ihn gelehrt, die Antike in jeder Form als das schlechthin Vollkommene
zu verehren. Eigenen Studien in Italien, dem Zusammenleben mit seinem Bruder Philipp, dem
Philologen, in Rom und der ständigen Lektüre alter Schriftsteller verdankte er eine Bildung, die
ihn befähigte, in einer ausgedehnten Korrespondenz den ersten Altertumskennern seiner Zeit die
Spitze zu bieten. Allein er begnügte sich nicht mit der theoretisch-humanistischen Gelehrsamkeit, die
gerade Philipp Rubens in seinen literarischen Arbeiten so unerfreulich vertritt, oder mit dem recht
äußerlichen Latinismus, den so viele niederländische Manieristen prahlend zur Schau trugen.
Fig. 50. Rubens, Die hl. Familie mit der Korbwiege.
Florenz, Pitti-Palast.
1 Goeler von Ravensburg, Rubens und die Antike, Jena 1882.
2 Jahrbuch XXX.
XXXIV.
3o
215
war und durch die Absicht der Werkstattgründung, die wir jedenfalls schon in der Zeit der
«Kreuzauirichtung« voraussetzen dürfen, dem Meister nahegelegt wurde. Allein, was hätten
Tradition und Nachfrage auf das Genie vermocht, wenn es in solchen äußeren Faktoren
nicht zugleich für seine angeborenen Triebe Vorschub gefunden hätte, wenn Rubens nicht aus
tiefster Notwendigkeit die typische Gestaltung in sich getragen hätte, jene Veranlagung, die
ihn trotz aller scheinbaren Widersprüche in so enge Beziehung zum klassischen Altertum rückt?
An diesem Angelpunkt sei-
nes ganzen Wesens angelangt, ge-
denken wir der erfolgreichen Ver-
suche, mit denen Goeler von Ra-
vensburg1 und Haberditzl2 den
schöpferischen Geist von Rubens
unter dem höchst fruchtbaren Ge-
sichtspunkt seines Verhältnisses zur
Antike zu beobachten suchten, der
erste mehr durch den Nachweis iko-
nographisch-gegenständlicher Zu-
sammenhänge, der andere mit
unwiderleglichen Zeugnissen für
die Abhängigkeit seiner formalen
Eigenart von antiken Vorbildern.
Dabei geht namentlich Haberditzl
mit Recht über die Feststellung
unmittelbarer Kopien oder Anleh-
nungen hinaus und weist darauf
hin, wie die ganze Phantasie des
Meisters sich an antiken Kunst-
werken genährt und geläutert hat.
Man wird jedoch der Natur dieses
geistigen Einverständnisses nicht
näherrücken, solange man nur
seine objektiven Zeugen anruft,
ohne die treibende Kraft, nämlich
die persönliche Wesensverwandt-
schaft, die Rubens mit der An-
tike verknüpft, den klassizistischen
Grundzug seiner ganzen Lebens-
und Schaffensart in Betracht zu
ziehen, der gerade in den Jahren, die uns beschäftigen, so bewußt gestaltend hervordringt und
ebenso dem Stil wie der Arbeitsdisziplin des Meisters dauernde Formen verleiht.
Seine Erziehung hatte ihn gelehrt, die Antike in jeder Form als das schlechthin Vollkommene
zu verehren. Eigenen Studien in Italien, dem Zusammenleben mit seinem Bruder Philipp, dem
Philologen, in Rom und der ständigen Lektüre alter Schriftsteller verdankte er eine Bildung, die
ihn befähigte, in einer ausgedehnten Korrespondenz den ersten Altertumskennern seiner Zeit die
Spitze zu bieten. Allein er begnügte sich nicht mit der theoretisch-humanistischen Gelehrsamkeit, die
gerade Philipp Rubens in seinen literarischen Arbeiten so unerfreulich vertritt, oder mit dem recht
äußerlichen Latinismus, den so viele niederländische Manieristen prahlend zur Schau trugen.
Fig. 50. Rubens, Die hl. Familie mit der Korbwiege.
Florenz, Pitti-Palast.
1 Goeler von Ravensburg, Rubens und die Antike, Jena 1882.
2 Jahrbuch XXX.
XXXIV.
3o