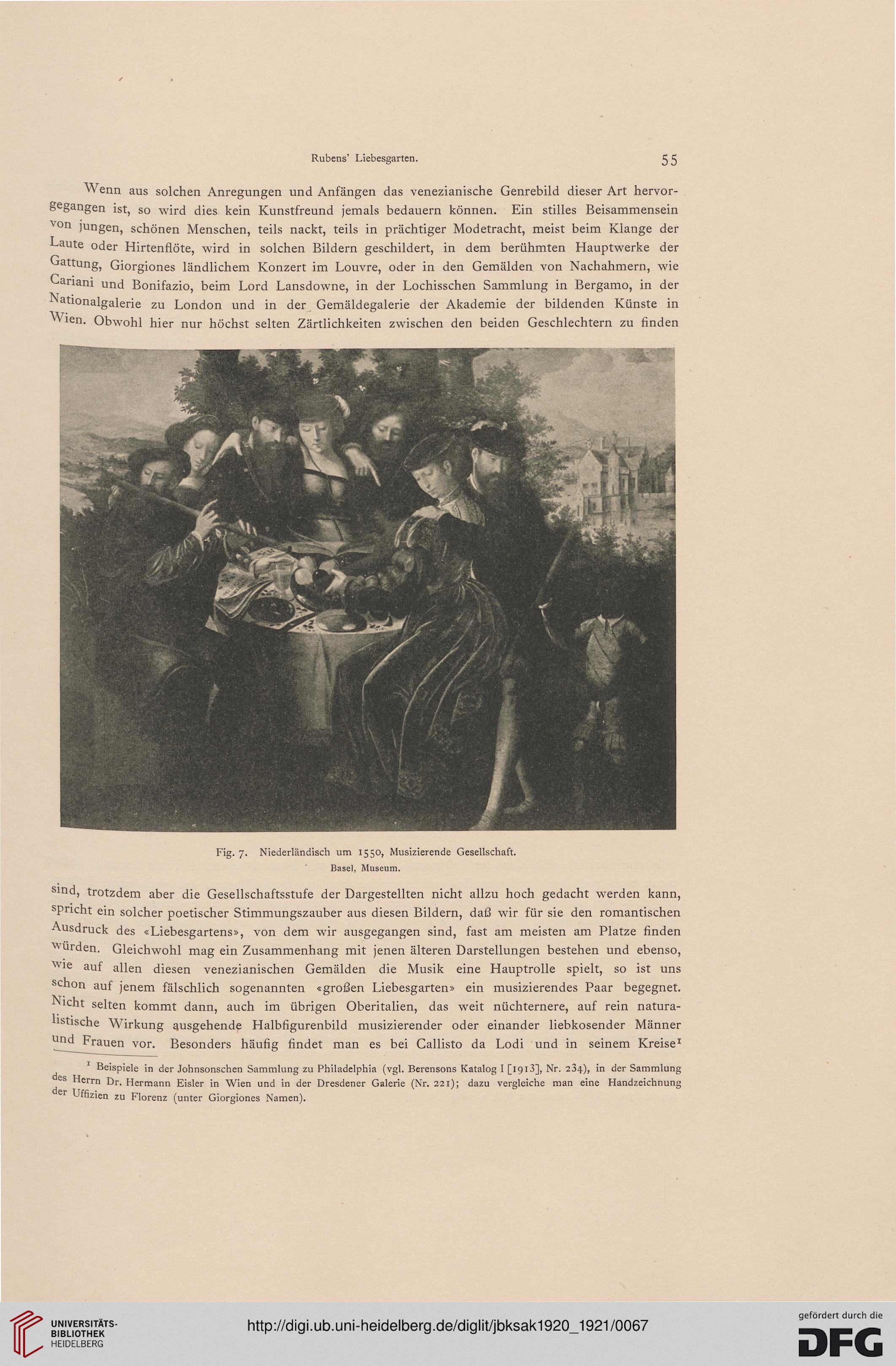Rubens' Liebesgarten.
55
Wenn aus solchen Anregungen und Anfängen das venezianische Genrebild dieser Art hervor-
gegangen ist, so wird dies kein Kunstfreund jemals bedauern können. Ein stilles Beisammensein
v°n jungen, schönen Menschen, teils nackt, teils in prächtiger Modetracht, meist beim Klange der
Laute oder Hirtenflöte, wird in solchen Bildern geschildert, in dem berühmten Hauptwerke der
Gattung, Giorgiones ländlichem Konzert im Louvre, oder in den Gemälden von Nachahmern, wie
Cariani und Bonifazio, beim Lord Lansdowne, in der Lochisschen Sammlung in Bergamo, in der
Nationalgalerie zu London und in der Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste in
Wien. Obwohl hier nur höchst selten Zärtlichkeiten zwischen den beiden Geschlechtern zu finden
Fig. 7. Niederländisch um 1550, Musizierende Gesellschaft.
Basel, Museum.
Slnd, trotzdem aber die Gesellschaftsstufe der Dargestellten nicht allzu hoch gedacht werden kann,
spricht ein solcher poetischer Stimmungszauber aus diesen Bildern, daß wir für sie den romantischen
Ausdruck des «Liebesgartens», von dem wir ausgegangen sind, fast am meisten am Platze finden
* Ul"den. Gleichwohl mag ein Zusammenhang mit jenen älteren Darstellungen bestehen und ebenso,
Wle auf allen diesen venezianischen Gemälden die Musik eine Hauptrolle spielt, so ist uns
schon auf jenem fälschlich sogenannten «großen Liebesgarten» ein musizierendes Paar begegnet.
Nicht selten kommt dann, auch im übrigen Oberitalien, das weit nüchternere, auf rein natura-
listische Wirkung ausgehende Halbfigurenbild musizierender oder einander liebkosender Männer
^^FVauen vor. Besonders häufig findet man es bei Callisto da Lodi und in seinem Kreise1
^ 1 Beispiele in der Johnsonschen Sammlung zu Philadelphia (vgl. Berensons Katalog I [1913], Nr. 234), m der Sammlung
CS ^errn Dr. Hermann Eisler in Wien und in der Dresdener Galerie (Nr. 221); dazu vergleiche man eine Handzeichnung
der Uffi
z'en zu Florenz (unter Giorgiones Namen).
55
Wenn aus solchen Anregungen und Anfängen das venezianische Genrebild dieser Art hervor-
gegangen ist, so wird dies kein Kunstfreund jemals bedauern können. Ein stilles Beisammensein
v°n jungen, schönen Menschen, teils nackt, teils in prächtiger Modetracht, meist beim Klange der
Laute oder Hirtenflöte, wird in solchen Bildern geschildert, in dem berühmten Hauptwerke der
Gattung, Giorgiones ländlichem Konzert im Louvre, oder in den Gemälden von Nachahmern, wie
Cariani und Bonifazio, beim Lord Lansdowne, in der Lochisschen Sammlung in Bergamo, in der
Nationalgalerie zu London und in der Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste in
Wien. Obwohl hier nur höchst selten Zärtlichkeiten zwischen den beiden Geschlechtern zu finden
Fig. 7. Niederländisch um 1550, Musizierende Gesellschaft.
Basel, Museum.
Slnd, trotzdem aber die Gesellschaftsstufe der Dargestellten nicht allzu hoch gedacht werden kann,
spricht ein solcher poetischer Stimmungszauber aus diesen Bildern, daß wir für sie den romantischen
Ausdruck des «Liebesgartens», von dem wir ausgegangen sind, fast am meisten am Platze finden
* Ul"den. Gleichwohl mag ein Zusammenhang mit jenen älteren Darstellungen bestehen und ebenso,
Wle auf allen diesen venezianischen Gemälden die Musik eine Hauptrolle spielt, so ist uns
schon auf jenem fälschlich sogenannten «großen Liebesgarten» ein musizierendes Paar begegnet.
Nicht selten kommt dann, auch im übrigen Oberitalien, das weit nüchternere, auf rein natura-
listische Wirkung ausgehende Halbfigurenbild musizierender oder einander liebkosender Männer
^^FVauen vor. Besonders häufig findet man es bei Callisto da Lodi und in seinem Kreise1
^ 1 Beispiele in der Johnsonschen Sammlung zu Philadelphia (vgl. Berensons Katalog I [1913], Nr. 234), m der Sammlung
CS ^errn Dr. Hermann Eisler in Wien und in der Dresdener Galerie (Nr. 221); dazu vergleiche man eine Handzeichnung
der Uffi
z'en zu Florenz (unter Giorgiones Namen).