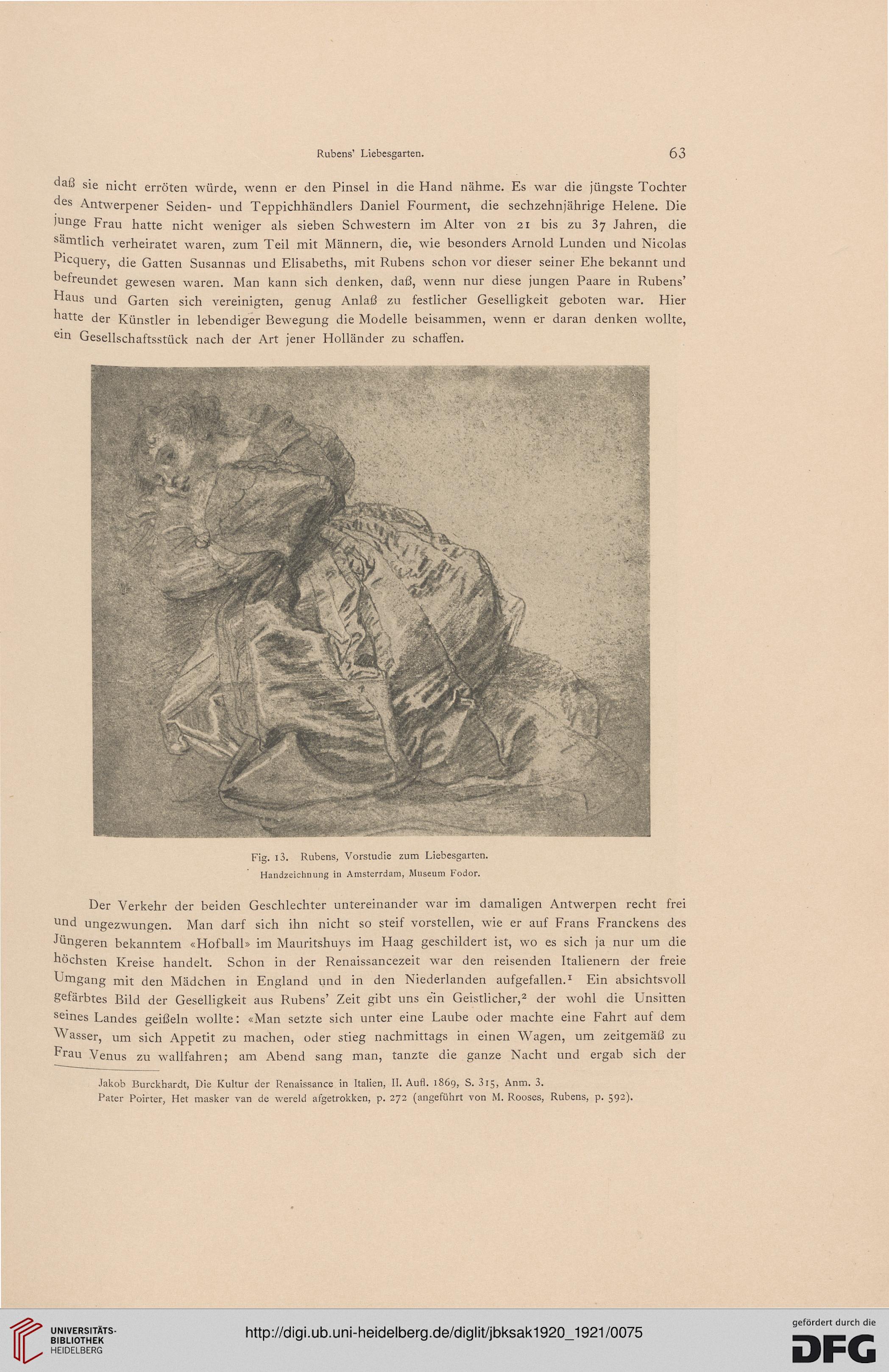Rubens' Liebesgarten.
63
daß sie nicht erröten würde, wenn er den Pinsel in die Hand nähme. Es war die jüngste Tochter
des Antwerpener Seiden- und Teppichhändlers Daniel Fourment, die sechzehnjährige Helene. Die
junge Frau hatte nicht weniger als sieben Schwestern im Alter von 21 bis zu 37 Jahren, die
sämtlich verheiratet waren, zum Teil mit Männern, die, wie besonders Arnold Lunden und Nicolas
Picquery, die Gatten Susannas und Elisabeths, mit Rubens schon vor dieser seiner Ehe bekannt und
befreundet gewesen waren. Man kann sich denken, daß, wenn nur diese jungen Paare in Rubens-
Haus und Garten sich vereinigten, genug Anlaß zu festlicher Geselligkeit geboten war. Hier
hatte der Künstler in lebendiger Bewegung die Modelle beisammen, wenn er daran denken wollte,
ein Gesellschaftsstück nach der Art jener Holländer zu schaffen.
Fig. i3. Rubens, Vorstudie zum Liebesgarten.
Handzeichnung in Amstcrrdam, Museum Fodor.
Der Verkehr der beiden Geschlechter untereinander war im damaligen Antwerpen recht frei
und ungezwungen. Man darf sich ihn nicht so steif vorstellen, wie er auf Frans Franckens des
Jüngeren bekanntem «Hofball» im Mauritshuys im Haag geschildert ist, wo es sich ja nur um die
höchsten Kreise handelt. Schon in der Renaissancezeit war den reisenden Italienern der freie
Umgang mit den Mädchen in England und in den Niederlanden aufgefallen.1 Ein absichtsvoll
gefärbtes Bild der Geselligkeit aus Rubens' Zeit gibt uns ein Geistlicher,2 der wohl die Unsitten
seines Landes geißeln wollte: «Man setzte sich unter eine Laube oder machte eine Fahrt auf dem
Wasser, um sich Appetit zu machen, oder stieg nachmittags in einen Wagen, um zeitgemäß zu
Frau Venus zu wallfahren; am Abend sang man, tanzte die ganze Nacht und ergab sich der
Jakob Burckhardt, Die Kultur der Renaissance in Italien, II. Aufl. 1869, S. 315, Anm. 3.
Pater Poirter, Het masker van de wereld afgetrokken, p. 272 (angeführt von M. Rooses, Rubens, p. 592).
63
daß sie nicht erröten würde, wenn er den Pinsel in die Hand nähme. Es war die jüngste Tochter
des Antwerpener Seiden- und Teppichhändlers Daniel Fourment, die sechzehnjährige Helene. Die
junge Frau hatte nicht weniger als sieben Schwestern im Alter von 21 bis zu 37 Jahren, die
sämtlich verheiratet waren, zum Teil mit Männern, die, wie besonders Arnold Lunden und Nicolas
Picquery, die Gatten Susannas und Elisabeths, mit Rubens schon vor dieser seiner Ehe bekannt und
befreundet gewesen waren. Man kann sich denken, daß, wenn nur diese jungen Paare in Rubens-
Haus und Garten sich vereinigten, genug Anlaß zu festlicher Geselligkeit geboten war. Hier
hatte der Künstler in lebendiger Bewegung die Modelle beisammen, wenn er daran denken wollte,
ein Gesellschaftsstück nach der Art jener Holländer zu schaffen.
Fig. i3. Rubens, Vorstudie zum Liebesgarten.
Handzeichnung in Amstcrrdam, Museum Fodor.
Der Verkehr der beiden Geschlechter untereinander war im damaligen Antwerpen recht frei
und ungezwungen. Man darf sich ihn nicht so steif vorstellen, wie er auf Frans Franckens des
Jüngeren bekanntem «Hofball» im Mauritshuys im Haag geschildert ist, wo es sich ja nur um die
höchsten Kreise handelt. Schon in der Renaissancezeit war den reisenden Italienern der freie
Umgang mit den Mädchen in England und in den Niederlanden aufgefallen.1 Ein absichtsvoll
gefärbtes Bild der Geselligkeit aus Rubens' Zeit gibt uns ein Geistlicher,2 der wohl die Unsitten
seines Landes geißeln wollte: «Man setzte sich unter eine Laube oder machte eine Fahrt auf dem
Wasser, um sich Appetit zu machen, oder stieg nachmittags in einen Wagen, um zeitgemäß zu
Frau Venus zu wallfahren; am Abend sang man, tanzte die ganze Nacht und ergab sich der
Jakob Burckhardt, Die Kultur der Renaissance in Italien, II. Aufl. 1869, S. 315, Anm. 3.
Pater Poirter, Het masker van de wereld afgetrokken, p. 272 (angeführt von M. Rooses, Rubens, p. 592).