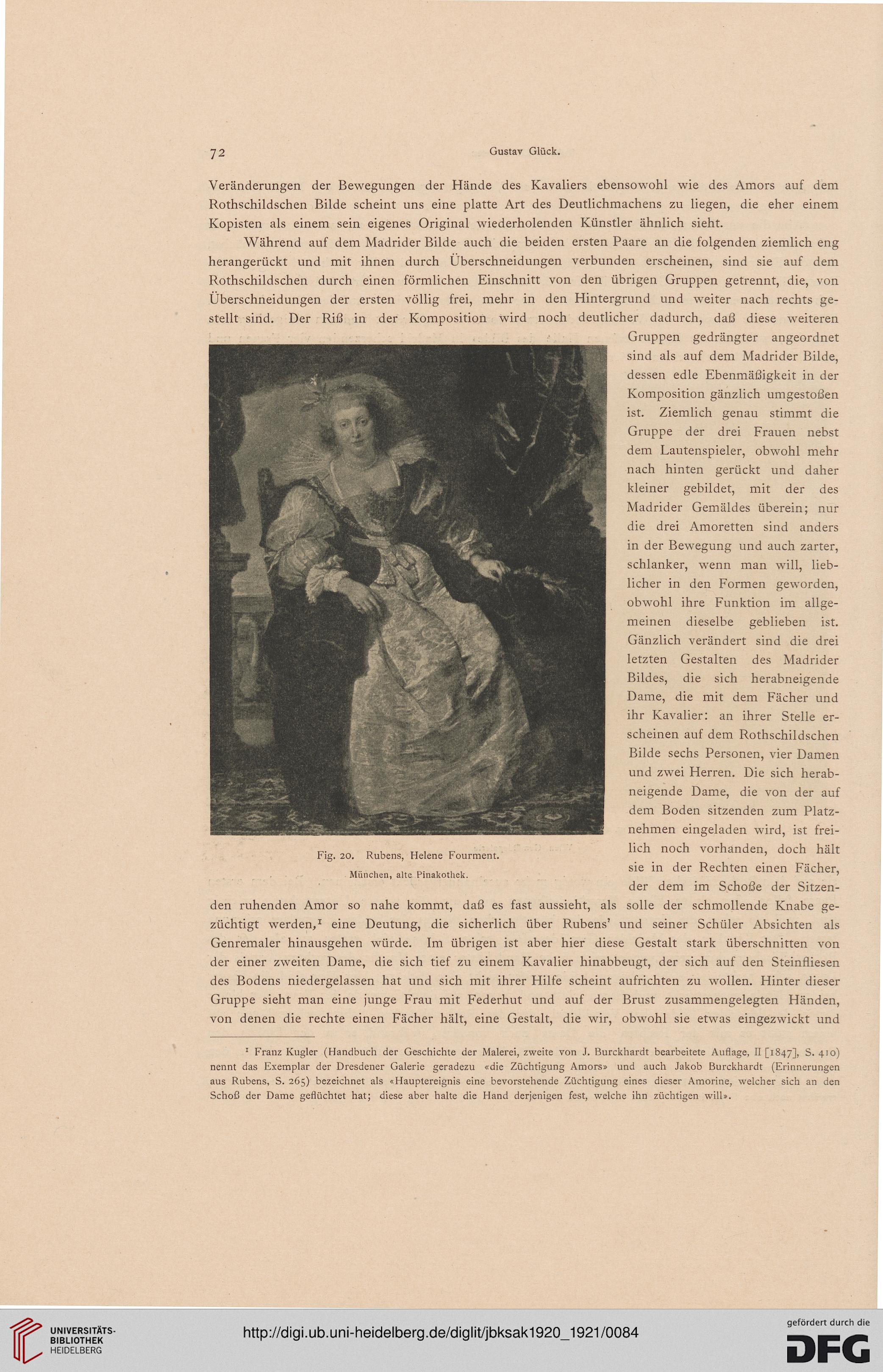7?
Gustav Glück.
Veränderungen der Bewegungen der Hände des Kavaliers ebensowohl wie des Amors auf dem
Rothschildschen Bilde scheint uns eine platte Art des Deutlichmachens zu liegen, die eher einem
Kopisten als einem sein eigenes Original wiederholenden Künstler ähnlich sieht.
Während auf dem Madrider Bilde auch die beiden ersten Paare an die folgenden ziemlich eng
herangerückt und mit ihnen durch Überschneidungen verbunden erscheinen, sind sie auf dem
Rothschildschen durch einen förmlichen Einschnitt von den übrigen Gruppen getrennt, die, von
Überschneidungen der ersten völlig frei, mehr in den Hintergrund und weiter nach rechts ge-
stellt sind. Der Riß in der Komposition wird noch deutlicher dadurch, daß diese weiteren
Gruppen gedrängter angeordnet
sind als auf dem Madrider Bilde,
dessen edle Ebenmäßigkeit in der
Komposition gänzlich umgestoßen
ist. Ziemlich genau stimmt die
Gruppe der drei Frauen nebst
dem Lautenspieler, obwohl mehr
nach hinten gerückt und daher
. JÄjlf'^Hjk kleiner gebildet, mit der des
Madrider Gemäldes überein; nur
die drei Amoretten sind anders
Hteta. 3 in der Bewegung und auch zarter,
schlanker, wenn man will, lieb-
licher in den Formen geworden,
obwohl ihre Funktion im allge-
meinen dieselbe geblieben ist.
Gänzlich verändert sind die drei
letzten Gestalten des Madrider
Bildes, die sich herabneigende
Dame, die mit dem Fächer und
ihr Kavalier: an ihrer Stelle er-
scheinen auf dem Rothschildschen
Bilde sechs Personen, vier Damen
und zwei Herren. Die sich herab-
neigende Dame, die von der auf
dem Boden sitzenden zum Platz-
nehmen eingeladen wird, ist frei-
lich noch vorhanden, doch hält
sie in der Rechten einen Fächer,
der dem im Schöße der Sitzen-
den ruhenden Amor so nahe kommt, daß es fast aussieht, als solle der schmollende Knabe ge-
züchtigt werden,1 eine Deutung, die sicherlich über Rubens' und seiner Schüler Absichten als
Genremaler hinausgehen würde. Im übrigen ist aber hier diese Gestalt stark überschnitten von
der einer zweiten Dame, die sich tief zu einem Kavalier hinabbeugt, der sich auf den Steinfliesen
des Bodens niedergelassen hat und sich mit ihrer Hilfe scheint aufrichten zu wollen. Hinter dieser
Gruppe sieht man eine junge Frau mit Federhut und auf der Brust zusammengelegten Händen,
von denen die rechte einen Fächer hält, eine Gestalt, die wir, obwohl sie etwas eingezwickt und
Fig. 20. Rubens, Helene Fourment.
München, alte Pinakothek.
1 Franz Kugler (Handbuch der Geschichte der Malerei, zweite von J. Burckhardt bearbeitete Auflage, II [1847], S. 410)
nennt das Exemplar der Dresdener Galerie geradezu «die Züchtigung Amors» und auch Jakob Burckhardt (Erinnerungen
aus Rubens, S. 265) bezeichnet als «Hauptereignis eine bevorstehende Züchtigung eines dieser Amorine, welcher sich an den
Schoß der Dame geflüchtet hat; diese aber halte die Hand derjenigen fest, welche ihn züchtigen will».
Gustav Glück.
Veränderungen der Bewegungen der Hände des Kavaliers ebensowohl wie des Amors auf dem
Rothschildschen Bilde scheint uns eine platte Art des Deutlichmachens zu liegen, die eher einem
Kopisten als einem sein eigenes Original wiederholenden Künstler ähnlich sieht.
Während auf dem Madrider Bilde auch die beiden ersten Paare an die folgenden ziemlich eng
herangerückt und mit ihnen durch Überschneidungen verbunden erscheinen, sind sie auf dem
Rothschildschen durch einen förmlichen Einschnitt von den übrigen Gruppen getrennt, die, von
Überschneidungen der ersten völlig frei, mehr in den Hintergrund und weiter nach rechts ge-
stellt sind. Der Riß in der Komposition wird noch deutlicher dadurch, daß diese weiteren
Gruppen gedrängter angeordnet
sind als auf dem Madrider Bilde,
dessen edle Ebenmäßigkeit in der
Komposition gänzlich umgestoßen
ist. Ziemlich genau stimmt die
Gruppe der drei Frauen nebst
dem Lautenspieler, obwohl mehr
nach hinten gerückt und daher
. JÄjlf'^Hjk kleiner gebildet, mit der des
Madrider Gemäldes überein; nur
die drei Amoretten sind anders
Hteta. 3 in der Bewegung und auch zarter,
schlanker, wenn man will, lieb-
licher in den Formen geworden,
obwohl ihre Funktion im allge-
meinen dieselbe geblieben ist.
Gänzlich verändert sind die drei
letzten Gestalten des Madrider
Bildes, die sich herabneigende
Dame, die mit dem Fächer und
ihr Kavalier: an ihrer Stelle er-
scheinen auf dem Rothschildschen
Bilde sechs Personen, vier Damen
und zwei Herren. Die sich herab-
neigende Dame, die von der auf
dem Boden sitzenden zum Platz-
nehmen eingeladen wird, ist frei-
lich noch vorhanden, doch hält
sie in der Rechten einen Fächer,
der dem im Schöße der Sitzen-
den ruhenden Amor so nahe kommt, daß es fast aussieht, als solle der schmollende Knabe ge-
züchtigt werden,1 eine Deutung, die sicherlich über Rubens' und seiner Schüler Absichten als
Genremaler hinausgehen würde. Im übrigen ist aber hier diese Gestalt stark überschnitten von
der einer zweiten Dame, die sich tief zu einem Kavalier hinabbeugt, der sich auf den Steinfliesen
des Bodens niedergelassen hat und sich mit ihrer Hilfe scheint aufrichten zu wollen. Hinter dieser
Gruppe sieht man eine junge Frau mit Federhut und auf der Brust zusammengelegten Händen,
von denen die rechte einen Fächer hält, eine Gestalt, die wir, obwohl sie etwas eingezwickt und
Fig. 20. Rubens, Helene Fourment.
München, alte Pinakothek.
1 Franz Kugler (Handbuch der Geschichte der Malerei, zweite von J. Burckhardt bearbeitete Auflage, II [1847], S. 410)
nennt das Exemplar der Dresdener Galerie geradezu «die Züchtigung Amors» und auch Jakob Burckhardt (Erinnerungen
aus Rubens, S. 265) bezeichnet als «Hauptereignis eine bevorstehende Züchtigung eines dieser Amorine, welcher sich an den
Schoß der Dame geflüchtet hat; diese aber halte die Hand derjenigen fest, welche ihn züchtigen will».