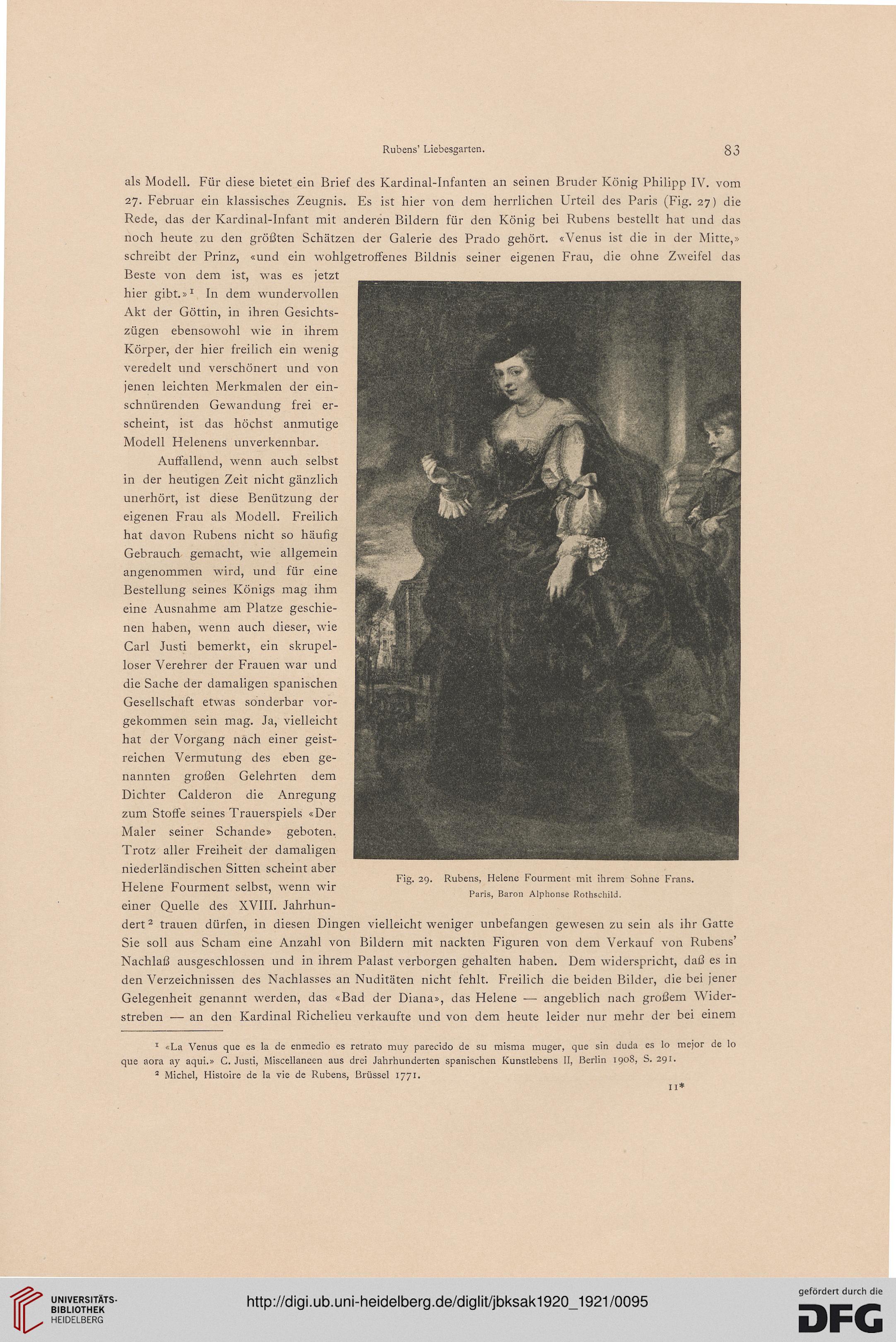Rubens' Liebesgarten.
83
als Modell. Für diese bietet ein Brief des Kardinal-Infanten an seinen Bruder König Philipp IV. vom
27. Februar ein klassisches Zeugnis. Es ist hier von dem herrlichen Urteil des Paris (Fig. 27) die
Rede, das der Kardinal-Infant mit anderen Bildern für den König bei Rubens bestellt hat und das
noch heute zu den größten Schätzen der Galerie des Prado gehört. «Venus ist die in der Mitte,»
schreibt der Prinz, «und ein wohlgetroffenes Bildnis seiner eigenen Frau, die ohne Zweifel das
Beste von dem ist, was es jetzt
hier gibt.»1 In dem wundervollen
Akt der Göttin, in ihren Gesichts-
zügen ebensowohl wie in ihrem
Körper, der hier freilich ein wenig
veredelt und verschönert und von
jenen leichten Merkmalen der ein-
schnürenden Gewandung frei er-
scheint, ist das höchst anmutige
Modell Helenens unverkennbar.
Auffallend, wenn auch selbst
in der heutigen Zeit nicht gänzlich
unerhört, ist diese Benützung der
eigenen Frau als Modell. Freilich
hat davon Rubens nicht so häufig
Gebrauch gemacht, wie allgemein
angenommen wird, und für eine
Bestellung seines Königs mag ihm
eine Ausnahme am Platze geschie-
nen haben, wenn auch dieser, wie
Carl Justi bemerkt, ein skrupel-
loser Verehrer der Frauen war und
die Sache der damaligen spanischen
Gesellschaft etwas sonderbar vor-
gekommen sein mag. Ja, vielleicht
hat der Vorgang nach einer geist-
reichen Vermutung des eben ge-
nannten großen Gelehrten dem
Dichter Calderon die Anregung
zum Stoffe seines Trauerspiels «Der
Maler seiner Schande» geboten.
Trotz aller Freiheit der damaligen
niederländischen Sitten scheint aber
Helene Fourment selbst, wenn wir
einer Quelle des XVIII. Jahrhun-
dert2 trauen dürfen, in diesen Dingen vielleicht weniger unbefangen gewesen zu sein als ihr Gatte
Sie soll aus Scham eine Anzahl von Bildern mit nackten Figuren von dem Verkauf von Rubens'
Nachlaß ausgeschlossen und in ihrem Palast verborgen gehalten haben. Dem widerspricht, daß es in
den Verzeichnissen des Nachlasses an Nuditäten nicht fehlt. Freilich die beiden Bilder, die bei jener
Gelegenheit genannt werden, das «Bad der Diana», das Helene — angeblich nach großem Wider-
streben — an den Kardinal Richelieu verkaufte und von dem heute leider nur mehr der bei einem
Fig. 29.
Rubens, Helene Fourment mit ihrem Sohne Frans.
Paris, Baron Alphonse Rothschild.
1 «La Venus que es la de enmedio es retrato muy parecido de su misma muger, que sin duda es lo mejor de lo
que aora ay aqui.» C. Justi, Miscellaneen aus drei Jahrhunderten spanischen Kunstlebens II, Berlin 1908, S. 291.
3 Michel, Histoire de la vie de Rubens, Brüssel 1771.
II*
83
als Modell. Für diese bietet ein Brief des Kardinal-Infanten an seinen Bruder König Philipp IV. vom
27. Februar ein klassisches Zeugnis. Es ist hier von dem herrlichen Urteil des Paris (Fig. 27) die
Rede, das der Kardinal-Infant mit anderen Bildern für den König bei Rubens bestellt hat und das
noch heute zu den größten Schätzen der Galerie des Prado gehört. «Venus ist die in der Mitte,»
schreibt der Prinz, «und ein wohlgetroffenes Bildnis seiner eigenen Frau, die ohne Zweifel das
Beste von dem ist, was es jetzt
hier gibt.»1 In dem wundervollen
Akt der Göttin, in ihren Gesichts-
zügen ebensowohl wie in ihrem
Körper, der hier freilich ein wenig
veredelt und verschönert und von
jenen leichten Merkmalen der ein-
schnürenden Gewandung frei er-
scheint, ist das höchst anmutige
Modell Helenens unverkennbar.
Auffallend, wenn auch selbst
in der heutigen Zeit nicht gänzlich
unerhört, ist diese Benützung der
eigenen Frau als Modell. Freilich
hat davon Rubens nicht so häufig
Gebrauch gemacht, wie allgemein
angenommen wird, und für eine
Bestellung seines Königs mag ihm
eine Ausnahme am Platze geschie-
nen haben, wenn auch dieser, wie
Carl Justi bemerkt, ein skrupel-
loser Verehrer der Frauen war und
die Sache der damaligen spanischen
Gesellschaft etwas sonderbar vor-
gekommen sein mag. Ja, vielleicht
hat der Vorgang nach einer geist-
reichen Vermutung des eben ge-
nannten großen Gelehrten dem
Dichter Calderon die Anregung
zum Stoffe seines Trauerspiels «Der
Maler seiner Schande» geboten.
Trotz aller Freiheit der damaligen
niederländischen Sitten scheint aber
Helene Fourment selbst, wenn wir
einer Quelle des XVIII. Jahrhun-
dert2 trauen dürfen, in diesen Dingen vielleicht weniger unbefangen gewesen zu sein als ihr Gatte
Sie soll aus Scham eine Anzahl von Bildern mit nackten Figuren von dem Verkauf von Rubens'
Nachlaß ausgeschlossen und in ihrem Palast verborgen gehalten haben. Dem widerspricht, daß es in
den Verzeichnissen des Nachlasses an Nuditäten nicht fehlt. Freilich die beiden Bilder, die bei jener
Gelegenheit genannt werden, das «Bad der Diana», das Helene — angeblich nach großem Wider-
streben — an den Kardinal Richelieu verkaufte und von dem heute leider nur mehr der bei einem
Fig. 29.
Rubens, Helene Fourment mit ihrem Sohne Frans.
Paris, Baron Alphonse Rothschild.
1 «La Venus que es la de enmedio es retrato muy parecido de su misma muger, que sin duda es lo mejor de lo
que aora ay aqui.» C. Justi, Miscellaneen aus drei Jahrhunderten spanischen Kunstlebens II, Berlin 1908, S. 291.
3 Michel, Histoire de la vie de Rubens, Brüssel 1771.
II*