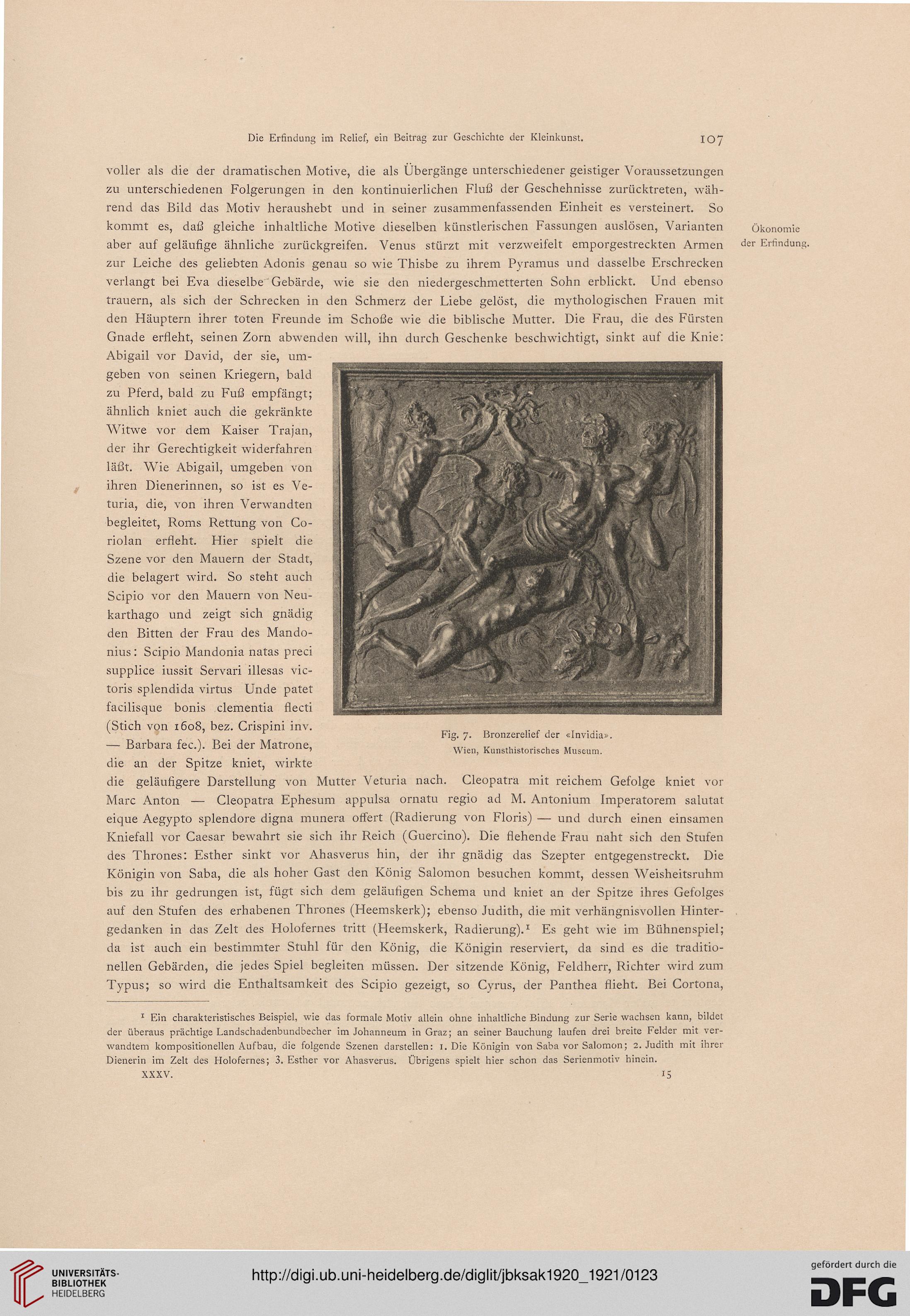Die Erfindung im Relief, ein Beitrag zur Geschichte der Kleinkunst.
I07
voller als die der dramatischen Motive, die als Übergänge unterschiedener geistiger Voraussetzungen
zu unterschiedenen Folgerungen in den kontinuierlichen Fluß der Geschehnisse zurücktreten, wäh-
rend das Bild das Motiv heraushebt und in seiner zusammenfassenden Einheit es versteinert. So
kommt es, daß gleiche inhaltliche Motive dieselben künstlerischen Fassungen auslösen, Varianten Ökonomie
aber auf geläufige ähnliche zurückgreifen. Venus stürzt mit verzweifelt emporgestreckten Armen der Erfindung,
zur Leiche des geliebten Adonis genau so wie Thisbe zu ihrem Pyramus und dasselbe Erschrecken
verlangt bei Eva dieselbe Gebärde, wie sie den niedergeschmetterten Sohn erblickt. Und ebenso
trauern, als sich der Schrecken in den Schmerz der Liebe gelöst, die mythologischen Frauen mit
den Häuptern ihrer toten Freunde im Schöße wie die biblische Mutter. Die Frau, die des Fürsten
Gnade erfleht, seinen Zorn abwenden will, ihn durch Geschenke beschwichtigt, sinkt auf die Knie:
Abigail vor David, der sie, um-
geben von seinen Kriegern, bald
zu Pferd, bald zu Fuß empfängt;
ähnlich kniet auch die gekränkte
Witwe vor dem Kaiser Trajan,
der ihr Gerechtigkeit widerfahren
läßt. Wie Abigail, umgeben von
ihren Dienerinnen, so ist es Ve-
turia, die, von ihren Verwandten
begleitet, Roms Rettung von Co-
riolan erfleht. Hier spielt die
Szene vor den Mauern der Stadt,
die belagert wird. So steht auch
Scipio vor den Mauern von Neu-
karthago und zeigt sich gnädig
den Bitten der Frau des Mando-
nius: Scipio Mandonia natas preci
supplice iussit Servari illesas vic-
toris splendida virtus Unde patet
facilisque bonis dementia flecti
(Stich von 1608, bez. Crispini inv.
— Barbara fec). Bei der Matrone,
die an der Spitze kniet, wirkte
die geläufigere Darstellung von Mutter Veturia nach. Cleopatra mit reichem Gefolge kniet vor
Marc Anton — Cleopatra Ephesum appulsa ornatu regio ad M. Antonium Imperatorem salutat
eique Aegypto splendore digna munera offert (Radierung von Floris) — und durch einen einsamen
Kniefall vor Caesar bewahrt sie sich ihr Reich (Guercino). Die flehende Frau naht sich den Stufen
des Thrones: Esther sinkt vor Ahasverus hin, der ihr gnädig das Szepter entgegenstreckt. Die
Königin von Saba, die als hoher Gast den König Salomon besuchen kommt, dessen Weisheitsruhm
bis zu ihr gedrungen ist, fügt sich dem geläufigen Schema und kniet an der Spitze ihres Gefolges
auf den Stufen des erhabenen Thrones (Heemskerk); ebenso Judith, die mit verhängnisvollen Hinter-
gedanken in das Zelt des Holofernes tritt (Heemskerk, Radierung).1 Es geht wie im Bühnenspiel;
da ist auch ein bestimmter Stuhl für den König, die Königin reserviert, da sind es die traditio-
nellen Gebärden, die jedes Spiel begleiten müssen. Der sitzende König, Feldherr, Richter wird zum
Typus; so wird die Enthaltsamkeit des Scipio gezeigt, so Cyrus, der Panthea flieht. Bei Cortona,
1 Ein charakteristisches Beispiel, wie das formale Motiv allein ohne inhaltliche Bindung zur Serie wachsen kann, bildet
der überaus prächtige Landschadenbundbecher im Johanneum in Graz; an seiner Bauchung laufen drei breite Felder mit ver-
wandtem kompositionellen Aufbau, die folgende Szenen darstellen: 1. Die Königin von Saba vor Salomon; 2. Judith mit ihrer
Dienerin im Zelt des Holofernes; 3. Esther vor Ahasverus. Übrigens spielt hier schon das Serienmotiv hinein.
XXXV. 15
Fig. 7. ßronzerelief der «Invidia».
Wien, Kunsthistorisches Museum.
I07
voller als die der dramatischen Motive, die als Übergänge unterschiedener geistiger Voraussetzungen
zu unterschiedenen Folgerungen in den kontinuierlichen Fluß der Geschehnisse zurücktreten, wäh-
rend das Bild das Motiv heraushebt und in seiner zusammenfassenden Einheit es versteinert. So
kommt es, daß gleiche inhaltliche Motive dieselben künstlerischen Fassungen auslösen, Varianten Ökonomie
aber auf geläufige ähnliche zurückgreifen. Venus stürzt mit verzweifelt emporgestreckten Armen der Erfindung,
zur Leiche des geliebten Adonis genau so wie Thisbe zu ihrem Pyramus und dasselbe Erschrecken
verlangt bei Eva dieselbe Gebärde, wie sie den niedergeschmetterten Sohn erblickt. Und ebenso
trauern, als sich der Schrecken in den Schmerz der Liebe gelöst, die mythologischen Frauen mit
den Häuptern ihrer toten Freunde im Schöße wie die biblische Mutter. Die Frau, die des Fürsten
Gnade erfleht, seinen Zorn abwenden will, ihn durch Geschenke beschwichtigt, sinkt auf die Knie:
Abigail vor David, der sie, um-
geben von seinen Kriegern, bald
zu Pferd, bald zu Fuß empfängt;
ähnlich kniet auch die gekränkte
Witwe vor dem Kaiser Trajan,
der ihr Gerechtigkeit widerfahren
läßt. Wie Abigail, umgeben von
ihren Dienerinnen, so ist es Ve-
turia, die, von ihren Verwandten
begleitet, Roms Rettung von Co-
riolan erfleht. Hier spielt die
Szene vor den Mauern der Stadt,
die belagert wird. So steht auch
Scipio vor den Mauern von Neu-
karthago und zeigt sich gnädig
den Bitten der Frau des Mando-
nius: Scipio Mandonia natas preci
supplice iussit Servari illesas vic-
toris splendida virtus Unde patet
facilisque bonis dementia flecti
(Stich von 1608, bez. Crispini inv.
— Barbara fec). Bei der Matrone,
die an der Spitze kniet, wirkte
die geläufigere Darstellung von Mutter Veturia nach. Cleopatra mit reichem Gefolge kniet vor
Marc Anton — Cleopatra Ephesum appulsa ornatu regio ad M. Antonium Imperatorem salutat
eique Aegypto splendore digna munera offert (Radierung von Floris) — und durch einen einsamen
Kniefall vor Caesar bewahrt sie sich ihr Reich (Guercino). Die flehende Frau naht sich den Stufen
des Thrones: Esther sinkt vor Ahasverus hin, der ihr gnädig das Szepter entgegenstreckt. Die
Königin von Saba, die als hoher Gast den König Salomon besuchen kommt, dessen Weisheitsruhm
bis zu ihr gedrungen ist, fügt sich dem geläufigen Schema und kniet an der Spitze ihres Gefolges
auf den Stufen des erhabenen Thrones (Heemskerk); ebenso Judith, die mit verhängnisvollen Hinter-
gedanken in das Zelt des Holofernes tritt (Heemskerk, Radierung).1 Es geht wie im Bühnenspiel;
da ist auch ein bestimmter Stuhl für den König, die Königin reserviert, da sind es die traditio-
nellen Gebärden, die jedes Spiel begleiten müssen. Der sitzende König, Feldherr, Richter wird zum
Typus; so wird die Enthaltsamkeit des Scipio gezeigt, so Cyrus, der Panthea flieht. Bei Cortona,
1 Ein charakteristisches Beispiel, wie das formale Motiv allein ohne inhaltliche Bindung zur Serie wachsen kann, bildet
der überaus prächtige Landschadenbundbecher im Johanneum in Graz; an seiner Bauchung laufen drei breite Felder mit ver-
wandtem kompositionellen Aufbau, die folgende Szenen darstellen: 1. Die Königin von Saba vor Salomon; 2. Judith mit ihrer
Dienerin im Zelt des Holofernes; 3. Esther vor Ahasverus. Übrigens spielt hier schon das Serienmotiv hinein.
XXXV. 15
Fig. 7. ßronzerelief der «Invidia».
Wien, Kunsthistorisches Museum.