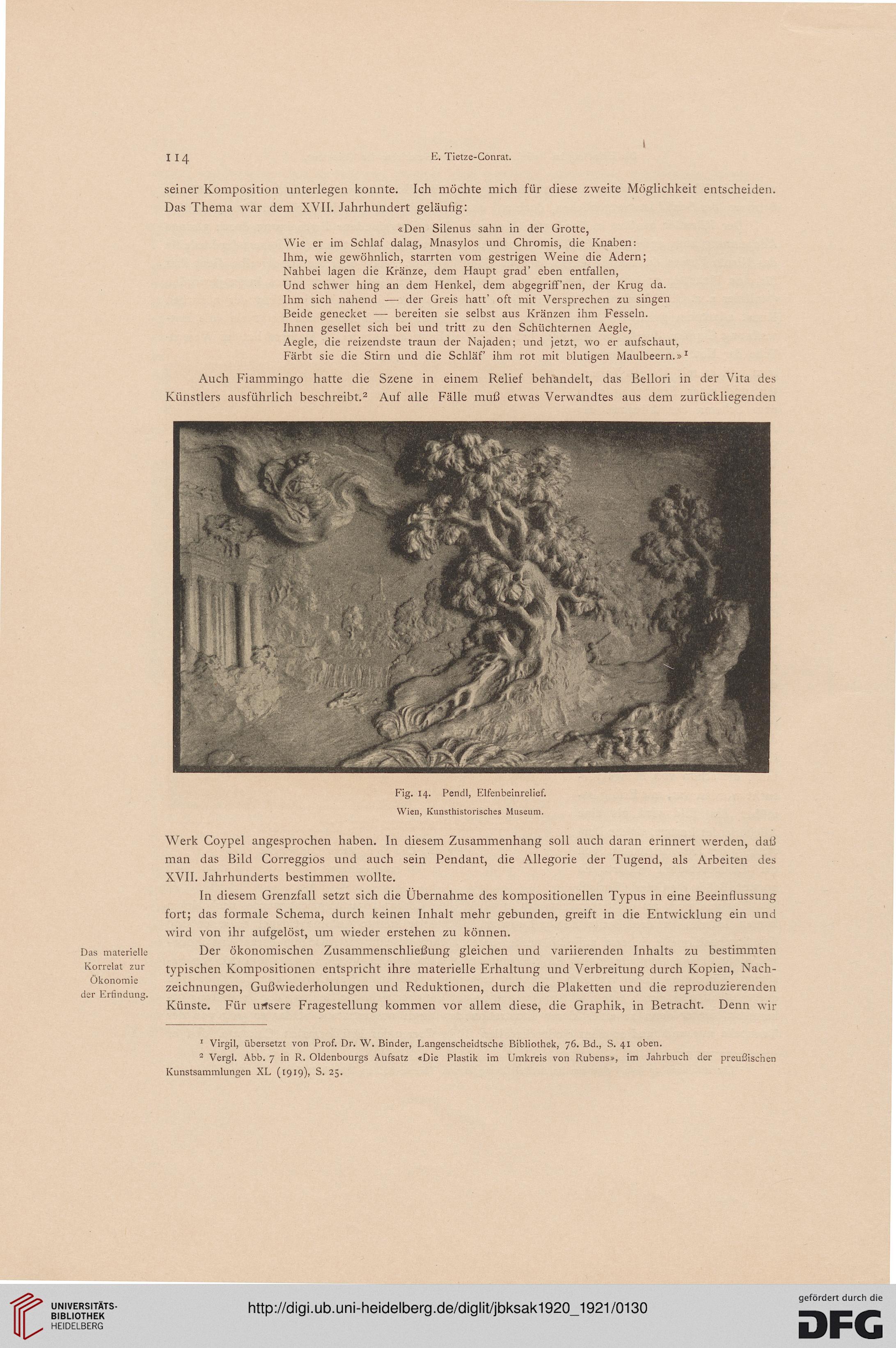H4
E. Tietze-Conrat.
seiner Komposition unterlegen konnte. Ich möchte mich für diese zweite Möglichkeit entscheiden.
Das Thema war dem XVII. Jahrhundert geläufig:
«Den Silenus sahn in der Grotte,
Wie er im Schlaf dalag, Mnasylos und Chromis, die Knaben:
Ihm, wie gewöhnlich, starrten vom gestrigen Weine die Adern;
Nahbei lagen die Kränze, dem Haupt grad' eben entfallen,
Und schwer hing an dem Henkel, dem abgegriffnen, der Krug da.
Ihm sich nahend — der Greis hau' oft mit Versprechen zu singen
Beide genecket — bereiten sie selbst aus Kränzen ihm Fesseln.
Ihnen gesellet sich bei und tritt zu den Schüchternen Aegle,
Aegle, die reizendste traun der Najaden; und jetzt, wo er aufschaut,
Färbt sie die Stirn und die Schläf ihm rot mit blutigen Maulbeern.»1
Auch Fiammingo hatte die Szene in einem Relief behandelt, das Bellori in der Vita des
Künstlers ausführlich beschreibt.2 Auf alle Fälle muß etwas Verwandtes aus dem zurückliegenden
Fig. 14. Pendl, Elfenbeinrelief.
Wien, Kunsthistorisches Museum.
Das materielle
Korrelat zur
Ökonomie
der Erfindung.
Werk Coypel angesprochen haben. In diesem Zusammenhang soll auch daran erinnert werden, daß
man das Bild Correggios und auch sein Pendant, die Allegorie der Tugend, als Arbeiten des
XVII. Jahrhunderts bestimmen wollte.
In diesem Grenzfall setzt sich die Übernahme des kompositionellen Typus in eine Beeinflussung
fort; das formale Schema, durch keinen Inhalt mehr gebunden, greift in die Entwicklung ein und
wird von ihr aufgelöst, um wieder erstehen zu können.
Der ökonomischen Zusammenschließung gleichen und variierenden Inhalts zu bestimmten
typischen Kompositionen entspricht ihre materielle Erhaltung und Verbreitung durch Kopien, Nach-
zeichnungen, Gußwiederholungen und Reduktionen, durch die Plaketten und die reproduzierenden
Künste. Für urfsere Fragestellung kommen vor allem diese, die Graphik, in Betracht. Denn wir
1 Virgil, übersetzt von Prof. Dr. W. Binder, Langenscheidtsche Bibliothek, 76. Bd., S. 41 oben.
2 Vergl. Abb. 7 in R. Oldenbourgs Aufsatz «Die Plastik im Umkreis von Rubens», im Jahrbuch der preußischen
Kunstsammlungen XL (1919), S. 25.
E. Tietze-Conrat.
seiner Komposition unterlegen konnte. Ich möchte mich für diese zweite Möglichkeit entscheiden.
Das Thema war dem XVII. Jahrhundert geläufig:
«Den Silenus sahn in der Grotte,
Wie er im Schlaf dalag, Mnasylos und Chromis, die Knaben:
Ihm, wie gewöhnlich, starrten vom gestrigen Weine die Adern;
Nahbei lagen die Kränze, dem Haupt grad' eben entfallen,
Und schwer hing an dem Henkel, dem abgegriffnen, der Krug da.
Ihm sich nahend — der Greis hau' oft mit Versprechen zu singen
Beide genecket — bereiten sie selbst aus Kränzen ihm Fesseln.
Ihnen gesellet sich bei und tritt zu den Schüchternen Aegle,
Aegle, die reizendste traun der Najaden; und jetzt, wo er aufschaut,
Färbt sie die Stirn und die Schläf ihm rot mit blutigen Maulbeern.»1
Auch Fiammingo hatte die Szene in einem Relief behandelt, das Bellori in der Vita des
Künstlers ausführlich beschreibt.2 Auf alle Fälle muß etwas Verwandtes aus dem zurückliegenden
Fig. 14. Pendl, Elfenbeinrelief.
Wien, Kunsthistorisches Museum.
Das materielle
Korrelat zur
Ökonomie
der Erfindung.
Werk Coypel angesprochen haben. In diesem Zusammenhang soll auch daran erinnert werden, daß
man das Bild Correggios und auch sein Pendant, die Allegorie der Tugend, als Arbeiten des
XVII. Jahrhunderts bestimmen wollte.
In diesem Grenzfall setzt sich die Übernahme des kompositionellen Typus in eine Beeinflussung
fort; das formale Schema, durch keinen Inhalt mehr gebunden, greift in die Entwicklung ein und
wird von ihr aufgelöst, um wieder erstehen zu können.
Der ökonomischen Zusammenschließung gleichen und variierenden Inhalts zu bestimmten
typischen Kompositionen entspricht ihre materielle Erhaltung und Verbreitung durch Kopien, Nach-
zeichnungen, Gußwiederholungen und Reduktionen, durch die Plaketten und die reproduzierenden
Künste. Für urfsere Fragestellung kommen vor allem diese, die Graphik, in Betracht. Denn wir
1 Virgil, übersetzt von Prof. Dr. W. Binder, Langenscheidtsche Bibliothek, 76. Bd., S. 41 oben.
2 Vergl. Abb. 7 in R. Oldenbourgs Aufsatz «Die Plastik im Umkreis von Rubens», im Jahrbuch der preußischen
Kunstsammlungen XL (1919), S. 25.