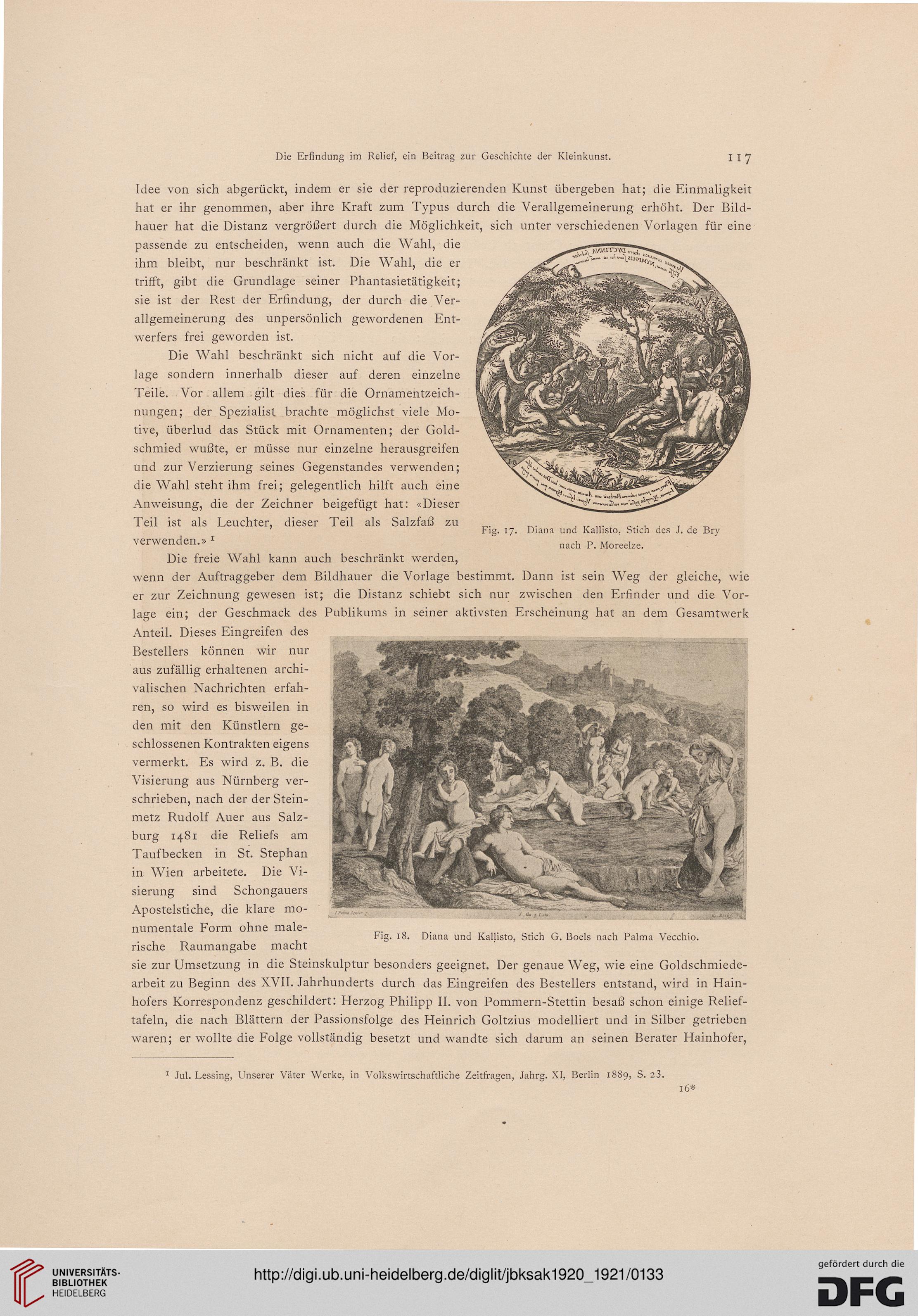Die Erfindung im Relief, ein Beitrag zur Geschichte der Kleinkunst.
117
Fig. 17.
Diana und Kallisto, Stich des J. de Bry
nach P. Moreelze.
Idee von sich abgerückt, indem er sie der reproduzierenden Kunst übergeben hat; die Einmaligkeit
hat er ihr genommen, aber ihre Kraft zum Typus durch die Verallgemeinerung erhöht. Der Bild-
hauer hat die Distanz vergrößert durch die Möglichkeit, sich unter verschiedenen Vorlagen für eine
passende zu entscheiden, wenn auch die Wahl, die
ihm bleibt, nur beschränkt ist. Die Wahl, die er
trifft, gibt die Grundlage seiner Phantasietätigkeit;
sie ist der Rest der Erfindung, der durch die Ver-
allgemeinerung des unpersönlich gewordenen Ent-
werfers frei geworden ist.
Die Wahl beschränkt sich nicht auf die Vor-
lage sondern innerhalb dieser auf deren einzelne
Teile. Vor allem gilt dies für die Ornamentzeich-
nungen; der Spezialist brachte möglichst viele Mo-
tive, überlud das Stück mit Ornamenten; der Gold-
schmied wußte, er müsse nur einzelne herausgreifen
und zur Verzierung seines Gegenstandes verwenden;
die Wahl steht ihm frei; gelegentlich hilft auch eine
Anweisung, die der Zeichner beigefügt hat: «Dieser
Teil ist als Leuchter, dieser Teil als Salzfaß zu
verwenden.» 1
Die freie Wahl kann auch beschränkt werden,
wenn der Auftraggeber dem Bildhauer die Vorlage bestimmt. Dann ist sein Weg der gleiche, wie
er zur Zeichnung gewesen ist; die Distanz schiebt sich nur zwischen den Erfinder und die Vor-
lage ein; der Geschmack des Publikums in seiner aktivsten Erscheinung hat an dem Gesamtwerk
Anteil. Dieses Eingreifen des
Bestellers können wir nur
aus zufällig erhaltenen archi-
valischen Nachrichten erfah-
ren, so wird es bisweilen in
den mit den Künstlern ge-
schlossenen Kontrakten eigens
vermerkt. Es wird z. B. die
Visierung aus Nürnberg ver-
schrieben, nach der der Stein-
metz Rudolf Auer aus Salz-
burg 1481 die Reliefs am
Taufbecken in St. Stephan
in Wien arbeitete. Die Vi-
sierung sind Schongauers
Apostelstiche, die klare mo-
numentale Form ohne male-
rische Raumangabe macht
sie zur Umsetzung in die Steinskulptur besonders geeignet. Der genaue Weg, wie eine Goldschmiede-
arbeit zu Beginn des XVII. Jahrhunderts durch das Eingreifen des Bestellers entstand, wird in Hain-
hofers Korrespondenz geschildert: Herzog Philipp II. von Pommern-Stettin besaß schon einige Relief-
tafeln, die nach Blättern der Passionsfolge des Heinrich Goltzius modelliert und in Silber getrieben
waren; er wollte die Folge vollständig besetzt und wandte sich darum an seinen Berater Hainhofer,
Fig. 18. Diana und Kallisto, Stich G. Boels nach Palma Vecchio.
1 Jul. Lessing, Unserer Väter Werke, in Volkswirtschaftliche Zeitfragen, Jahrg. XI, Berlin 1889, S. 23.
16*
117
Fig. 17.
Diana und Kallisto, Stich des J. de Bry
nach P. Moreelze.
Idee von sich abgerückt, indem er sie der reproduzierenden Kunst übergeben hat; die Einmaligkeit
hat er ihr genommen, aber ihre Kraft zum Typus durch die Verallgemeinerung erhöht. Der Bild-
hauer hat die Distanz vergrößert durch die Möglichkeit, sich unter verschiedenen Vorlagen für eine
passende zu entscheiden, wenn auch die Wahl, die
ihm bleibt, nur beschränkt ist. Die Wahl, die er
trifft, gibt die Grundlage seiner Phantasietätigkeit;
sie ist der Rest der Erfindung, der durch die Ver-
allgemeinerung des unpersönlich gewordenen Ent-
werfers frei geworden ist.
Die Wahl beschränkt sich nicht auf die Vor-
lage sondern innerhalb dieser auf deren einzelne
Teile. Vor allem gilt dies für die Ornamentzeich-
nungen; der Spezialist brachte möglichst viele Mo-
tive, überlud das Stück mit Ornamenten; der Gold-
schmied wußte, er müsse nur einzelne herausgreifen
und zur Verzierung seines Gegenstandes verwenden;
die Wahl steht ihm frei; gelegentlich hilft auch eine
Anweisung, die der Zeichner beigefügt hat: «Dieser
Teil ist als Leuchter, dieser Teil als Salzfaß zu
verwenden.» 1
Die freie Wahl kann auch beschränkt werden,
wenn der Auftraggeber dem Bildhauer die Vorlage bestimmt. Dann ist sein Weg der gleiche, wie
er zur Zeichnung gewesen ist; die Distanz schiebt sich nur zwischen den Erfinder und die Vor-
lage ein; der Geschmack des Publikums in seiner aktivsten Erscheinung hat an dem Gesamtwerk
Anteil. Dieses Eingreifen des
Bestellers können wir nur
aus zufällig erhaltenen archi-
valischen Nachrichten erfah-
ren, so wird es bisweilen in
den mit den Künstlern ge-
schlossenen Kontrakten eigens
vermerkt. Es wird z. B. die
Visierung aus Nürnberg ver-
schrieben, nach der der Stein-
metz Rudolf Auer aus Salz-
burg 1481 die Reliefs am
Taufbecken in St. Stephan
in Wien arbeitete. Die Vi-
sierung sind Schongauers
Apostelstiche, die klare mo-
numentale Form ohne male-
rische Raumangabe macht
sie zur Umsetzung in die Steinskulptur besonders geeignet. Der genaue Weg, wie eine Goldschmiede-
arbeit zu Beginn des XVII. Jahrhunderts durch das Eingreifen des Bestellers entstand, wird in Hain-
hofers Korrespondenz geschildert: Herzog Philipp II. von Pommern-Stettin besaß schon einige Relief-
tafeln, die nach Blättern der Passionsfolge des Heinrich Goltzius modelliert und in Silber getrieben
waren; er wollte die Folge vollständig besetzt und wandte sich darum an seinen Berater Hainhofer,
Fig. 18. Diana und Kallisto, Stich G. Boels nach Palma Vecchio.
1 Jul. Lessing, Unserer Väter Werke, in Volkswirtschaftliche Zeitfragen, Jahrg. XI, Berlin 1889, S. 23.
16*