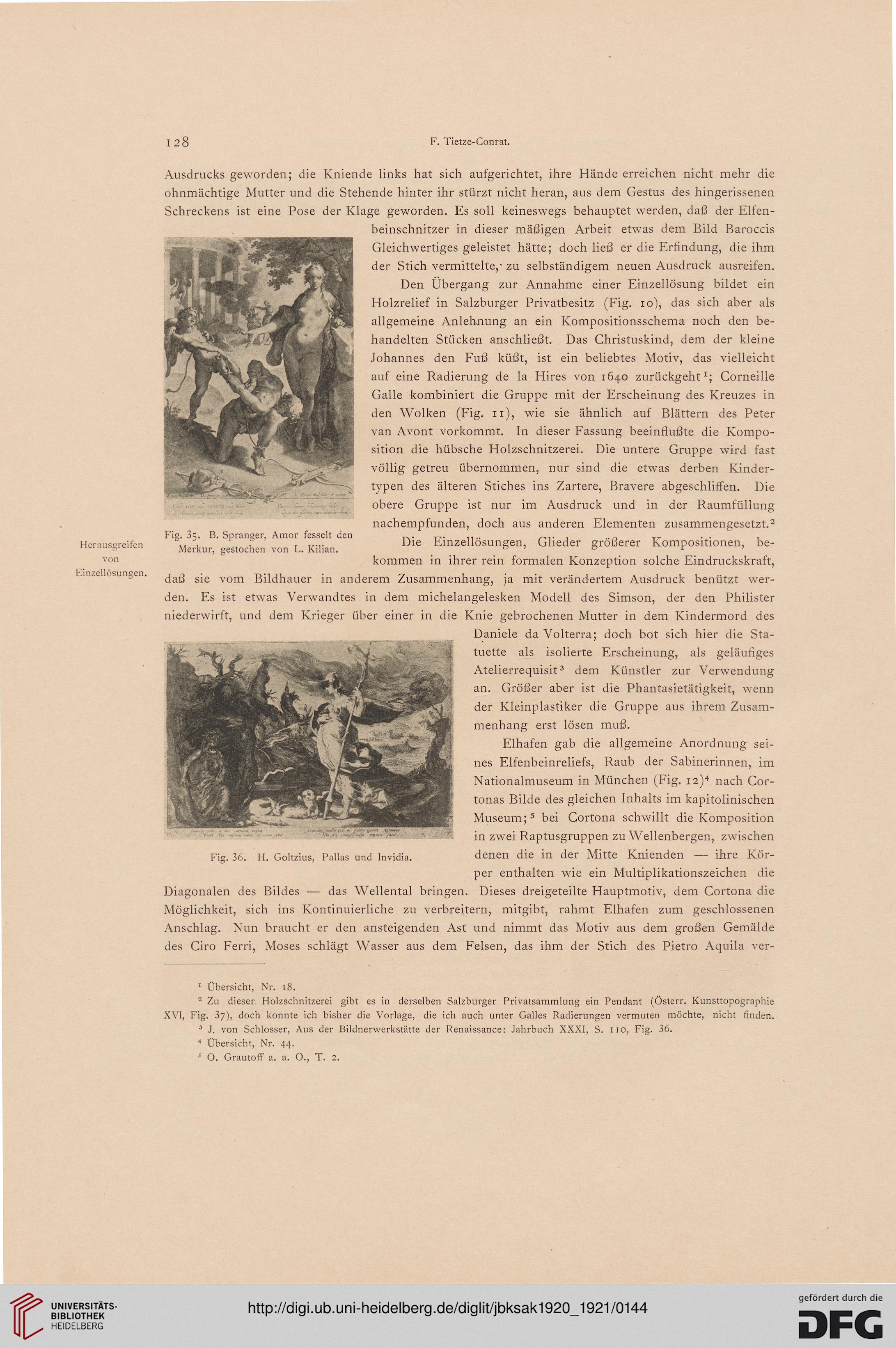128
F. Tietze-Conrat.
I lerausgreifen
von
Finzellösungen.
Fig. 3;. B. Spranger, Amor fesselt den
Merkur, gestochen von L. Kilian.
Ausdrucks geworden; die Kniende links hat sich aufgerichtet, ihre Hände erreichen nicht mehr die
ohnmächtige Mutter und die Stehende hinter ihr stürzt nicht heran, aus dem Gestus des hingerissenen
Schreckens ist eine Pose der Klage geworden. Es soll keineswegs behauptet werden, daß der Elfen-
beinschnitzer in dieser mäßigen Arbeit etwas dem Bild Baroccis
Gleichwertiges geleistet hätte; doch ließ er die Erfindung, die ihm
der Stich vermittelte,- zu selbständigem neuen Ausdruck ausreifen.
Den Ubergang zur Annahme einer Einzellösung bildet ein
Holzrelief in Salzburger Privatbesitz (Fig. io\ das sich aber als
allgemeine Anlehnung an ein Kompositionsschema noch den be-
handelten Stücken anschließt. Das Christuskind, dem der kleine
Johannes den Fuß küßt, ist ein beliebtes Motiv, das vielleicht
auf eine Radierung de la Hires von 1640 zurückgeht1; Corneille
Galle kombiniert die Gruppe mit der Erscheinung des Kreuzes in
den Wolken (Fig. 11), wie sie ähnlich auf Blättern des Peter
van Avont vorkommt. In dieser Fassung beeinflußte die Kompo-
sition die hübsche Holzschnitzerei. Die untere Gruppe wird fast
völlig getreu übernommen, nur sind die etwas derben Kinder-
typen des älteren Stiches ins Zartere, Bravere abgeschliffen. Die
obere Gruppe ist nur im Ausdruck und in der Raumfüllung
nachempfunden, doch aus anderen Elementen zusammengesetzt.2
Die Einzellösungen, Glieder größerer Kompositionen, be-
kommen in ihrer rein formalen Konzeption solche Eindruckskraft,
daß sie vom Bildhauer in anderem Zusammenhang, ja mit verändertem Ausdruck benützt wer-
den. Es ist etwas Verwandtes in dem michelangelesken Modell des Simson, der den Philister
niederwirft, und dem Krieger über einer in die Knie gebrochenen Mutter in dem Kindermord des
Daniele da Volterra; doch bot sich hier die Sta-
tuette als isolierte Erscheinung, als geläufiges
Atelierrequisit3 dem Künstler zur Verwendung
an. Größer aber ist die Phantasietätigkeit, wenn
der Kleinplastiker die Gruppe aus ihrem Zusam-
menhang erst lösen muß.
Elhafen gab die allgemeine Anordnung sei-
nes Elfenbeinreliefs, Raub der Sabinerinnen, im
Nationalmuseum in München (Fig. 12)4 nach Cor-
tonas Bilde des gleichen Inhalts im kapitolinischen
Museum;5 bei Cortona schwillt die Komposition
in zwei Raptusgruppen zu Wellenbergen, zwischen
denen die in der Mitte Knienden — ihre Kör-
per enthalten wie ein Multiplikationszeichen die
Diagonalen des Bildes — das Wellental bringen. Dieses dreigeteilte Hauptmotiv, dem Cortona die
Möglichkeit, sich ins Kontinuierliche zu verbreitern, mitgibt, rahmt Elhafen zum geschlossenen
Anschlag. Nun braucht er den ansteigenden Ast und nimmt das Motiv aus dem großen Gemälde
des Ciro Ferri, Moses schlägt Wasser aus dem Felsen, das ihm der Stich des Pietro Aquila ver-
Fig. 36. H. Goltzius, Pallas und Invidia.
1 Übersicht, Nr. 18.
2 Zu dieser Holzschnitzerei gibt es in derselben Salzburger Privatsammlung ein Pendant (Österr. Kunsttopographie
XVI, Fig. 37), doch konnte ich bisher die Vorlage, die ich auch unter Galles Radierungen vermuten möchte, nicht finden.
3 J. von Schlosser, Aus der Bildnerwerkstätte der Renaissance: Jahrbuch XXXI, S. 110, Fig. 36.
4 Obersicht, Nr. 44.
5 O. Grautoff a. a. O., T. 2.
F. Tietze-Conrat.
I lerausgreifen
von
Finzellösungen.
Fig. 3;. B. Spranger, Amor fesselt den
Merkur, gestochen von L. Kilian.
Ausdrucks geworden; die Kniende links hat sich aufgerichtet, ihre Hände erreichen nicht mehr die
ohnmächtige Mutter und die Stehende hinter ihr stürzt nicht heran, aus dem Gestus des hingerissenen
Schreckens ist eine Pose der Klage geworden. Es soll keineswegs behauptet werden, daß der Elfen-
beinschnitzer in dieser mäßigen Arbeit etwas dem Bild Baroccis
Gleichwertiges geleistet hätte; doch ließ er die Erfindung, die ihm
der Stich vermittelte,- zu selbständigem neuen Ausdruck ausreifen.
Den Ubergang zur Annahme einer Einzellösung bildet ein
Holzrelief in Salzburger Privatbesitz (Fig. io\ das sich aber als
allgemeine Anlehnung an ein Kompositionsschema noch den be-
handelten Stücken anschließt. Das Christuskind, dem der kleine
Johannes den Fuß küßt, ist ein beliebtes Motiv, das vielleicht
auf eine Radierung de la Hires von 1640 zurückgeht1; Corneille
Galle kombiniert die Gruppe mit der Erscheinung des Kreuzes in
den Wolken (Fig. 11), wie sie ähnlich auf Blättern des Peter
van Avont vorkommt. In dieser Fassung beeinflußte die Kompo-
sition die hübsche Holzschnitzerei. Die untere Gruppe wird fast
völlig getreu übernommen, nur sind die etwas derben Kinder-
typen des älteren Stiches ins Zartere, Bravere abgeschliffen. Die
obere Gruppe ist nur im Ausdruck und in der Raumfüllung
nachempfunden, doch aus anderen Elementen zusammengesetzt.2
Die Einzellösungen, Glieder größerer Kompositionen, be-
kommen in ihrer rein formalen Konzeption solche Eindruckskraft,
daß sie vom Bildhauer in anderem Zusammenhang, ja mit verändertem Ausdruck benützt wer-
den. Es ist etwas Verwandtes in dem michelangelesken Modell des Simson, der den Philister
niederwirft, und dem Krieger über einer in die Knie gebrochenen Mutter in dem Kindermord des
Daniele da Volterra; doch bot sich hier die Sta-
tuette als isolierte Erscheinung, als geläufiges
Atelierrequisit3 dem Künstler zur Verwendung
an. Größer aber ist die Phantasietätigkeit, wenn
der Kleinplastiker die Gruppe aus ihrem Zusam-
menhang erst lösen muß.
Elhafen gab die allgemeine Anordnung sei-
nes Elfenbeinreliefs, Raub der Sabinerinnen, im
Nationalmuseum in München (Fig. 12)4 nach Cor-
tonas Bilde des gleichen Inhalts im kapitolinischen
Museum;5 bei Cortona schwillt die Komposition
in zwei Raptusgruppen zu Wellenbergen, zwischen
denen die in der Mitte Knienden — ihre Kör-
per enthalten wie ein Multiplikationszeichen die
Diagonalen des Bildes — das Wellental bringen. Dieses dreigeteilte Hauptmotiv, dem Cortona die
Möglichkeit, sich ins Kontinuierliche zu verbreitern, mitgibt, rahmt Elhafen zum geschlossenen
Anschlag. Nun braucht er den ansteigenden Ast und nimmt das Motiv aus dem großen Gemälde
des Ciro Ferri, Moses schlägt Wasser aus dem Felsen, das ihm der Stich des Pietro Aquila ver-
Fig. 36. H. Goltzius, Pallas und Invidia.
1 Übersicht, Nr. 18.
2 Zu dieser Holzschnitzerei gibt es in derselben Salzburger Privatsammlung ein Pendant (Österr. Kunsttopographie
XVI, Fig. 37), doch konnte ich bisher die Vorlage, die ich auch unter Galles Radierungen vermuten möchte, nicht finden.
3 J. von Schlosser, Aus der Bildnerwerkstätte der Renaissance: Jahrbuch XXXI, S. 110, Fig. 36.
4 Obersicht, Nr. 44.
5 O. Grautoff a. a. O., T. 2.