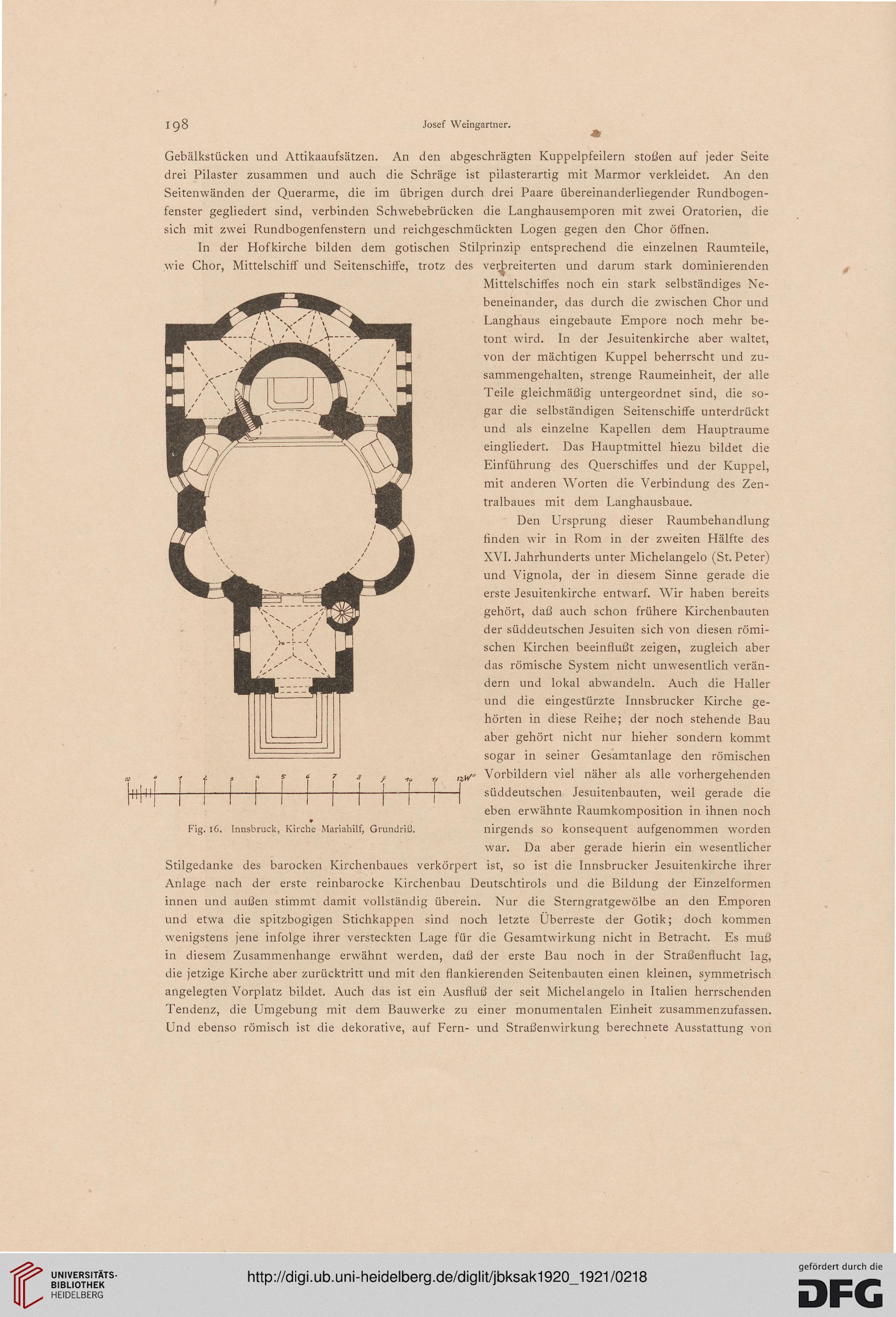»
IQ8 Josef Weingartner.
Gebälkstücken und Attikaaufsätzen. An den abgeschrägten Kuppelpfeilern stoßen auf jeder Seite
drei Pilaster zusammen und auch die Schräge ist pilasterartig mit Marmor verkleidet. An den
Seitenwänden der Querarme, die im übrigen durch drei Paare übereinanderliegender Rundbogen-
fenster gegliedert sind, verbinden Schwebebrücken die Langhausemporen mit zwei Oratorien, die
sich mit zwei Rundbogenfenstern und reichgeschmückten Logen gegen den Chor öffnen.
In der Hofkirche bilden dem gotischen Stilprinzip entsprechend die einzelnen Raumteile,
wie Chor, Mittelschiff und Seitenschiffe, trotz des verbreiterten und darum stark dominierenden
Mittelschiffes noch ein stark selbständiges Ne-
beneinander, das durch die zwischen Chor und
Langhaus eingebaute Empore noch mehr be-
tont wird. In der Jesuitenkirche aber waltet,
von der mächtigen Kuppel beherrscht und zu-
sammengehalten, strenge Raumeinheit, der alle
Teile gleichmäßig untergeordnet sind, die so-
gar die selbständigen Seitenschiffe unterdrückt
und als einzelne Kapellen dem Hauptraume
eingliedert. Das Hauptmittel hiezu bildet die
Einführung des Querschiffes und der Kuppel,
mit anderen Worten die Verbindung des Zen-
tralbaues mit dem Langhausbaue.
Den Ursprung dieser Raumbehandlung
finden wir in Rom in der zweiten Hälfte des
XVI. Jahrhunderts unter Michelangelo (St. Peter)
und Vignola, der in diesem Sinne gerade die
erste Jesuitenkirche entwarf. Wir haben bereits
gehört, daß auch schon frühere Kirchenbauten
der süddeutschen Jesuiten sich von diesen römi-
schen Kirchen beeinflußt zeigen, zugleich aber
das römische System nicht unwesentlich verän-
dern und lokal abwandeln. Auch die Haller
und die eingestürzte Innsbrucker Kirche ge-
hörten in diese Reihe; der noch stehende Bau
aber gehört nicht nur hieher sondern kommt
sogar in seiner Gesamtanlage den römischen
*if»r'T*-/i,* nW Vorbildern viel näher als alle vorhergehenden
—|-j——|----j-1-1-1-1-1 süddeutschen Jesuitenbauten, weil gerade die
eben erwähnte Raumkomposition in ihnen noch
Fig. 16. Innsbruck, Kirche Mariahilf, Grundriß. nirgends so konsequent aufgenommen worden
war. Da aber gerade hierin ein wesentlicher
Stilgedanke des barocken Kirchenbaues verkörpert ist, so ist die Innsbrucker Jesuitenkirche ihrer
Anlage nach der erste reinbarocke Kirchenbau Deutschtirols und die Bildung der Einzelformen
innen und außen stimmt damit vollständig überein. Nur die Sterngratgewölbe an den Emporen
und etwa die spitzbogigen Stichkappen sind noch letzte Uberreste der Gotik; doch kommen
wenigstens jene infolge ihrer versteckten Lage für die Gesamtwirkung nicht in Betracht. Es muß
in diesem Zusammenhange erwähnt werden, daß der erste Bau noch in der Straßenflucht lag,
die jetzige Kirche aber zurücktritt und mit den flankierenden Seitenbauten einen kleinen, symmetrisch
angelegten Vorplatz bildet. Auch das ist ein Ausfluß der seit Michelangelo in Italien herrschenden
Tendenz, die Umgebung mit dem Bauwerke zu einer monumentalen Einheit zusammenzufassen.
Und ebenso römisch ist die dekorative, auf Fern- und Straßenwirkung berechnete Ausstattung von
IQ8 Josef Weingartner.
Gebälkstücken und Attikaaufsätzen. An den abgeschrägten Kuppelpfeilern stoßen auf jeder Seite
drei Pilaster zusammen und auch die Schräge ist pilasterartig mit Marmor verkleidet. An den
Seitenwänden der Querarme, die im übrigen durch drei Paare übereinanderliegender Rundbogen-
fenster gegliedert sind, verbinden Schwebebrücken die Langhausemporen mit zwei Oratorien, die
sich mit zwei Rundbogenfenstern und reichgeschmückten Logen gegen den Chor öffnen.
In der Hofkirche bilden dem gotischen Stilprinzip entsprechend die einzelnen Raumteile,
wie Chor, Mittelschiff und Seitenschiffe, trotz des verbreiterten und darum stark dominierenden
Mittelschiffes noch ein stark selbständiges Ne-
beneinander, das durch die zwischen Chor und
Langhaus eingebaute Empore noch mehr be-
tont wird. In der Jesuitenkirche aber waltet,
von der mächtigen Kuppel beherrscht und zu-
sammengehalten, strenge Raumeinheit, der alle
Teile gleichmäßig untergeordnet sind, die so-
gar die selbständigen Seitenschiffe unterdrückt
und als einzelne Kapellen dem Hauptraume
eingliedert. Das Hauptmittel hiezu bildet die
Einführung des Querschiffes und der Kuppel,
mit anderen Worten die Verbindung des Zen-
tralbaues mit dem Langhausbaue.
Den Ursprung dieser Raumbehandlung
finden wir in Rom in der zweiten Hälfte des
XVI. Jahrhunderts unter Michelangelo (St. Peter)
und Vignola, der in diesem Sinne gerade die
erste Jesuitenkirche entwarf. Wir haben bereits
gehört, daß auch schon frühere Kirchenbauten
der süddeutschen Jesuiten sich von diesen römi-
schen Kirchen beeinflußt zeigen, zugleich aber
das römische System nicht unwesentlich verän-
dern und lokal abwandeln. Auch die Haller
und die eingestürzte Innsbrucker Kirche ge-
hörten in diese Reihe; der noch stehende Bau
aber gehört nicht nur hieher sondern kommt
sogar in seiner Gesamtanlage den römischen
*if»r'T*-/i,* nW Vorbildern viel näher als alle vorhergehenden
—|-j——|----j-1-1-1-1-1 süddeutschen Jesuitenbauten, weil gerade die
eben erwähnte Raumkomposition in ihnen noch
Fig. 16. Innsbruck, Kirche Mariahilf, Grundriß. nirgends so konsequent aufgenommen worden
war. Da aber gerade hierin ein wesentlicher
Stilgedanke des barocken Kirchenbaues verkörpert ist, so ist die Innsbrucker Jesuitenkirche ihrer
Anlage nach der erste reinbarocke Kirchenbau Deutschtirols und die Bildung der Einzelformen
innen und außen stimmt damit vollständig überein. Nur die Sterngratgewölbe an den Emporen
und etwa die spitzbogigen Stichkappen sind noch letzte Uberreste der Gotik; doch kommen
wenigstens jene infolge ihrer versteckten Lage für die Gesamtwirkung nicht in Betracht. Es muß
in diesem Zusammenhange erwähnt werden, daß der erste Bau noch in der Straßenflucht lag,
die jetzige Kirche aber zurücktritt und mit den flankierenden Seitenbauten einen kleinen, symmetrisch
angelegten Vorplatz bildet. Auch das ist ein Ausfluß der seit Michelangelo in Italien herrschenden
Tendenz, die Umgebung mit dem Bauwerke zu einer monumentalen Einheit zusammenzufassen.
Und ebenso römisch ist die dekorative, auf Fern- und Straßenwirkung berechnete Ausstattung von