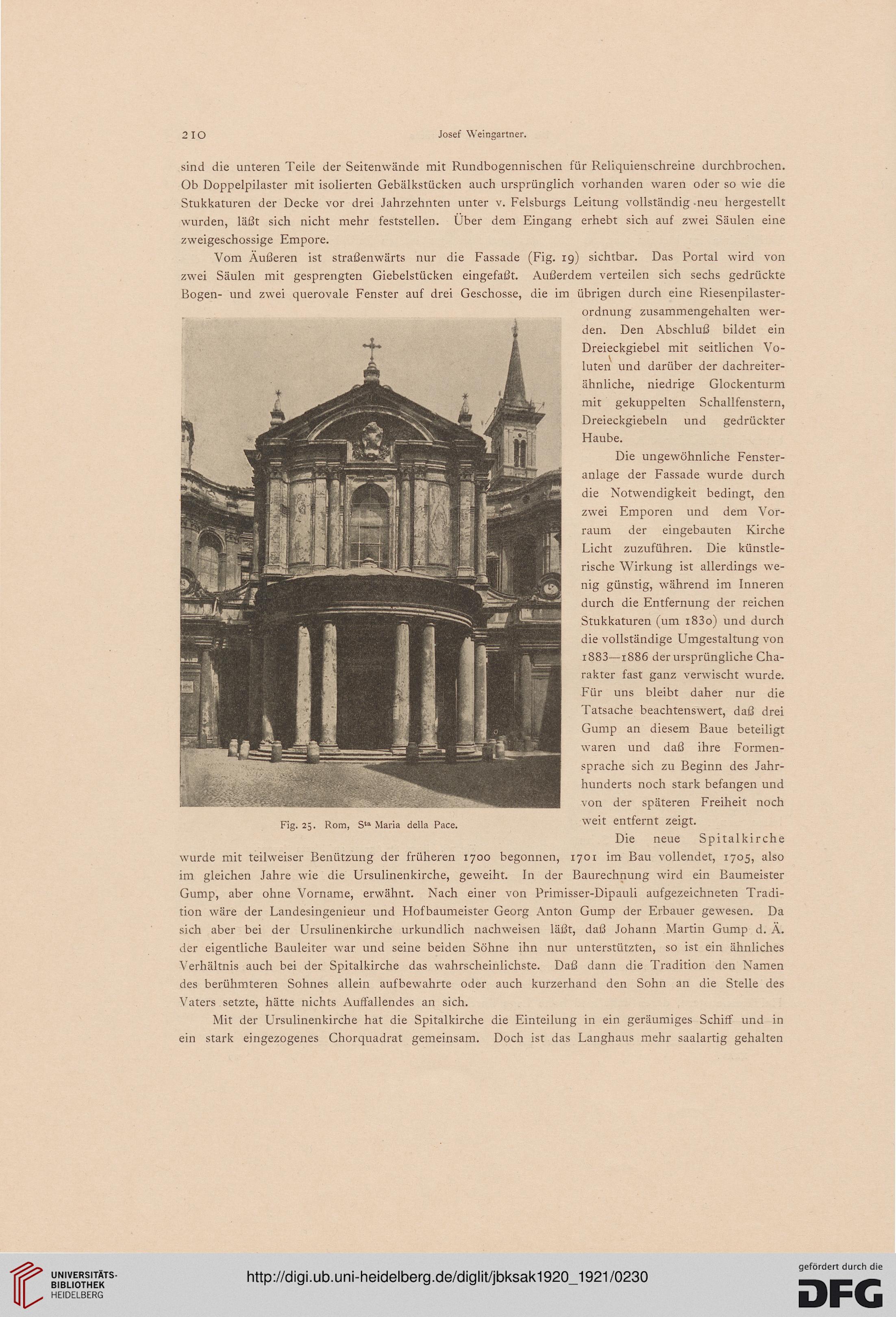2 IO
Josef Weingartner.
sind die unteren Teile der Seitenwände mit Rundbogennischen für Reliquienschreine durchbrochen.
Ob Doppelpilaster mit isolierten Gebälkstücken auch ursprünglich vorhanden waren oder so wie die
Stukkaturen der Decke vor drei Jahrzehnten unter v. Felsburgs Leitung vollständig -neu hergestellt
wurden, läßt sich nicht mehr feststellen. Über dem Eingang erhebt sich auf zwei Säulen eine
zweigeschossige Empore.
Vom Äußeren ist straßenwärts nur die Fassade (Fig. 19) sichtbar. Das Portal wird von
zwei Säulen mit gesprengten Giebelstücken eingefaßt. Außerdem verteilen sich sechs gedrückte
Bogen- und zwei querovale Fenster auf drei Geschosse, die im übrigen durch eine Riesenpilaster-
ordnung zusammengehalten wer-
den. Den Abschluß bildet ein
Dreieckgiebel mit seitlichen Vo-
luten und darüber der dachreiter-
ähnliche, niedrige Glockenturm
mit gekuppelten Schallfenstern,
Dreieckgiebeln und gedrückter
Haube.
Die ungewöhnliche Fenster-
anlage der Fassade wurde durch
die Notwendigkeit bedingt, den
zwei Emporen und dem Vor-
raum der eingebauten Kirche
Licht zuzuführen. Die künstle-
rische Wirkung ist allerdings we-
nig günstig, während im Inneren
durch die Entfernung der reichen
Stukkaturen (um i83o) und durch
die vollständige Umgestaltung von
i883—1886 der ursprüngliche Cha-
rakter fast ganz verwischt wurde.
Für uns bleibt daher nur die
Tatsache beachtenswert, daß drei
Gump an diesem Baue beteiligt
waren und daß ihre Formen-
sprache sich zu Beginn des Jahr-
hunderts noch stark befangen und
von der späteren Freiheit noch
weit entfernt zeigt.
Die neue Spitalkirche
wurde mit teilweiser Benützung der früheren 1700 begonnen, 1701 im Bau vollendet, 1705, also
im gleichen Jahre wie die Ursulinenkirche, geweiht. In der Baurechnung wird ein Baumeister
Gump, aber ohne Vorname, erwähnt. Nach einer von Primisser-Dipauli aufgezeichneten Tradi-
tion wäre der Landesingenieur und Hofbaumeister Georg Anton Gump der Erbauer gewesen. Da
sich aber bei der Ursulinenkirche urkundlich nachweisen läßt, daß Johann Martin Gump d. Ä.
der eigentliche Bauleiter war und seine beiden Söhne ihn nur unterstützten, so ist ein ähnliches
Verhältnis auch bei der Spitalkirche das wahrscheinlichste. Daß dann die Tradition den Namen
des berühmteren Sohnes allein aufbewahrte oder auch kurzerhand den Sohn an die Stelle des
Vaters setzte, hätte nichts Auffallendes an sich.
Mit der Ursulinenkirche hat die Spitalkirche die Einteilung in ein geräumiges Schiff und in
ein stark eingezogenes Chorquadrat gemeinsam. Doch ist das Langhaus mehr saalartig gehalten
Josef Weingartner.
sind die unteren Teile der Seitenwände mit Rundbogennischen für Reliquienschreine durchbrochen.
Ob Doppelpilaster mit isolierten Gebälkstücken auch ursprünglich vorhanden waren oder so wie die
Stukkaturen der Decke vor drei Jahrzehnten unter v. Felsburgs Leitung vollständig -neu hergestellt
wurden, läßt sich nicht mehr feststellen. Über dem Eingang erhebt sich auf zwei Säulen eine
zweigeschossige Empore.
Vom Äußeren ist straßenwärts nur die Fassade (Fig. 19) sichtbar. Das Portal wird von
zwei Säulen mit gesprengten Giebelstücken eingefaßt. Außerdem verteilen sich sechs gedrückte
Bogen- und zwei querovale Fenster auf drei Geschosse, die im übrigen durch eine Riesenpilaster-
ordnung zusammengehalten wer-
den. Den Abschluß bildet ein
Dreieckgiebel mit seitlichen Vo-
luten und darüber der dachreiter-
ähnliche, niedrige Glockenturm
mit gekuppelten Schallfenstern,
Dreieckgiebeln und gedrückter
Haube.
Die ungewöhnliche Fenster-
anlage der Fassade wurde durch
die Notwendigkeit bedingt, den
zwei Emporen und dem Vor-
raum der eingebauten Kirche
Licht zuzuführen. Die künstle-
rische Wirkung ist allerdings we-
nig günstig, während im Inneren
durch die Entfernung der reichen
Stukkaturen (um i83o) und durch
die vollständige Umgestaltung von
i883—1886 der ursprüngliche Cha-
rakter fast ganz verwischt wurde.
Für uns bleibt daher nur die
Tatsache beachtenswert, daß drei
Gump an diesem Baue beteiligt
waren und daß ihre Formen-
sprache sich zu Beginn des Jahr-
hunderts noch stark befangen und
von der späteren Freiheit noch
weit entfernt zeigt.
Die neue Spitalkirche
wurde mit teilweiser Benützung der früheren 1700 begonnen, 1701 im Bau vollendet, 1705, also
im gleichen Jahre wie die Ursulinenkirche, geweiht. In der Baurechnung wird ein Baumeister
Gump, aber ohne Vorname, erwähnt. Nach einer von Primisser-Dipauli aufgezeichneten Tradi-
tion wäre der Landesingenieur und Hofbaumeister Georg Anton Gump der Erbauer gewesen. Da
sich aber bei der Ursulinenkirche urkundlich nachweisen läßt, daß Johann Martin Gump d. Ä.
der eigentliche Bauleiter war und seine beiden Söhne ihn nur unterstützten, so ist ein ähnliches
Verhältnis auch bei der Spitalkirche das wahrscheinlichste. Daß dann die Tradition den Namen
des berühmteren Sohnes allein aufbewahrte oder auch kurzerhand den Sohn an die Stelle des
Vaters setzte, hätte nichts Auffallendes an sich.
Mit der Ursulinenkirche hat die Spitalkirche die Einteilung in ein geräumiges Schiff und in
ein stark eingezogenes Chorquadrat gemeinsam. Doch ist das Langhaus mehr saalartig gehalten