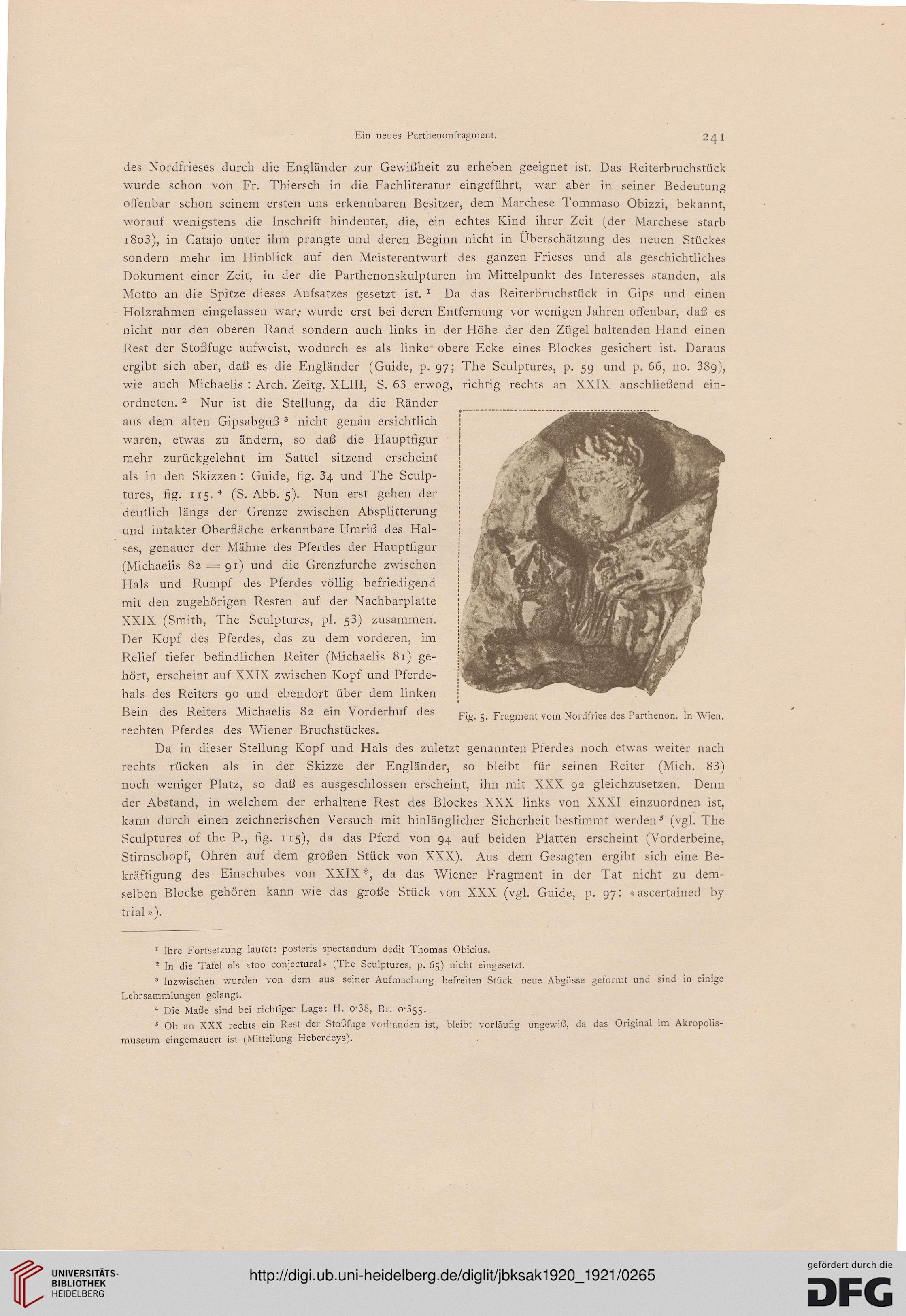Ein neues Parthenonfragment.
24I
des Nordfrieses durch die Engländer zur Gewißheit zu erheben geeignet ist. Das Reiterbruchstück
wurde schon von Fr. Thiersch in die Fachliteratur eingeführt, war aber in seiner Bedeutung
offenbar schon seinem ersten uns erkennbaren Besitzer, dem Marchese Tommaso Obizzi, bekannt,
worauf wenigstens die Inschrift hindeutet, die, ein echtes Kind ihrer Zeit (der Marchese starb
i8o3), in Catajo unter ihm prangte und deren Beginn nicht in Überschätzung des neuen Stückes
sondern mehr im Hinblick auf den Meisterentwurf des ganzen Frieses und als geschichtliches
Dokument einer Zeit, in der die Parthenonskulpturen im Mittelpunkt des Interesses standen, als
Motto an die Spitze dieses Aufsatzes gesetzt ist. 1 Da das Reiterbruchstück in Gips und einen
Holzrahmen eingelassen war,- wurde erst bei deren Entfernung vor wenigen Jahren offenbar, daß es
nicht nur den oberen Rand sondern auch links in der Höhe der den Zügel haltenden Hand einen
Rest der Stoßfuge aufweist, wodurch es als linke obere Ecke eines Blockes gesichert ist. Daraus
ergibt sich aber, daß es die Engländer (Guide, p. 97; The Sculptures, p. 59 und p. 66, no. 38g),
wie auch Michaelis : Arch. Zeitg. XLIII, S. 63 erwog, richtig rechts an XXIX anschließend ein-
ordneten. 2 Nur ist die Stellung, da die Ränder
aus dem alten Gipsabguß 3 nicht genau ersichtlich
waren, etwas zu ändern, so daß die Hauptfigur
mehr zurückgelehnt im Sattel sitzend erscheint
als in den Skizzen : Guide, fig. 34 und The Sculp-
tures, fig. 115. 4 (S. Abb. 5). Nun erst gehen der
deutlich längs der Grenze zwischen Absplitterung
und intakter Oberfläche erkennbare Umriß des Hal-
ses, genauer der Mähne des Pferdes der Hauptfigur
(Michaelis 82 =91) und die Grenzfurche zwischen
Hals und Rumpf des Pferdes völlig befriedigend
mit den zugehörigen Resten auf der Nachbarplatte
XXIX (Smith, The Sculptures, pl. 53) zusammen.
Der Kopf des Pferdes, das zu dem vorderen, im
Relief tiefer befindlichen Reiter (Michaelis 81) ge-
hört, erscheint auf XXIX zwischen Kopf und Pferde-
hals des Reiters 90 und ebendort über dem linken
Bein des Reiters Michaelis 82 ein Vorderhuf des Hg_ Fragment vora Nordfr-res des Parthenon. In Wien,
rechten Pferdes des Wiener Bruchstückes.
Da in dieser Stellung Kopf und Hals des zuletzt genannten Pferdes noch etwas weiter nach
rechts rücken als in der Skizze der Engländer, so bleibt für seinen Reiter (Mich. 83)
noch weniger Platz, so daß es ausgeschlossen erscheint, ihn mit XXX 92 gleichzusetzen. Denn
der Abstand, in welchem der erhaltene Rest des Blockes XXX links von XXXI einzuordnen ist,
kann durch einen zeichnerischen Versuch mit hinlänglicher Sicherheit bestimmt werden5 (vgl. The
Sculptures of the P., fig. 115), da das Pferd von 94 auf beiden Platten erscheint (Vorderbeine,
Stirnschopf, Ohren auf dem großen Stück von XXX). Aus dem Gesagten ergibt sich eine Be-
kräftigung des Einschubes von XXIX*, da das Wiener Fragment in der Tat nicht zu dem-
selben Blocke gehören kann wie das große Stück von XXX (vgl. Guide, p. 97: «ascertained by
trial»).
1 Ihre Fortsetzung lautet: posteris spectandum dedit Thomas Obicius.
2 In die Tafel als «too conjectural» (The Sculptures, p. 65) nicht eingesetzt.
3 Inzwischen wurden von dem aus seiner Aufmachung befreiten Stück neue Abgüsse geformt und sind in einige
Lehrsammlungen gelangt.
4 Die Maße sind bei richtiger Lage: H. 0-38, Br. 0-355.
5 Ob an XXX rechts ein Rest der Stoßfuge vorhanden ist, bleibt vorläufig ungewiß, da das Original im Akropolis-
museum eingemauert ist (Mitteilung Heberdeys).
24I
des Nordfrieses durch die Engländer zur Gewißheit zu erheben geeignet ist. Das Reiterbruchstück
wurde schon von Fr. Thiersch in die Fachliteratur eingeführt, war aber in seiner Bedeutung
offenbar schon seinem ersten uns erkennbaren Besitzer, dem Marchese Tommaso Obizzi, bekannt,
worauf wenigstens die Inschrift hindeutet, die, ein echtes Kind ihrer Zeit (der Marchese starb
i8o3), in Catajo unter ihm prangte und deren Beginn nicht in Überschätzung des neuen Stückes
sondern mehr im Hinblick auf den Meisterentwurf des ganzen Frieses und als geschichtliches
Dokument einer Zeit, in der die Parthenonskulpturen im Mittelpunkt des Interesses standen, als
Motto an die Spitze dieses Aufsatzes gesetzt ist. 1 Da das Reiterbruchstück in Gips und einen
Holzrahmen eingelassen war,- wurde erst bei deren Entfernung vor wenigen Jahren offenbar, daß es
nicht nur den oberen Rand sondern auch links in der Höhe der den Zügel haltenden Hand einen
Rest der Stoßfuge aufweist, wodurch es als linke obere Ecke eines Blockes gesichert ist. Daraus
ergibt sich aber, daß es die Engländer (Guide, p. 97; The Sculptures, p. 59 und p. 66, no. 38g),
wie auch Michaelis : Arch. Zeitg. XLIII, S. 63 erwog, richtig rechts an XXIX anschließend ein-
ordneten. 2 Nur ist die Stellung, da die Ränder
aus dem alten Gipsabguß 3 nicht genau ersichtlich
waren, etwas zu ändern, so daß die Hauptfigur
mehr zurückgelehnt im Sattel sitzend erscheint
als in den Skizzen : Guide, fig. 34 und The Sculp-
tures, fig. 115. 4 (S. Abb. 5). Nun erst gehen der
deutlich längs der Grenze zwischen Absplitterung
und intakter Oberfläche erkennbare Umriß des Hal-
ses, genauer der Mähne des Pferdes der Hauptfigur
(Michaelis 82 =91) und die Grenzfurche zwischen
Hals und Rumpf des Pferdes völlig befriedigend
mit den zugehörigen Resten auf der Nachbarplatte
XXIX (Smith, The Sculptures, pl. 53) zusammen.
Der Kopf des Pferdes, das zu dem vorderen, im
Relief tiefer befindlichen Reiter (Michaelis 81) ge-
hört, erscheint auf XXIX zwischen Kopf und Pferde-
hals des Reiters 90 und ebendort über dem linken
Bein des Reiters Michaelis 82 ein Vorderhuf des Hg_ Fragment vora Nordfr-res des Parthenon. In Wien,
rechten Pferdes des Wiener Bruchstückes.
Da in dieser Stellung Kopf und Hals des zuletzt genannten Pferdes noch etwas weiter nach
rechts rücken als in der Skizze der Engländer, so bleibt für seinen Reiter (Mich. 83)
noch weniger Platz, so daß es ausgeschlossen erscheint, ihn mit XXX 92 gleichzusetzen. Denn
der Abstand, in welchem der erhaltene Rest des Blockes XXX links von XXXI einzuordnen ist,
kann durch einen zeichnerischen Versuch mit hinlänglicher Sicherheit bestimmt werden5 (vgl. The
Sculptures of the P., fig. 115), da das Pferd von 94 auf beiden Platten erscheint (Vorderbeine,
Stirnschopf, Ohren auf dem großen Stück von XXX). Aus dem Gesagten ergibt sich eine Be-
kräftigung des Einschubes von XXIX*, da das Wiener Fragment in der Tat nicht zu dem-
selben Blocke gehören kann wie das große Stück von XXX (vgl. Guide, p. 97: «ascertained by
trial»).
1 Ihre Fortsetzung lautet: posteris spectandum dedit Thomas Obicius.
2 In die Tafel als «too conjectural» (The Sculptures, p. 65) nicht eingesetzt.
3 Inzwischen wurden von dem aus seiner Aufmachung befreiten Stück neue Abgüsse geformt und sind in einige
Lehrsammlungen gelangt.
4 Die Maße sind bei richtiger Lage: H. 0-38, Br. 0-355.
5 Ob an XXX rechts ein Rest der Stoßfuge vorhanden ist, bleibt vorläufig ungewiß, da das Original im Akropolis-
museum eingemauert ist (Mitteilung Heberdeys).