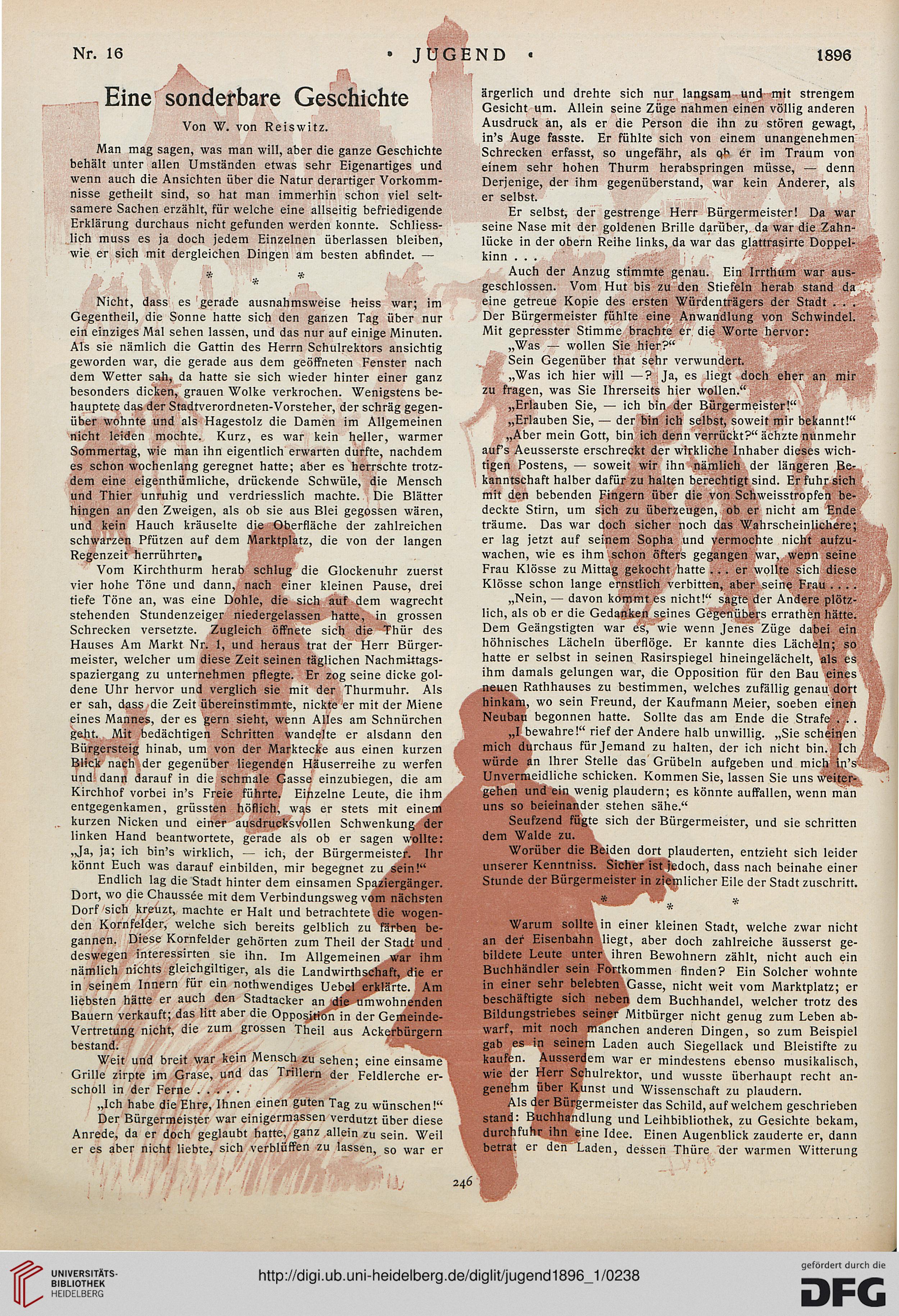Nr. 16
1896
• JUGEND '
Eine sonderbare Geschichte
Von W. von Reiswitz.
Man mag sagen, was man will, aber die ganze Geschichte
behält unter allen Umständen etwas sehr Eigenartiges und
wenn auch die Ansichten über die Natur derartiger Vorkomm-
nisse getheilt sind, so hat man immerhin schon viel selt-
samere Sachen erzählt, für welche eine allseitig befriedigende
Erklärung durchaus nicht gefunden werden konnte. Schliess-
lich muss es ja doch jedem Einzelnen überlassen bleiben,
wie er sich mit dergleichen Dingen am besten abfindet. —
Nicht, dass es gerade ausnahmsweise heiss war; im
Gegentheil, die Sonne hatte sich den ganzen Tag über nur
ein einziges Mal sehen lassen, und das nur auf einige Minuten.
Als sie nämlich die Gattin des Herrn Schulrektors ansichtig
geworden war, die gerade aus dem geöffneten Fenster nach
dem Wetter sah, da hatte sie sich wieder hinter einer ganz
besonders dicken, grauen Wolke verkrochen. Wenigstens be-
hauptete das der Stadtverordneten-Vorsteher, der schräg gegen-
über wohnte und als Hagestolz die Damen im Allgemeinen
nicht leiden mochte. Kurz, es war kein heller, warmer
Sommertag, wie man ihn eigentlich erwarten durfte, nachdem
es schon wochenlang geregnet hatte; aber es herrschte trotz-
dem eine eigenthümliche, drückende Schwüle, die Mensch
und Thier unruhig und verdriesslich machte. Die Blätter
hingen an den Zweigen, als ob sie aus Blei gegossen wären,
und kein Hauch kräuselte die Oberfläche der zahlreichen
schwarzen Pfützen auf dem Marktplatz, die von der langen
Regenzeit herrührten.
Vom Kirchthurm herab schlug die Glockenuhr zuerst
vier hohe Töne und dann, nach einer kleinen Pause, drei
tiefe Töne an, was eine Dohle, die sich auf dem wagrecht
stehenden Stundenzeiger niedergelassen hatte, in grossen
Schrecken versetzte. Zugleich öffnete sich die Thür des
Hauses Am Markt Nr. 1, und heraus trat der Herr Bürger-
meister, welcher um diese Zeit seinen täglichen Nachmittags-
spaziergang zu unternehmen pflegte. Er zog seine dicke gol-
dene Uhr hervor und verglich sie mit der Thurmuhr. Als
er sah, dass die Zeit übereinstimmte, nickte er mit der Miene
eines Mannes, der es gern sieht, wenn Alles am Schnürchen
geht. Mit bedächtigen Schritten wandelte er alsdann den
Bürgersteig hinab, um von der Marktecke aus einen kurzen
Blick nach der gegenüber liegenden Häuserreihe zu werfen
und dann darauf in die schmale Gasse einzubiegen, die am
Kirchhof vorbei in’s Freie führte. Einzelne Leute, die ihm
entgegenkamen, grüssten höflich, was er stets mit einem
kurzen Nicken und einer ausdrucksvollen Schwenkung der
linken Hand beantwortete, gerade als ob er sagen wollte:
„Ja, ja; ich bin’s wirklich, — ich, der Bürgermeister. Ihr
könnt Euch was darauf einbilden, mir begegnet zu sein!“
Endlich lag die Stadt hinter dem einsamen Spaziergänger.
Dort, wo die Chaussee mit dem Verbindungsweg vom nächsten
Dorf sich kreuzt, machte er Halt und betrachtete die wogen-
den Kornfelder, welche sich bereits gelblich zu färben be-
gannen. Diese Kornfelder gehörten zum Theil der Stadt und
deswegen interessirten sie ihn. Im Allgemeinen war ihm
nämlich nichts gleichgiltiger, als die Landwirthschaft, die er
in seinem Innern für ein nothwendiges Uebel erklärte. Am
liebsten hätte er auch den Stadtacker an die -ffinwohnenden
Bauern verkauft; das litt aber die Oppo^jtwn^in der Gemeinde-
vertretung nicht, die zum grossen Theil aus Ackerbürgern
bestand.
Weit und breit war kein Mensch zu sehen; eine einsame'
Grille zirpte im Grase, und das Trillern der Feldlerche er-
scholl in der Ferne.
„Ich habe die Ehre, Ihnen einen guten Tag zu wünschen!“
Der Bürgermeister war einigermassen verdutzt über diese
Anrede, da er doch geglaubt hatte, ganz allein zu sein. Weil
er es aber nicht liebte, sich verblüffen zu lassen, so war er
ärgerlich und drehte sich nur langsam und mit strengem
Gesicht um. Allein seine Züge nahmen einen völlig anderen
Ausdruck an, als er die Person die ihn zu stören gewagt,
in’s Auge fasste. Er fühlte sich von einem unangenehmen
Schrecken erfasst, so ungefähr, als qb 6r im Traum von
einem sehr hohen Thurm herabspringen müsse, — denn
Derjenige, der ihm gegenüberstand, war kein Anderer, als
er selbst.
Er selbst, der gestrenge Herr Bürgermeister! Da war
seine Nase mit der goldenen Brille darüber, da war die Zahn-
lücke in der obern Reihe links, da war das glattrasirte Doppel-
kinn . . tär
Auch der Anzug stimmte genau. Ein Irrthum war aus-
geschlossen. Vom Hut bis zu den Stiefeln herab stand da
eine getreue Kopie des ersten Würdenträgers der Stadt . . .
Der Bürgermeister fühlte eine Anwandlung von Schwindel.
Mit gepresster Stimme brachte er die Worte hervor:
„Was — wollen Sie hier?“
Sein Gegenüber that sehr verwundert.
„Was ich hier will —? Ja, es liegt doch eher an mir
zu fragen, was Sie Ihrerseits hier wollen.“
„Erlauben Sie, — ich bin der Bürgermeister!“
„Erlauben Sie, — der bin ich selbst, soweit mir bekannt!“
„Aber mein Gott, bin ich denn verrückt?“ ächzte nunmehr
auf’s Aeusserste erschreckt der wirkliche Inhaber dieses wich-
tigen Postens, — soweit wir ihn nämlich der längeren Be-
kanntschaft halber dafür zu halten berechtigt sind. Er fuhr sich
mit den bebenden Fingern über die von Schweisstropfen be-
deckte Stirn, um sich zu überzeugen, ob er nicht am Ende
träume. Das war doch sicher noch das Wahrscheinlichere;
er lag jetzt auf seinem Sopha und vermochte nicht aufzu-
wachen, wie es ihm schon öfters gegangen war, wenn seine
Frau Klösse zu Mittag gekocht hatte ,. . er wollte sich diese
Klösse schon lange ernstlich verbitten, aber seine Frau ....
„Nein, — davon kommt es nicht!“ sagte der Andere plötz-
lich, als ob er die Gedanken seines Gegenübers errathen hätte.
Dem Geängstigten war esf wie wenn Jenes Züge dabei ein
höhnisches Lächeln überflöge. Er kannte dies Lächeln; so
hatte er selbst in seinen Rasirspiegel hineingelächelt, als es
ihm damals gelungen war, die Opposition für den Bau eines
neuen Rathhauses zu bestimmen, welches zufällig genau dort
hinkam, wo sein Freund, der Kaufmann Meier, soeben einen
Neubau begonnen hatte. Sollte das am Ende die StrafeS® .
„I bewahre!“ rief der Andere halb unwillig. „Sie scheinen
mich durchaus für Jemand zu halten, der ich nicht bin. Jch
würde an Ihrer Stelle das Grübeln aufgeben und mich: in’s-
Unvermeidliche schicken. Kommen Sie, lassen Sie uns weiter-
gehen und ein wenig plaudern; es könnte auffallen, wenn man
uns so beieinander stehen sähe.“
Seufzend fügte sich der Bürgermeister, und sie schritten
dem Walde zu.
Worüber die Beiden dort plauderten, entzieht sich leider
unserer Kenntniss. Sicher ist jedoch, dass nach beinahe einer
Stunde der Bürgermeister in ziemlicher Eile der Stadt zuschritt.
*
Warum sollte in einer kleinen Stadt, welche zwar nicht
an der Eisenbahn liegt, aber doch zahlreiche äusserst ge-
bildete Leute unter ihren Bewohnern zählt, nicht auch ein
Buchhändler sein Fortkommen finden? Ein Solcher wohnte
in einer sehr belebten Gasse, nicht weit vom Marktplatz; er
beschäftigte sich neben dem Buchhandel, welcher trotz des
Bildungstriebes seiner Mitbürger nicht genug zum Leben ab-
warf, mit noch riianchen anderen Dingen, so zum Beispiel
gab es in seinem Laden auch Siegellack und Bleistifte zu
kaufen. Ausserdem war er mindestens ebenso musikalisch,
wie der Herr Schulrektor, und wusste überhaupt recht an-
genehm über Kunst und Wissenschaft zu plaudern.
T Als der Bürgermeister das Schild, auf welchem geschrieben
stand: Buchhandlung und Leihbibliothek, zu Gesichte bekam,
durchfuhr ihn eine Idee. Einen Augenblick zauderte er, dann
betrat er den Laden, dessen Thüre der warmen Witterung
246
1896
• JUGEND '
Eine sonderbare Geschichte
Von W. von Reiswitz.
Man mag sagen, was man will, aber die ganze Geschichte
behält unter allen Umständen etwas sehr Eigenartiges und
wenn auch die Ansichten über die Natur derartiger Vorkomm-
nisse getheilt sind, so hat man immerhin schon viel selt-
samere Sachen erzählt, für welche eine allseitig befriedigende
Erklärung durchaus nicht gefunden werden konnte. Schliess-
lich muss es ja doch jedem Einzelnen überlassen bleiben,
wie er sich mit dergleichen Dingen am besten abfindet. —
Nicht, dass es gerade ausnahmsweise heiss war; im
Gegentheil, die Sonne hatte sich den ganzen Tag über nur
ein einziges Mal sehen lassen, und das nur auf einige Minuten.
Als sie nämlich die Gattin des Herrn Schulrektors ansichtig
geworden war, die gerade aus dem geöffneten Fenster nach
dem Wetter sah, da hatte sie sich wieder hinter einer ganz
besonders dicken, grauen Wolke verkrochen. Wenigstens be-
hauptete das der Stadtverordneten-Vorsteher, der schräg gegen-
über wohnte und als Hagestolz die Damen im Allgemeinen
nicht leiden mochte. Kurz, es war kein heller, warmer
Sommertag, wie man ihn eigentlich erwarten durfte, nachdem
es schon wochenlang geregnet hatte; aber es herrschte trotz-
dem eine eigenthümliche, drückende Schwüle, die Mensch
und Thier unruhig und verdriesslich machte. Die Blätter
hingen an den Zweigen, als ob sie aus Blei gegossen wären,
und kein Hauch kräuselte die Oberfläche der zahlreichen
schwarzen Pfützen auf dem Marktplatz, die von der langen
Regenzeit herrührten.
Vom Kirchthurm herab schlug die Glockenuhr zuerst
vier hohe Töne und dann, nach einer kleinen Pause, drei
tiefe Töne an, was eine Dohle, die sich auf dem wagrecht
stehenden Stundenzeiger niedergelassen hatte, in grossen
Schrecken versetzte. Zugleich öffnete sich die Thür des
Hauses Am Markt Nr. 1, und heraus trat der Herr Bürger-
meister, welcher um diese Zeit seinen täglichen Nachmittags-
spaziergang zu unternehmen pflegte. Er zog seine dicke gol-
dene Uhr hervor und verglich sie mit der Thurmuhr. Als
er sah, dass die Zeit übereinstimmte, nickte er mit der Miene
eines Mannes, der es gern sieht, wenn Alles am Schnürchen
geht. Mit bedächtigen Schritten wandelte er alsdann den
Bürgersteig hinab, um von der Marktecke aus einen kurzen
Blick nach der gegenüber liegenden Häuserreihe zu werfen
und dann darauf in die schmale Gasse einzubiegen, die am
Kirchhof vorbei in’s Freie führte. Einzelne Leute, die ihm
entgegenkamen, grüssten höflich, was er stets mit einem
kurzen Nicken und einer ausdrucksvollen Schwenkung der
linken Hand beantwortete, gerade als ob er sagen wollte:
„Ja, ja; ich bin’s wirklich, — ich, der Bürgermeister. Ihr
könnt Euch was darauf einbilden, mir begegnet zu sein!“
Endlich lag die Stadt hinter dem einsamen Spaziergänger.
Dort, wo die Chaussee mit dem Verbindungsweg vom nächsten
Dorf sich kreuzt, machte er Halt und betrachtete die wogen-
den Kornfelder, welche sich bereits gelblich zu färben be-
gannen. Diese Kornfelder gehörten zum Theil der Stadt und
deswegen interessirten sie ihn. Im Allgemeinen war ihm
nämlich nichts gleichgiltiger, als die Landwirthschaft, die er
in seinem Innern für ein nothwendiges Uebel erklärte. Am
liebsten hätte er auch den Stadtacker an die -ffinwohnenden
Bauern verkauft; das litt aber die Oppo^jtwn^in der Gemeinde-
vertretung nicht, die zum grossen Theil aus Ackerbürgern
bestand.
Weit und breit war kein Mensch zu sehen; eine einsame'
Grille zirpte im Grase, und das Trillern der Feldlerche er-
scholl in der Ferne.
„Ich habe die Ehre, Ihnen einen guten Tag zu wünschen!“
Der Bürgermeister war einigermassen verdutzt über diese
Anrede, da er doch geglaubt hatte, ganz allein zu sein. Weil
er es aber nicht liebte, sich verblüffen zu lassen, so war er
ärgerlich und drehte sich nur langsam und mit strengem
Gesicht um. Allein seine Züge nahmen einen völlig anderen
Ausdruck an, als er die Person die ihn zu stören gewagt,
in’s Auge fasste. Er fühlte sich von einem unangenehmen
Schrecken erfasst, so ungefähr, als qb 6r im Traum von
einem sehr hohen Thurm herabspringen müsse, — denn
Derjenige, der ihm gegenüberstand, war kein Anderer, als
er selbst.
Er selbst, der gestrenge Herr Bürgermeister! Da war
seine Nase mit der goldenen Brille darüber, da war die Zahn-
lücke in der obern Reihe links, da war das glattrasirte Doppel-
kinn . . tär
Auch der Anzug stimmte genau. Ein Irrthum war aus-
geschlossen. Vom Hut bis zu den Stiefeln herab stand da
eine getreue Kopie des ersten Würdenträgers der Stadt . . .
Der Bürgermeister fühlte eine Anwandlung von Schwindel.
Mit gepresster Stimme brachte er die Worte hervor:
„Was — wollen Sie hier?“
Sein Gegenüber that sehr verwundert.
„Was ich hier will —? Ja, es liegt doch eher an mir
zu fragen, was Sie Ihrerseits hier wollen.“
„Erlauben Sie, — ich bin der Bürgermeister!“
„Erlauben Sie, — der bin ich selbst, soweit mir bekannt!“
„Aber mein Gott, bin ich denn verrückt?“ ächzte nunmehr
auf’s Aeusserste erschreckt der wirkliche Inhaber dieses wich-
tigen Postens, — soweit wir ihn nämlich der längeren Be-
kanntschaft halber dafür zu halten berechtigt sind. Er fuhr sich
mit den bebenden Fingern über die von Schweisstropfen be-
deckte Stirn, um sich zu überzeugen, ob er nicht am Ende
träume. Das war doch sicher noch das Wahrscheinlichere;
er lag jetzt auf seinem Sopha und vermochte nicht aufzu-
wachen, wie es ihm schon öfters gegangen war, wenn seine
Frau Klösse zu Mittag gekocht hatte ,. . er wollte sich diese
Klösse schon lange ernstlich verbitten, aber seine Frau ....
„Nein, — davon kommt es nicht!“ sagte der Andere plötz-
lich, als ob er die Gedanken seines Gegenübers errathen hätte.
Dem Geängstigten war esf wie wenn Jenes Züge dabei ein
höhnisches Lächeln überflöge. Er kannte dies Lächeln; so
hatte er selbst in seinen Rasirspiegel hineingelächelt, als es
ihm damals gelungen war, die Opposition für den Bau eines
neuen Rathhauses zu bestimmen, welches zufällig genau dort
hinkam, wo sein Freund, der Kaufmann Meier, soeben einen
Neubau begonnen hatte. Sollte das am Ende die StrafeS® .
„I bewahre!“ rief der Andere halb unwillig. „Sie scheinen
mich durchaus für Jemand zu halten, der ich nicht bin. Jch
würde an Ihrer Stelle das Grübeln aufgeben und mich: in’s-
Unvermeidliche schicken. Kommen Sie, lassen Sie uns weiter-
gehen und ein wenig plaudern; es könnte auffallen, wenn man
uns so beieinander stehen sähe.“
Seufzend fügte sich der Bürgermeister, und sie schritten
dem Walde zu.
Worüber die Beiden dort plauderten, entzieht sich leider
unserer Kenntniss. Sicher ist jedoch, dass nach beinahe einer
Stunde der Bürgermeister in ziemlicher Eile der Stadt zuschritt.
*
Warum sollte in einer kleinen Stadt, welche zwar nicht
an der Eisenbahn liegt, aber doch zahlreiche äusserst ge-
bildete Leute unter ihren Bewohnern zählt, nicht auch ein
Buchhändler sein Fortkommen finden? Ein Solcher wohnte
in einer sehr belebten Gasse, nicht weit vom Marktplatz; er
beschäftigte sich neben dem Buchhandel, welcher trotz des
Bildungstriebes seiner Mitbürger nicht genug zum Leben ab-
warf, mit noch riianchen anderen Dingen, so zum Beispiel
gab es in seinem Laden auch Siegellack und Bleistifte zu
kaufen. Ausserdem war er mindestens ebenso musikalisch,
wie der Herr Schulrektor, und wusste überhaupt recht an-
genehm über Kunst und Wissenschaft zu plaudern.
T Als der Bürgermeister das Schild, auf welchem geschrieben
stand: Buchhandlung und Leihbibliothek, zu Gesichte bekam,
durchfuhr ihn eine Idee. Einen Augenblick zauderte er, dann
betrat er den Laden, dessen Thüre der warmen Witterung
246