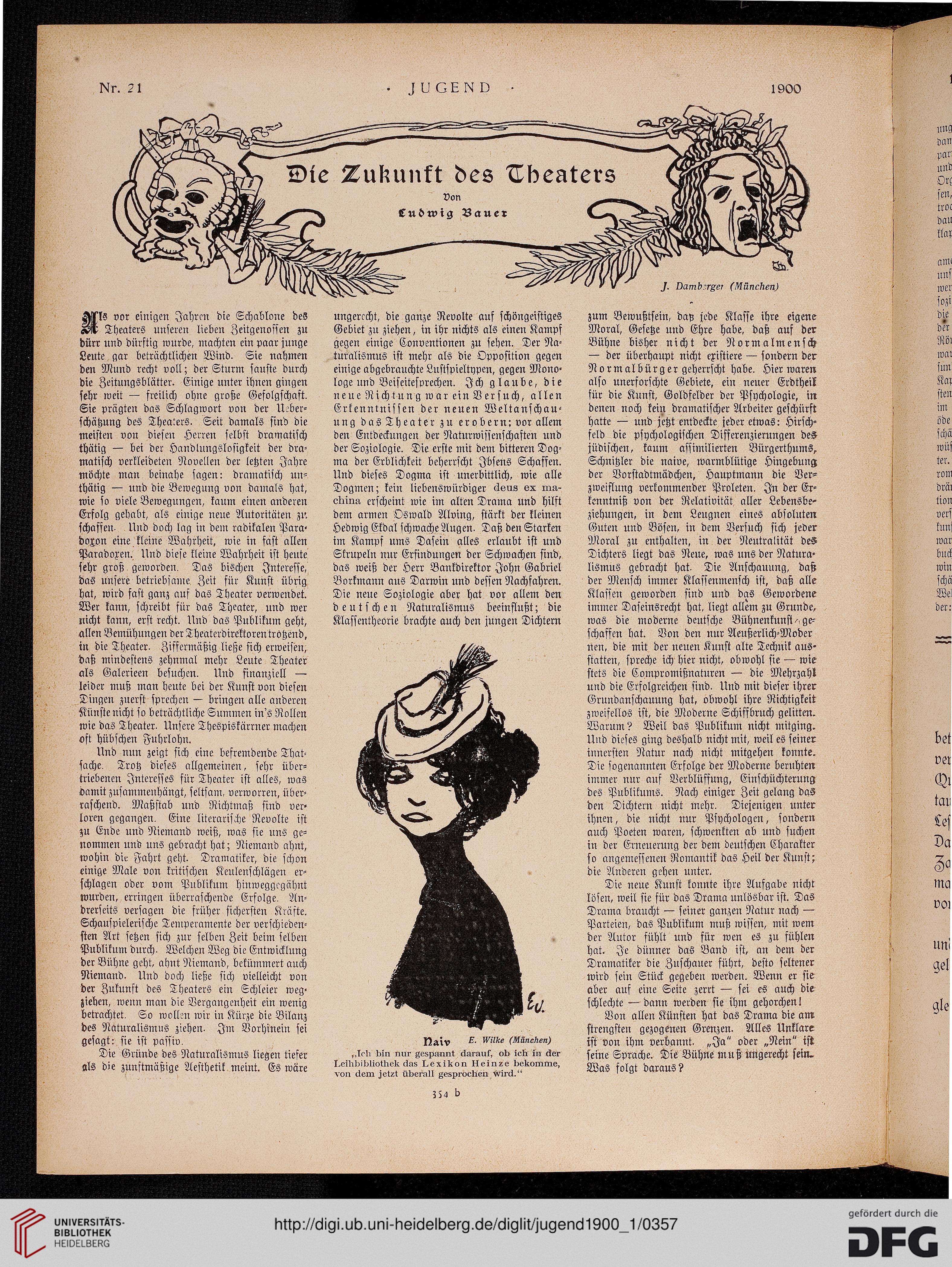Nr. 21
. JUGEND -
1900
J. Damb:rger (München)
Mls vor einigen Jahren die Schablone des
Theaters unseren lieben Zeitgenossen zu
dürr und dürftig wurde, machten ein paar junge
Leute gar beträchtlichen Wind. Sie nahmen
den Mund recht voll; der Sturm sauste durch
die Zeitungsblätter. Einige unter ihnen gingen
sehr weit — freilich ohne große Gefolgschaft.
Sie prägten das Schlagwort von der Über-
schätzung des Theaters. Seit damals sind die
meisten von diesen Herren selbst dramatisch
thätig — bei der Handlungslosigkeit der dra-
matisch verkleideten Novellen der letzten Jahre
möchte man beinahe sagen: dramatisch un-
Ihätig — und die Bewegung von damals hat,
wie so viele Bewegungen, kaum einen anderen
Erfolg gehabt, als einige neue Autoritäten zu
schaffen. Und doch lag in dem radikalen Para-
doxon eine kleine Wahrheit, wie in fast allen
Paradoxen. Und diese kleine Wahrheit ist heute
sehr groß geworden. Das bischen Interesse,
das unsere betriebsame Zeit für Kunst übrig
hat, wird fast ganz auf das Theater verwendet.
Wer kann, schreibt für das Theater, und wer
nicht kann, erst recht. Und das Publikum geht,
allen Bemühungen der Theaterdirektoren trotzend,
in die Theater. Ziffermäßig ließe sich erweisen,
daß mindestens zehnmal mehr Leute Theater
als Galerieen besuchen. Und finanziell —
leider muß man heute bei der Kunst von diesen
Dingen zuerst sprechen — bringen alle anderen
Künste nicht so beträchtliche Summen in's Rollen
wie das Theater. Unsere Thespiskärrner machen
oft hübschen Fuhrlohn.
Und nun zeigt sich eine befremdende That-
sache. Trotz dieses allgemeinen, sehr über-
triebenen Interesses für Theater ist alles, was
damit zusammenhängt, seltsam, verworren, über-
raschend. Maßstab und Richtmaß sind ver-
loren gegangen. Eine literarische Revolte ist
zu Ende und Niemand weiß, was sie uns ge-
nommen und uns gebracht hat; Niemand ahnt,
wohin die Fahrt geht. Dramatiker, die schon
einige Male von kritischen Keulenschlägen er-
schlagen oder vom Publikum hinweggegähnt
wurden, erringen überraschende Erfolge. An-
drerseits versagen die früher sichersten Kräfte.
Schauspielerische Temperamente der verschieden-
sten Art setzen sich zur selben Zeit beim selben
Publikum durch. Welchen Weg die Entwicklung
der Bühne geht, ahnt Niemand, bekümmert auch
Niemand. Und doch ließe sich vielleicht von
der Zukunft des Theaters ein Schleier weg-
ziehen, wenn man die Vergangenheit ein wenig
betrachtet. So wollen wir in Kürze die Bilanz
des Naturalismus ziehen. Im Vorhinein sei
gesagt: sie ist passiv.
Die Gründe des Naturalismus liegen tiefer
als die zunftmäßige Aesthetik meint. Es wäre
ungerecht, die ganze Revolte auf schöngeistiges
Gebiet zu ziehen, in ihr nichts als einen Kampf
gegen einige Conventionen zu sehen. Der Na-
turalismus ist mehr als die Opposition gegen
einige abgebrauchte Lustspieltypen, gegen Mono-
loge und Beiseitesprechen. Ich glaube, die
neue Richtung war ein Versuch, allen
Erkenntnissen der neuen Weltanschau-
ung das Theater zu erobern: vor allem
den Entdeckungen der Naturwissenschaften und
der Soziologie. Die erste mit dem bitteren Dog-
ma der Erblichkeit beherrscht Ibsens Schaffen.
Und dieses Dogma ist unerbittlich, wie alle
Dogmen; kein liebenswürdiger deus ex ma-
china erscheint wie im alten Drama und hilft
dem armen Oswald Alving, stärkt der kleinen
Hedwig Ekdal schwache Augen. Daß den Starken
im Kampf ums Dasein alles erlaubt ist und
Skrupeln nur Erfindungen der Schwachen sind,
das weiß der Herr Bankdirektor John Gabriel
Borkmann aus Darwin und dessen Nachfahren.
Die neue Soziologie aber hat vor allem den
deutschen Naturalismus beeinflußt; die
Klassentheorie brachte auch den jungen Dichtem
E. Wilke (München)
„Ich bin nur gespannt darauf, ob ich in der
Leihbibliothek das Lexikon Ileinze bekomme,
von dem jetzt überall gesprochen Wird.“
zum Bewußtsein, dap jede Klasse ihre eigene
Moral, Gesetze und Ehre habe, daß auf der
Bühne bisher nicht der Normalmensch
— der überhaupt nicht existiere — sondern der
Normalbürger geherrscht habe. Hier waren
also unerforschte Gebiete, ein neuer Erdtheik
für die Kunst, Goldfelder der Psychologie, in
denen noch kein dramatischer Arbeiter geschürft
hatte — und jetzt entdeckte jeder etwas: Hirsch-
feld die psychologischen Differenzierungen des
jüdischen, kaum assimilierten Bürgerthums,
Schnitzler die naive, warmblütige Hingebung
der Vorstadtmädchen, Hauptmann die Ver-
zweiflung verkommender Proleten. In der Er-
kenntlich von der Relativität aller Lebensbe-
ziehungen, in dem Leugnen eines absoluten
Guten und Bösen, in dem Versuch sich jeder
Moral zu enthalten, in der Neutralität des
Dichters liegt das Neue, was uns der Natura-
lismus gebracht hat. Die Anschauung, daß
der Mensch immer Klassenmensch ist, daß alle
Klassen geworden sind und das Gewordene
immer Daseinsrecht hat. liegt allem zu Grunde,
was die moderne deutsche Bühnenkunst G ge-
schaffen hat. Von den nur Aeußerlich-Moder
neu, die mit der neuen Kunst alte Technik aus-
statten, spreche ich hier nicht, obwohl sie — wie
stets die Compromißnaturen — die Mehrzahl
und die Erfolgreichen sind. Und mit dieser ihrer
Grundanschauung hat, obwohl ihre Richtigkeit
zweifellos ist, die Moderne Schisfbruch gelitten.
Warum? Weil das Publikum nicht mitging.
Und dieses ging deshalb nicht mit, weil es seiner
innersten Natur nach nicht mitgehen konnte.
Die sogenannten Erfolge der Moderne beruhten
immer nur auf Verblüffung, Einschüchterung
des Publikums. Nach einiger Zeit gelang das
den Dichtern nicht mehr. Diejenigen unter
ihnen, die nicht nur Psychologen, sondern
auch Poeten waren, schwenkten ab und suchen
in der Erneuerung der dem deutschen Charakter
so angemessenen Romantik das Heil der Kunst;
die Anderen gehen unter.
Die neue Kunst konnte ihre Aufgabe nicht
lösen, weil sie für das Drama unlösbar ist. Das
Drama braucht — seiner ganzen Natur nach —
Parteien, das Publikum muß wissen, mit wem
der Autor fühlt und für wen es zu fühlen
hat. Je dünner das Band ist, an dem der
Dramatiker die Zuschauer führt, desto seltener
wird sein Stück gegeben werden. Wenn er sie
aber auf eine Seite zerrt — sei es auch die
schlechte — dann werden sie ihm gehorchen I
Von allen Künsten hat das Drama die anr
strengsten gezogenen Grenzen. Alles Unklare
ist von ihm verbannt. „Ja" oder „Nein" ist
seine Sprache. Die Bühne muß ungerecht sein-
Was folgt daraus?
354 b
. JUGEND -
1900
J. Damb:rger (München)
Mls vor einigen Jahren die Schablone des
Theaters unseren lieben Zeitgenossen zu
dürr und dürftig wurde, machten ein paar junge
Leute gar beträchtlichen Wind. Sie nahmen
den Mund recht voll; der Sturm sauste durch
die Zeitungsblätter. Einige unter ihnen gingen
sehr weit — freilich ohne große Gefolgschaft.
Sie prägten das Schlagwort von der Über-
schätzung des Theaters. Seit damals sind die
meisten von diesen Herren selbst dramatisch
thätig — bei der Handlungslosigkeit der dra-
matisch verkleideten Novellen der letzten Jahre
möchte man beinahe sagen: dramatisch un-
Ihätig — und die Bewegung von damals hat,
wie so viele Bewegungen, kaum einen anderen
Erfolg gehabt, als einige neue Autoritäten zu
schaffen. Und doch lag in dem radikalen Para-
doxon eine kleine Wahrheit, wie in fast allen
Paradoxen. Und diese kleine Wahrheit ist heute
sehr groß geworden. Das bischen Interesse,
das unsere betriebsame Zeit für Kunst übrig
hat, wird fast ganz auf das Theater verwendet.
Wer kann, schreibt für das Theater, und wer
nicht kann, erst recht. Und das Publikum geht,
allen Bemühungen der Theaterdirektoren trotzend,
in die Theater. Ziffermäßig ließe sich erweisen,
daß mindestens zehnmal mehr Leute Theater
als Galerieen besuchen. Und finanziell —
leider muß man heute bei der Kunst von diesen
Dingen zuerst sprechen — bringen alle anderen
Künste nicht so beträchtliche Summen in's Rollen
wie das Theater. Unsere Thespiskärrner machen
oft hübschen Fuhrlohn.
Und nun zeigt sich eine befremdende That-
sache. Trotz dieses allgemeinen, sehr über-
triebenen Interesses für Theater ist alles, was
damit zusammenhängt, seltsam, verworren, über-
raschend. Maßstab und Richtmaß sind ver-
loren gegangen. Eine literarische Revolte ist
zu Ende und Niemand weiß, was sie uns ge-
nommen und uns gebracht hat; Niemand ahnt,
wohin die Fahrt geht. Dramatiker, die schon
einige Male von kritischen Keulenschlägen er-
schlagen oder vom Publikum hinweggegähnt
wurden, erringen überraschende Erfolge. An-
drerseits versagen die früher sichersten Kräfte.
Schauspielerische Temperamente der verschieden-
sten Art setzen sich zur selben Zeit beim selben
Publikum durch. Welchen Weg die Entwicklung
der Bühne geht, ahnt Niemand, bekümmert auch
Niemand. Und doch ließe sich vielleicht von
der Zukunft des Theaters ein Schleier weg-
ziehen, wenn man die Vergangenheit ein wenig
betrachtet. So wollen wir in Kürze die Bilanz
des Naturalismus ziehen. Im Vorhinein sei
gesagt: sie ist passiv.
Die Gründe des Naturalismus liegen tiefer
als die zunftmäßige Aesthetik meint. Es wäre
ungerecht, die ganze Revolte auf schöngeistiges
Gebiet zu ziehen, in ihr nichts als einen Kampf
gegen einige Conventionen zu sehen. Der Na-
turalismus ist mehr als die Opposition gegen
einige abgebrauchte Lustspieltypen, gegen Mono-
loge und Beiseitesprechen. Ich glaube, die
neue Richtung war ein Versuch, allen
Erkenntnissen der neuen Weltanschau-
ung das Theater zu erobern: vor allem
den Entdeckungen der Naturwissenschaften und
der Soziologie. Die erste mit dem bitteren Dog-
ma der Erblichkeit beherrscht Ibsens Schaffen.
Und dieses Dogma ist unerbittlich, wie alle
Dogmen; kein liebenswürdiger deus ex ma-
china erscheint wie im alten Drama und hilft
dem armen Oswald Alving, stärkt der kleinen
Hedwig Ekdal schwache Augen. Daß den Starken
im Kampf ums Dasein alles erlaubt ist und
Skrupeln nur Erfindungen der Schwachen sind,
das weiß der Herr Bankdirektor John Gabriel
Borkmann aus Darwin und dessen Nachfahren.
Die neue Soziologie aber hat vor allem den
deutschen Naturalismus beeinflußt; die
Klassentheorie brachte auch den jungen Dichtem
E. Wilke (München)
„Ich bin nur gespannt darauf, ob ich in der
Leihbibliothek das Lexikon Ileinze bekomme,
von dem jetzt überall gesprochen Wird.“
zum Bewußtsein, dap jede Klasse ihre eigene
Moral, Gesetze und Ehre habe, daß auf der
Bühne bisher nicht der Normalmensch
— der überhaupt nicht existiere — sondern der
Normalbürger geherrscht habe. Hier waren
also unerforschte Gebiete, ein neuer Erdtheik
für die Kunst, Goldfelder der Psychologie, in
denen noch kein dramatischer Arbeiter geschürft
hatte — und jetzt entdeckte jeder etwas: Hirsch-
feld die psychologischen Differenzierungen des
jüdischen, kaum assimilierten Bürgerthums,
Schnitzler die naive, warmblütige Hingebung
der Vorstadtmädchen, Hauptmann die Ver-
zweiflung verkommender Proleten. In der Er-
kenntlich von der Relativität aller Lebensbe-
ziehungen, in dem Leugnen eines absoluten
Guten und Bösen, in dem Versuch sich jeder
Moral zu enthalten, in der Neutralität des
Dichters liegt das Neue, was uns der Natura-
lismus gebracht hat. Die Anschauung, daß
der Mensch immer Klassenmensch ist, daß alle
Klassen geworden sind und das Gewordene
immer Daseinsrecht hat. liegt allem zu Grunde,
was die moderne deutsche Bühnenkunst G ge-
schaffen hat. Von den nur Aeußerlich-Moder
neu, die mit der neuen Kunst alte Technik aus-
statten, spreche ich hier nicht, obwohl sie — wie
stets die Compromißnaturen — die Mehrzahl
und die Erfolgreichen sind. Und mit dieser ihrer
Grundanschauung hat, obwohl ihre Richtigkeit
zweifellos ist, die Moderne Schisfbruch gelitten.
Warum? Weil das Publikum nicht mitging.
Und dieses ging deshalb nicht mit, weil es seiner
innersten Natur nach nicht mitgehen konnte.
Die sogenannten Erfolge der Moderne beruhten
immer nur auf Verblüffung, Einschüchterung
des Publikums. Nach einiger Zeit gelang das
den Dichtern nicht mehr. Diejenigen unter
ihnen, die nicht nur Psychologen, sondern
auch Poeten waren, schwenkten ab und suchen
in der Erneuerung der dem deutschen Charakter
so angemessenen Romantik das Heil der Kunst;
die Anderen gehen unter.
Die neue Kunst konnte ihre Aufgabe nicht
lösen, weil sie für das Drama unlösbar ist. Das
Drama braucht — seiner ganzen Natur nach —
Parteien, das Publikum muß wissen, mit wem
der Autor fühlt und für wen es zu fühlen
hat. Je dünner das Band ist, an dem der
Dramatiker die Zuschauer führt, desto seltener
wird sein Stück gegeben werden. Wenn er sie
aber auf eine Seite zerrt — sei es auch die
schlechte — dann werden sie ihm gehorchen I
Von allen Künsten hat das Drama die anr
strengsten gezogenen Grenzen. Alles Unklare
ist von ihm verbannt. „Ja" oder „Nein" ist
seine Sprache. Die Bühne muß ungerecht sein-
Was folgt daraus?
354 b