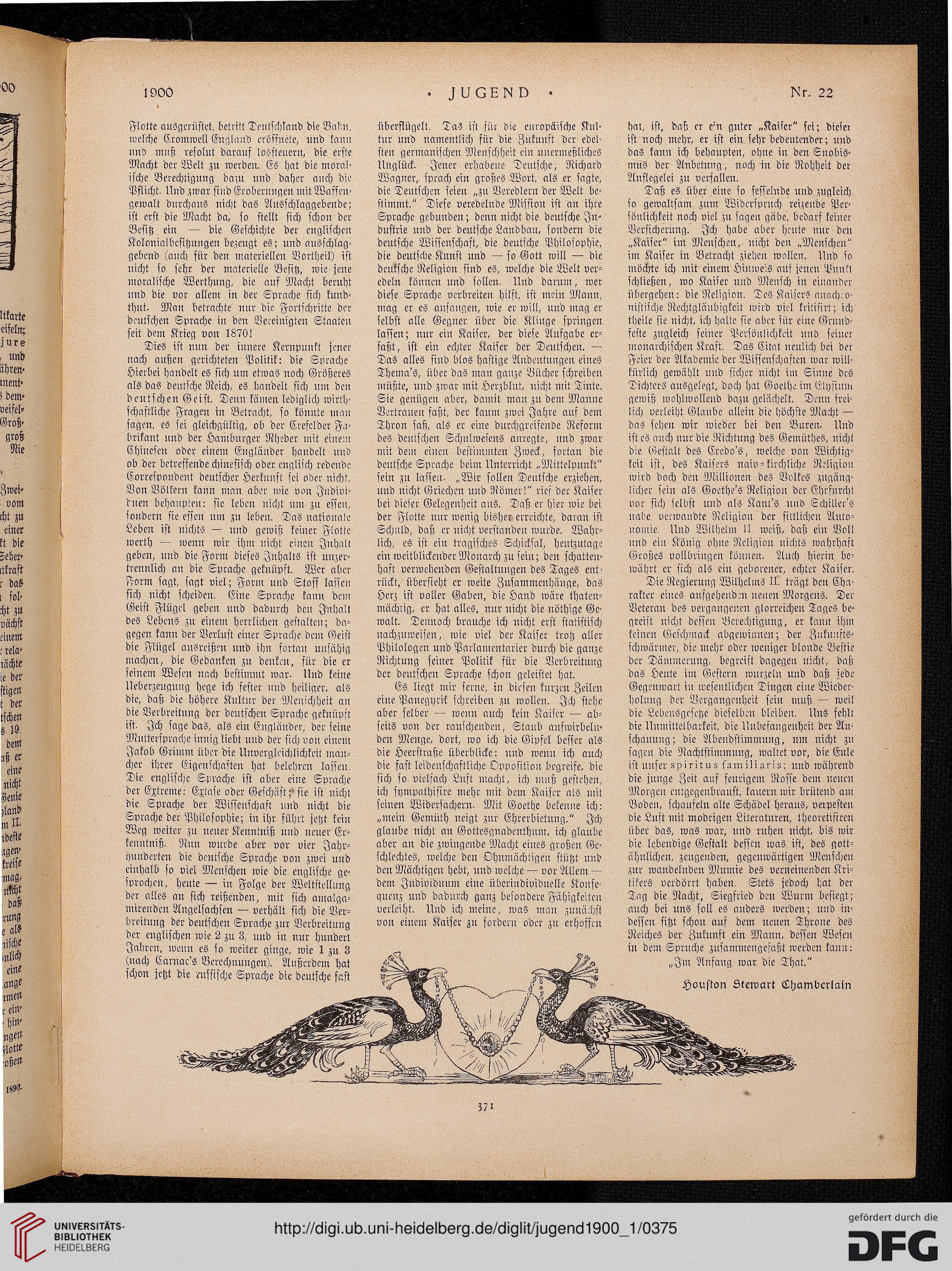1900
JUGEND
Nr. 22
Flotte ausgerüstet, betritt Deutschland die Bahn,
welche Cromwell England cröfmete, und kann
und muß resolut darauf lossteuern, die erste
Macht der Welt Zu werden. Es Hat die moral-
ische Berechtigung da;u und daher auch die
Pflicht. Und Zwar sind Eroberungen mit Waffen-
gewalt durchaus nicht das Ausschlaggebende;
ist erst die Macht da, so stellt sich schon der
Besitz ein — die Geschichte der englischen
Kolonialbesitzungen bezeugt es; und ausschlag-
gebend (auch für den materiellen Vortheil) ist
nicht so sehr der materielle Besitz, wie jene
moralische Werthung, die auf Macht beruht
und die vor allem in der Sprache sich kund-
thut. Man betrachte nur die Fortschritte der
deutschen Sprache in den Vereinigten Staaten
seit dem Krieg von 18701
Dies ist nun der innere Kernpunkt jener
nach außen gerichteten Politik: die Sprache
Hierbei handelt es sich um etwas noch Größeres
als das deutsche Reich, es bandelt sich um deu
deutschen Geist. Denn kämen lediglich wirth-
schaftliche Fragen in Betracht, so könnte inan
sagen, es sei gleichgültig, ob der Crefelder Fa-
brikant unb der Hamburger Rheder mit einem
Chinesen oder einem Engländer handelt und
ob der betreffende chinesisch oder englisch redende
Correspondent deutscher Herkunft sei oder nicht.
Von Völkern kann man aber tute von Indivi-
duen behaupten: sie leben nicht nur zu essen,
sondern sie essen mit Zu leben. Das nationale
Leben ist nichts — und gewiß keiner Flotte
werth — wenn wir ihm nicht einen Inhalt
geben, ltnb die Form dieses Inhalts ist unzer-
trennlich an die Sprache geknüpft. Wer aber
Form sagt, sagt viel; Forin ltub Stoff lassen
sich nicht scheiden. Eine Sprache kann bau
Geist Flügel geben und dadurch deu Inhalt
des Lebens Zu einem herrlichen gestalten; da-
gegen kann der Verlust einer Sprache dem Geist
die Flügel ausreißen und ihn fortan unfähig
machen, die Gedanken zu denkeu, für die er
seinem Wesen nach bestimntt war. Und keine
UeberZeugung hege ich fester und heiliger, als
die, daß die höhere Kultur der Menschheit an
die Verbreitung der deutschen Sprache geknüpft
ist. Ich sage das, als ein Engländer, der seine
Muttersprache innig liebt und der sich von einem
Jakob Grimm über die Unvergleichlichkeit man-
cher ihrer Eigenschaften hat belehren lassen.
Die englische Sprache ist aber eine Sprache
der Extreme: Extase oder Geschäft;'sie ist nicht
die Sprache der Wissenschaft mtb nicht die
Sprache der Philosophie; in ihr führt jetzt kein
Weg weiter Zu neuer Kenntuiß mtb neuer Er-
kenntniß. Run wurde aber vor vier Jahr-
hunderten die deutsche Sprache von zwei und
einhalb so viel Menschen wie die englische ge-
sprochen, heute — in Folge der Weltstellung
der alles an sich reißenden, mit sich amalga-
mirenden Angelsachsen — verhält sich die Ver-
breitung der deutschen Sprache zur Verbreitung
der englischen wie 2 Zu 3, unb in nur hundert
Jahren, wenn es so weiter ginge, wie 1 zu 3
(nach Carnac's Berechnungen). Außerdem hat
schon jetzt die ntsssiche Sprache die deutsche fast
überflügelt. Das ist für die europäische STnl*
tur und namentlich für die Zukunft der edel-
sten germanischen Menschheit ein unermeßliches
Unglück. Jener erhabene Deutsche, Richard
Wagner, sprach ein großes Wort, als er sagte,
die Deutschen seien „zu Veredlern der Welt be-
stimmt." Diese veredelnde Mission ist an ihre
Sprache gebunden; denn nicht die deutsche In-
dustrie und der deutsche Landbau, sondern die
deutsche Wissenschaft, die deutsche Philosophie,
die deutsche Kunst und — so Gott will — die
deutsche Religion sind es, welche die Welt ver-
edeln können und sollen. Und daruut, wer
diese Sprache verbreiten hilft, ist mein Mann,
mag er es anfangen, wie er will, und mag er
selbst alle Gegner über die Klinge springen
lassen; nur ein Kaiser, der diese Aufgabe er-
faßt, ist ein echter Kaiser der Deutschen. —
Das alles sind blos hastige Andeutungen eines
ThemcLs, über das man ganze Bücher schreiben
ntüßte, und zwar mit Herzblut, nicht mit Tinte.
Sie genügen aber, damit man zu dent Manne
Vertrauen faßt, der kaunr zwei Jahre aus dem
Thron saß, als er eine durchgreifende Refornr
des deitlschen Schulwesens anregte, mtb zwar
mit dein einen bestimmten Zweck, fortan die
deutsche Sprache beim Unterricht „Mittelpunkt"
sein zu lasseit. „Wir sollen Detttsche erziehen,
und nicht Griechen und Römer!" rief der Kaiser
bei dieser Gelegenheit aits. Daß er hier wie bei
der Flotte nur wenig bisher erreichte, daran ist
Schuld, daß er nicht verstanden wurde. Wahr-
lich, es ist ein tragisches Schicksal, heutzutage
ein weitblickender Monarch zu sein; den schatten-
haft verwebenden Gestaltungen des Tages ent'
rückt, übersieht er weite Zusammenhänge, das
Herz ist voller Gaben, die Hand wäre thaten-
mächtig, er hat alles, nur nicht die nöthige Ge-
walt. Dennoch brauche ich nicht erst statistisch
nachzuweisen, wie viel der Kaiser trotz aller
Philologen und Parlantentarier durch die ganze
Richtung seiner Politik für die Verbreitung
der deutschen Sprache schon geleistet hat.
Es liegt mir ferne, in diesen kurzen Zeilen
eine Panegyrik schreiben zu wollen. Ich stehe
aber selber — wenn auch kein Kaiser — ab-
seits von der rauschenden, Staub aufwirbeln-
den Menge, dort, wo ich die Gipfel besser als
die Heerstraße überblicke: und wenn ich auch
die fast leidenschaftliche Opposition begreife, die
sich so vielfach Luft macht, ich ntuß gestehen,
ich sympathisire mehr mit dem Kaiser als mit
seinen Widersachern. Mit Goethe bekenne ich:
„mein Gemüth neigt zur Ehrerbietung." Ich
glaube nicht an Gottesgnadenthnm, ich glaube
aber an die zwingende Macht eines großen Ge-
schlechtes, welche den Ohnmächtigen stützt und
den Mächtigett hebt, und welche — vor Allem —
dem Individuum eine überindividuelle Konse-
quenz und dadurch ganz besondere Fähigkeiten
verleiht. Und ich meine, was man zunächst
von einem Kaiser zu fordern oder zu erhoffen
‘X
bat, ist, daß er em guter „Kaiser" sei; dieser
ist noch mehr, er ist ein sehr bedeutender; mtb
das kann ich behaupten, ohne in den Snobis-
mus der Anbetung, noch in die Rohheit der
Anflegelei zu verfallen.
Daß es über eine so fesselnde und zugleich
so gewaltsam zum Widerspruch reizende Per-
sönlichkeit noch viel zu sagen gäbe, bedarf keiner
Versicherung. Ich habe aber heute nur den
„Kaiser" im Menschen, rticht den „Menschen"
im Kaiser in Betracht ziehen wollen. Und so
möchte ich mit einem Hinweis auf jenert Punkt
schließen, wo Kaiser unb Mensch in einander
übergehen: die Religion. Des Kaisers anacheo-
nistische Rechtglättbigkeit tuirb viel trittsirt; ich
theile sie nicht, ich halte sie aber für eine Grund-
feste zugleich seiner Persönlichkeit und seiner
ntonarchischen Kraft. Das Citat tteulich bei der
Feier der Akademie der Wissenschaften war will-
kürlich gewählt und sicher nicht int Sinne des
Dichters ausgelegt, doch hat Goethe im Elysium
gewiß wohlwollend dazu gelächelt. Denn frei-
lich verleiht Glaube allein die höchste Macht —
das sehen wir wieder bei den Buren. Und
ist es auch nur die Richtttng des Gemüthes, nicht
die Gestalt des Credo's, welche von Wichtig-
keit ist, des Kaisers naiv-kirchliche Religion
wird doch den Millionen des Volkes zugäng-
licher fein als Goethe's Religion der Ehrfurcht
vor sich selbst und als Kant's unb Schillert
nabe verwandte Religion der sittlichen Auto-
uomie. Und Wilhelnt ll weiß, daß eilt Voll
unb ein König ohne Religiott ttiehts wahrhaft
Großes vollbringen körnten. Auch hierin be-
währt er sich als ein geborener, echter Kaiser.
Die Regierung Wilheluts II. trägt bat Cha-
rakter eines ausgehenden neuen Morgens. Der
Veteran des vergangenen glorreichen Tages be-
greift nicht beffen Berechtigung, er kann ihm
keinen Geschmack abgewinnen; der Znkunsts-
schwärnrer, die mehr oder meniger blonde Bestie
der Dämnterung, begreift dagegen nicht, daß
das Heute int Gestern wurzeln und daß jede
Gegenwart in wesentlichen Dingen eine Wieder-
holutig der Vergangenheit sein ntuß — tveil
die Lebeusgesetze dieselbett bleibett. Uns fehlt
die Unmittelbarkeit, die Unbefangettheit der An-
schauuttg; die Abettdstimmung, um nicht ztt
sagen die Rachtstimtnuttg, waltet vor, die Eule
ist unser Spiritus familiaris; und während
die jttnge Zeit auf feurigem Rosse dem neuen
Morgen entgegenbraust, kauern wir brütend am
Boden, schaufeln alte Schädel heraus, verpesten
die Luft mit modrigen Literaturen, theoretifiren
über das, was war, und ruhen rticht, bis wir
die lebeitbtge Gestalt dessen was ist, des gott-
ähnlichen, zeugenden, gegenwärtigen Menschett
zrtr wandelttden Mumie des verneinenden Kri-
tikers verdörrt haben. Stets jedoch hat der
Tag die Nacht, Siegfried den Wurm besiegt;
auch bei uns soll es anders werden; mtb in-
dessen sitzt schon auf dem neuen Throtte des
Reiches der Zukunft ein Mann, dessen Wesett
in dem Spruche zusammengefaßt werden fattn:
„Im Anfang war die That."
Houston Stewart Lhambcrlain
&
Wa
/ T y" /
SW '
37i
JUGEND
Nr. 22
Flotte ausgerüstet, betritt Deutschland die Bahn,
welche Cromwell England cröfmete, und kann
und muß resolut darauf lossteuern, die erste
Macht der Welt Zu werden. Es Hat die moral-
ische Berechtigung da;u und daher auch die
Pflicht. Und Zwar sind Eroberungen mit Waffen-
gewalt durchaus nicht das Ausschlaggebende;
ist erst die Macht da, so stellt sich schon der
Besitz ein — die Geschichte der englischen
Kolonialbesitzungen bezeugt es; und ausschlag-
gebend (auch für den materiellen Vortheil) ist
nicht so sehr der materielle Besitz, wie jene
moralische Werthung, die auf Macht beruht
und die vor allem in der Sprache sich kund-
thut. Man betrachte nur die Fortschritte der
deutschen Sprache in den Vereinigten Staaten
seit dem Krieg von 18701
Dies ist nun der innere Kernpunkt jener
nach außen gerichteten Politik: die Sprache
Hierbei handelt es sich um etwas noch Größeres
als das deutsche Reich, es bandelt sich um deu
deutschen Geist. Denn kämen lediglich wirth-
schaftliche Fragen in Betracht, so könnte inan
sagen, es sei gleichgültig, ob der Crefelder Fa-
brikant unb der Hamburger Rheder mit einem
Chinesen oder einem Engländer handelt und
ob der betreffende chinesisch oder englisch redende
Correspondent deutscher Herkunft sei oder nicht.
Von Völkern kann man aber tute von Indivi-
duen behaupten: sie leben nicht nur zu essen,
sondern sie essen mit Zu leben. Das nationale
Leben ist nichts — und gewiß keiner Flotte
werth — wenn wir ihm nicht einen Inhalt
geben, ltnb die Form dieses Inhalts ist unzer-
trennlich an die Sprache geknüpft. Wer aber
Form sagt, sagt viel; Forin ltub Stoff lassen
sich nicht scheiden. Eine Sprache kann bau
Geist Flügel geben und dadurch deu Inhalt
des Lebens Zu einem herrlichen gestalten; da-
gegen kann der Verlust einer Sprache dem Geist
die Flügel ausreißen und ihn fortan unfähig
machen, die Gedanken zu denkeu, für die er
seinem Wesen nach bestimntt war. Und keine
UeberZeugung hege ich fester und heiliger, als
die, daß die höhere Kultur der Menschheit an
die Verbreitung der deutschen Sprache geknüpft
ist. Ich sage das, als ein Engländer, der seine
Muttersprache innig liebt und der sich von einem
Jakob Grimm über die Unvergleichlichkeit man-
cher ihrer Eigenschaften hat belehren lassen.
Die englische Sprache ist aber eine Sprache
der Extreme: Extase oder Geschäft;'sie ist nicht
die Sprache der Wissenschaft mtb nicht die
Sprache der Philosophie; in ihr führt jetzt kein
Weg weiter Zu neuer Kenntuiß mtb neuer Er-
kenntniß. Run wurde aber vor vier Jahr-
hunderten die deutsche Sprache von zwei und
einhalb so viel Menschen wie die englische ge-
sprochen, heute — in Folge der Weltstellung
der alles an sich reißenden, mit sich amalga-
mirenden Angelsachsen — verhält sich die Ver-
breitung der deutschen Sprache zur Verbreitung
der englischen wie 2 Zu 3, unb in nur hundert
Jahren, wenn es so weiter ginge, wie 1 zu 3
(nach Carnac's Berechnungen). Außerdem hat
schon jetzt die ntsssiche Sprache die deutsche fast
überflügelt. Das ist für die europäische STnl*
tur und namentlich für die Zukunft der edel-
sten germanischen Menschheit ein unermeßliches
Unglück. Jener erhabene Deutsche, Richard
Wagner, sprach ein großes Wort, als er sagte,
die Deutschen seien „zu Veredlern der Welt be-
stimmt." Diese veredelnde Mission ist an ihre
Sprache gebunden; denn nicht die deutsche In-
dustrie und der deutsche Landbau, sondern die
deutsche Wissenschaft, die deutsche Philosophie,
die deutsche Kunst und — so Gott will — die
deutsche Religion sind es, welche die Welt ver-
edeln können und sollen. Und daruut, wer
diese Sprache verbreiten hilft, ist mein Mann,
mag er es anfangen, wie er will, und mag er
selbst alle Gegner über die Klinge springen
lassen; nur ein Kaiser, der diese Aufgabe er-
faßt, ist ein echter Kaiser der Deutschen. —
Das alles sind blos hastige Andeutungen eines
ThemcLs, über das man ganze Bücher schreiben
ntüßte, und zwar mit Herzblut, nicht mit Tinte.
Sie genügen aber, damit man zu dent Manne
Vertrauen faßt, der kaunr zwei Jahre aus dem
Thron saß, als er eine durchgreifende Refornr
des deitlschen Schulwesens anregte, mtb zwar
mit dein einen bestimmten Zweck, fortan die
deutsche Sprache beim Unterricht „Mittelpunkt"
sein zu lasseit. „Wir sollen Detttsche erziehen,
und nicht Griechen und Römer!" rief der Kaiser
bei dieser Gelegenheit aits. Daß er hier wie bei
der Flotte nur wenig bisher erreichte, daran ist
Schuld, daß er nicht verstanden wurde. Wahr-
lich, es ist ein tragisches Schicksal, heutzutage
ein weitblickender Monarch zu sein; den schatten-
haft verwebenden Gestaltungen des Tages ent'
rückt, übersieht er weite Zusammenhänge, das
Herz ist voller Gaben, die Hand wäre thaten-
mächtig, er hat alles, nur nicht die nöthige Ge-
walt. Dennoch brauche ich nicht erst statistisch
nachzuweisen, wie viel der Kaiser trotz aller
Philologen und Parlantentarier durch die ganze
Richtung seiner Politik für die Verbreitung
der deutschen Sprache schon geleistet hat.
Es liegt mir ferne, in diesen kurzen Zeilen
eine Panegyrik schreiben zu wollen. Ich stehe
aber selber — wenn auch kein Kaiser — ab-
seits von der rauschenden, Staub aufwirbeln-
den Menge, dort, wo ich die Gipfel besser als
die Heerstraße überblicke: und wenn ich auch
die fast leidenschaftliche Opposition begreife, die
sich so vielfach Luft macht, ich ntuß gestehen,
ich sympathisire mehr mit dem Kaiser als mit
seinen Widersachern. Mit Goethe bekenne ich:
„mein Gemüth neigt zur Ehrerbietung." Ich
glaube nicht an Gottesgnadenthnm, ich glaube
aber an die zwingende Macht eines großen Ge-
schlechtes, welche den Ohnmächtigen stützt und
den Mächtigett hebt, und welche — vor Allem —
dem Individuum eine überindividuelle Konse-
quenz und dadurch ganz besondere Fähigkeiten
verleiht. Und ich meine, was man zunächst
von einem Kaiser zu fordern oder zu erhoffen
‘X
bat, ist, daß er em guter „Kaiser" sei; dieser
ist noch mehr, er ist ein sehr bedeutender; mtb
das kann ich behaupten, ohne in den Snobis-
mus der Anbetung, noch in die Rohheit der
Anflegelei zu verfallen.
Daß es über eine so fesselnde und zugleich
so gewaltsam zum Widerspruch reizende Per-
sönlichkeit noch viel zu sagen gäbe, bedarf keiner
Versicherung. Ich habe aber heute nur den
„Kaiser" im Menschen, rticht den „Menschen"
im Kaiser in Betracht ziehen wollen. Und so
möchte ich mit einem Hinweis auf jenert Punkt
schließen, wo Kaiser unb Mensch in einander
übergehen: die Religion. Des Kaisers anacheo-
nistische Rechtglättbigkeit tuirb viel trittsirt; ich
theile sie nicht, ich halte sie aber für eine Grund-
feste zugleich seiner Persönlichkeit und seiner
ntonarchischen Kraft. Das Citat tteulich bei der
Feier der Akademie der Wissenschaften war will-
kürlich gewählt und sicher nicht int Sinne des
Dichters ausgelegt, doch hat Goethe im Elysium
gewiß wohlwollend dazu gelächelt. Denn frei-
lich verleiht Glaube allein die höchste Macht —
das sehen wir wieder bei den Buren. Und
ist es auch nur die Richtttng des Gemüthes, nicht
die Gestalt des Credo's, welche von Wichtig-
keit ist, des Kaisers naiv-kirchliche Religion
wird doch den Millionen des Volkes zugäng-
licher fein als Goethe's Religion der Ehrfurcht
vor sich selbst und als Kant's unb Schillert
nabe verwandte Religion der sittlichen Auto-
uomie. Und Wilhelnt ll weiß, daß eilt Voll
unb ein König ohne Religiott ttiehts wahrhaft
Großes vollbringen körnten. Auch hierin be-
währt er sich als ein geborener, echter Kaiser.
Die Regierung Wilheluts II. trägt bat Cha-
rakter eines ausgehenden neuen Morgens. Der
Veteran des vergangenen glorreichen Tages be-
greift nicht beffen Berechtigung, er kann ihm
keinen Geschmack abgewinnen; der Znkunsts-
schwärnrer, die mehr oder meniger blonde Bestie
der Dämnterung, begreift dagegen nicht, daß
das Heute int Gestern wurzeln und daß jede
Gegenwart in wesentlichen Dingen eine Wieder-
holutig der Vergangenheit sein ntuß — tveil
die Lebeusgesetze dieselbett bleibett. Uns fehlt
die Unmittelbarkeit, die Unbefangettheit der An-
schauuttg; die Abettdstimmung, um nicht ztt
sagen die Rachtstimtnuttg, waltet vor, die Eule
ist unser Spiritus familiaris; und während
die jttnge Zeit auf feurigem Rosse dem neuen
Morgen entgegenbraust, kauern wir brütend am
Boden, schaufeln alte Schädel heraus, verpesten
die Luft mit modrigen Literaturen, theoretifiren
über das, was war, und ruhen rticht, bis wir
die lebeitbtge Gestalt dessen was ist, des gott-
ähnlichen, zeugenden, gegenwärtigen Menschett
zrtr wandelttden Mumie des verneinenden Kri-
tikers verdörrt haben. Stets jedoch hat der
Tag die Nacht, Siegfried den Wurm besiegt;
auch bei uns soll es anders werden; mtb in-
dessen sitzt schon auf dem neuen Throtte des
Reiches der Zukunft ein Mann, dessen Wesett
in dem Spruche zusammengefaßt werden fattn:
„Im Anfang war die That."
Houston Stewart Lhambcrlain
&
Wa
/ T y" /
SW '
37i