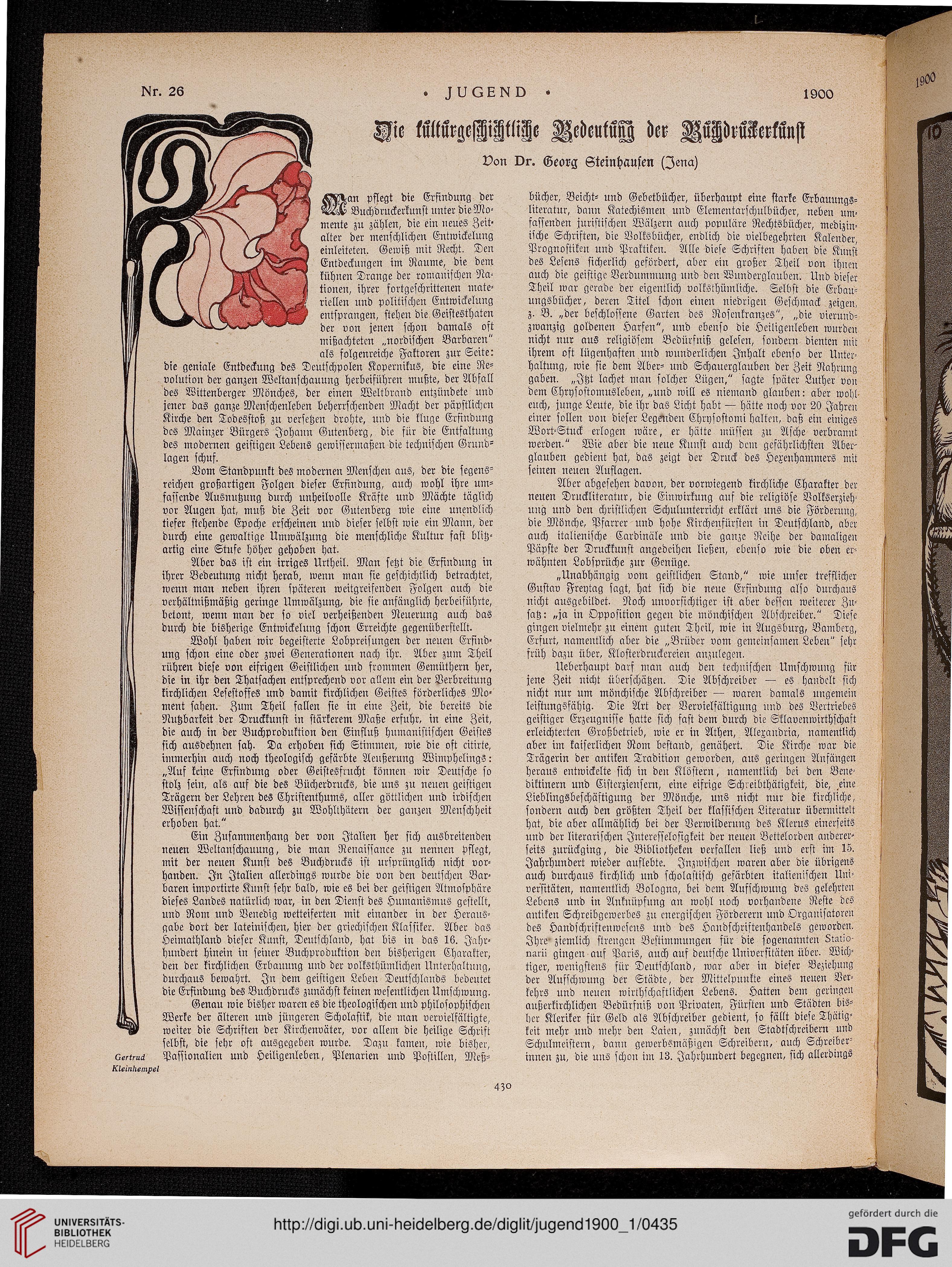Nr. 26
JUGEND
Ä
1900
We MArzkAiIkliAe HedeutnU dm WWrKcrkmist
Von Dr. Georg Steinhaufen (Jena)
Gertrud
Kleinhempel
an pflegt die Erfindung der
Buchdruckerkunst unter die Mo-
mente zu zählen, die ein neues Zeit-
alter der menschlichen Entwickelung
einleiteten. Gewiß mit Recht. Den
Entdeckungen im Raume, die dem
kühnen Drange der romanischen Na-
tionen, ihrer fortgeschrittenen mate-
riellen und politischen Entwickelung
entsprangen, stehen die Geistesthaten
der von jenen schon damals oft
mißachteten „nordischen Barbaren"
als folgenreiche Faktoren zur Seite:
die geniale Entdeckung des Deutschpolen Kopernikus, die eine Re-
volution der ganzen Weltanschauung herbeiführen mußte, der Abfall
des Wittenberger Mönches, der einen Weltbrand entzündete und
jener das ganze Menschenleben beherrschenden Macht der päpstlichen
Kirche den Todesstoß zu versehen drohte, und die kluge Erfindung
des Mainzer Bürgers Johann Gutenberg, die für die Entfaltung
des modernen geistigen Lebens gewissermaßen die technischen Grund-
lagen schuf.
Vom Standpunkt des modernen Menschen aus, der die segens-
reichen großartigen Folgen dieser Erfindung, auch wohl ihre um-
fassende Ausnutzung durch unheilvolle Kräfte und Mächte täglich
vor Augen hat, muß die Zeit vor Gutenberg wie eine unendlich
tiefer stehende Epoche erscheinen und dieser selbst wie ein Mann, der
durch eine gewaltige Umwälzung die menschliche Kultur fast blitz-
artig eine Stufe höher gehoben hat.
Aber das ist ein irriges Urtheil. Man setzt die Erfindung in
ihrer Bedeutung nicht herab, wenn man sie geschichtlich betrachtet,
wenn man neben ihren späteren weitgreifenden Folgen auch die
verhältnißmäßig geringe Umwälzung, die sie anfänglich herbeiführte,
betont, wenn man der so viel verheißenden Neuerung auch das
durch die bisherige Entwickelung schon Erreichte gegenüberstellt.
Wohl haben wir begeisterte Lobpreisungen der neuen Erfind-
ung schon eine oder zwei Generationen nach ihr. Aber zum Theil
rühren diese von eifrigen Geistlichen und frommen Gemüthern her,
die in ihr den Thatsachen entsprechend vor allem ein der Verbreitung
kirchlichen Lesestoffes und damit kirchlichen Geistes förderliches Mo-
ment sahen. Zum Theil fallen sie in eine Zeit, die bereits die
Nutzbarkeit der Druckkunst in stärkerem Maße erfuhr, in eine Zeit,
die auch in der Buchproduktion den Einfluß humanistischen Geistes
sich ausdehnen sah. Da erhoben sich Stimmen, wie die oft citirte,
immerhin auch noch theologisch gefärbte Aeußerung Wimphelings:
„Auf keine Erfindung oder Geistesfrucht können wir Deutsche so
stolz sein, als auf die des Bücherdrucks, die uns zu neuen geistigen
Trägern der Lehren des Christenthums, aller göttlichen und irdischen
Wissenschaft und dadurch zu Wohlthätern der ganzen Menschheit
erhoben hat."
Ein Zusammenhang der von Italien her sich ausbreitenden
neuen Weltanschauung, die man Renaissance zu nennen Pflegt,
mit der neuen Kunst des Buchdrucks ist ursprünglich nicht vor-
handen. In Italien allerdings wurde die von den deutschen Bar-
baren importirte Kunst sehr bald, wie es bei der geistigen Atmosphäre
dieses Landes natürlich war, in den Dienst des Humanismus gestellt,
und Rom und Venedig wetteiferten mit einander in der Heraus-
gabe dort der lateinischen, hier der griechischen Klassiker. Aber das
Heimathland dieser Kunst, Deutschland, hat bis in das 16. Jahr-
hundert hinein in seiner Buchproduktion den bisherigen Charakter,
den der kirchlichen Erbauung und der volkstümlichen Unterhaltung,
durchaus bewahrt. In dem geistigen Leben Deutschlands bedeutet
die Erfindung des Buchdrucks zunächst keinen wesentlichen Umschwung.
Genau wie bisher waren es die theologischen und philosophischen
Werke der älteren und jüngeren Scholastik, die man vervielfältigte,
weiter die Schriften der Kirchenväter, vor allem die heilige Schrift
selbst, die sehr oft ausgegeben wurde. Dazu kamen, wie bisher,
Passionalien und Heiligenleben, Plenarien und Postillen, Meß-
bücher, Beicht- und Gebetbücher, überhaupt eine starke Erbauungs-
literatur, dann Katechismen und Elementarschulbücher, neben um-
fassenden juristischen Wälzern auch populäre Rechtsbrecher, medizin-
ische Schriften, die Volksbücher, endlich die vielbegehrten Kalender,
Prognostiken und Praktiken. Alle diese Schriften haben die Kunst
des Lesens sicherlich gefördert, aber ein großer Theil von ihnen
auch die geistige Verdummung und den Wunderglauben. Und dieser
Theil war gerade der eigentlich volkstümliche. Selbst die Erbau-
ungsbücher, deren Titel schon einen niedrigen Geschmack zeigen,
z. B. „der beschlossene Garten des Rosenkranzes", „die vierund-
zwanzig goldenen Harfen", und ebenso die Heiligenleben wurden
nicht nur aus religiösem Bedürfniß gelesen, sondern dienten mit
ihrem oft lügenhaften und wunderlichen Inhalt ebenso der Unter-
haltung, wie sie dem Aber- und Schauerglauben der Zeit Nahrung
gaben. „Itzt lachet man solcher Lügen," sagte später Luther von
dem Chrysostomusleben, „und will es niemand glauben: aber wohl-
euch, junge Leute, die ihr das Licht habt — hätte noch vor 20 Jahren
einer sollen von dieser Legenden Chrysostomi halten, daß ein einiges
Wort-Stuck erlogen wäre, er hätte müssen zu Asche verbrannt
werden." Wie aber die neue Kunst auch dem gefährlichsten Aber-
glauben gedient hat, das zeigt der Druck des Hexenhammers mit
seinen neuen Auflagen.
Aber abgesehen davon, der vorwiegend kirchliche Charakter der
neuen Druckliteratur, die Einwirkung auf die religiöse Volkserzieh-
ung und den christlichen Schulunterricht erklärt uns die Förderung,
die Mönche, Pfarrer und hohe Kirchenfürsten in Deutschland, aber
auch italienische Cardinäle und die ganze Reihe der damaligen
Päpste der Druckkunst angedeihen ließen, ebenso wie die oben eu-
wähnten Lobsprüche zur Genüge.
„Unabhängig vom geistlichen Stand," wie unser trefflicher
Gustav Freytag sagt, hat sich die neue Erfindung also durchaus
nicht ausgebildet. Noch unvorsichtiger ist aber dessen weiterer Zu-
satz: „ja in Opposition gegen die mönchischen Abschreiber." Diese
gingen vielmehr Zu einem guten Theil, wie in Augsburg, Bamberg,
Erfurt, namentlich aber die „Brüder vom gemeinsamen Leben" sehr
früh dazu über, Klosterdruckereien anzulegen.
Ueberhaupt darf man auch den technischen Umschwung für
jene Zeit nicht überschätzen. Die Abschreiber — es handelt sich
nicht nur um mönchische Abschreiber — waren damals ungemein
leistungsfähig. Die Art der Vervielfältigung und des Vertriebes
geistiger Erzeugnisse hatte sich fast dem durch die Sklavenwirthschaft
erleichterten Großbetrieb, wie er in Athen, Alexandria, namentlich
aber im kaiserlichen Rom bestand, genähert. Die Kirche war die
Trägerin der antiken Tradition geworden, aus geringen Anfängen
heraus entwickelte sich in den Klöstern, namentlich bei den Bene-
diktinern und Cisterziensern, eine eifrige Schreibthätigkeit, die, .eine
Lieblingsbeschäftigung der Mönche, uns nicht nur die kirchliche,
sondern auch den größten Theil der klassischen Literatur übermittelt
hat, die aber allmählich bei der Verwilderung des Klerus einerseits
und der literarischen Interesselosigkeit der neuen Bettelorden anderer-
seits zurückging, die Bibliotheken verfallen ließ und erst im 15.
Jahrhundert wieder auflebte. Inzwischen waren aber die übrigens
auch durchaus kirchlich und scholastisch gefärbten italienischen Uni-
versitäten, namentlich Bologna, bei dem Aufschwung des gelehrten
Lebens und in Anknüpfung an wohl noch vorhandene Reste des
antiken Schreibgewerbes zu energischen Förderern und Organisatoren
des Handschriftenwesens und des Handschriftenhandels geworden.
Ihre' ziemlich strengen Bestimmungen für die sogenannten Statio-
narii gingen auf Paris, auch auf deutsche Universitäten über. Wich-
tiger, wenigstens für Deutschland, war aber in dieser Beziehung
der Aufschwung der Städte, der Mittelpunkte eines neuen Ver-
kehrs und neuen wirthschastlichen Lebens. Hatten dem geringen
außerkirchlichen Bedürfniß von Privaten, Fürsten und Städten bis-
her Kleriker für Geld als Abschreiber gedient, so fällt diese Thätig-
keit mehr und mehr den Laien, zunächst den Stadtschreibern und
Schulmeistern, dann gewerbsmäßigen Schreibern, auch Schreiber-
innen zu, die uns schon im 13. Jahrhundert begegnen, sich allerdings
4)0
JUGEND
Ä
1900
We MArzkAiIkliAe HedeutnU dm WWrKcrkmist
Von Dr. Georg Steinhaufen (Jena)
Gertrud
Kleinhempel
an pflegt die Erfindung der
Buchdruckerkunst unter die Mo-
mente zu zählen, die ein neues Zeit-
alter der menschlichen Entwickelung
einleiteten. Gewiß mit Recht. Den
Entdeckungen im Raume, die dem
kühnen Drange der romanischen Na-
tionen, ihrer fortgeschrittenen mate-
riellen und politischen Entwickelung
entsprangen, stehen die Geistesthaten
der von jenen schon damals oft
mißachteten „nordischen Barbaren"
als folgenreiche Faktoren zur Seite:
die geniale Entdeckung des Deutschpolen Kopernikus, die eine Re-
volution der ganzen Weltanschauung herbeiführen mußte, der Abfall
des Wittenberger Mönches, der einen Weltbrand entzündete und
jener das ganze Menschenleben beherrschenden Macht der päpstlichen
Kirche den Todesstoß zu versehen drohte, und die kluge Erfindung
des Mainzer Bürgers Johann Gutenberg, die für die Entfaltung
des modernen geistigen Lebens gewissermaßen die technischen Grund-
lagen schuf.
Vom Standpunkt des modernen Menschen aus, der die segens-
reichen großartigen Folgen dieser Erfindung, auch wohl ihre um-
fassende Ausnutzung durch unheilvolle Kräfte und Mächte täglich
vor Augen hat, muß die Zeit vor Gutenberg wie eine unendlich
tiefer stehende Epoche erscheinen und dieser selbst wie ein Mann, der
durch eine gewaltige Umwälzung die menschliche Kultur fast blitz-
artig eine Stufe höher gehoben hat.
Aber das ist ein irriges Urtheil. Man setzt die Erfindung in
ihrer Bedeutung nicht herab, wenn man sie geschichtlich betrachtet,
wenn man neben ihren späteren weitgreifenden Folgen auch die
verhältnißmäßig geringe Umwälzung, die sie anfänglich herbeiführte,
betont, wenn man der so viel verheißenden Neuerung auch das
durch die bisherige Entwickelung schon Erreichte gegenüberstellt.
Wohl haben wir begeisterte Lobpreisungen der neuen Erfind-
ung schon eine oder zwei Generationen nach ihr. Aber zum Theil
rühren diese von eifrigen Geistlichen und frommen Gemüthern her,
die in ihr den Thatsachen entsprechend vor allem ein der Verbreitung
kirchlichen Lesestoffes und damit kirchlichen Geistes förderliches Mo-
ment sahen. Zum Theil fallen sie in eine Zeit, die bereits die
Nutzbarkeit der Druckkunst in stärkerem Maße erfuhr, in eine Zeit,
die auch in der Buchproduktion den Einfluß humanistischen Geistes
sich ausdehnen sah. Da erhoben sich Stimmen, wie die oft citirte,
immerhin auch noch theologisch gefärbte Aeußerung Wimphelings:
„Auf keine Erfindung oder Geistesfrucht können wir Deutsche so
stolz sein, als auf die des Bücherdrucks, die uns zu neuen geistigen
Trägern der Lehren des Christenthums, aller göttlichen und irdischen
Wissenschaft und dadurch zu Wohlthätern der ganzen Menschheit
erhoben hat."
Ein Zusammenhang der von Italien her sich ausbreitenden
neuen Weltanschauung, die man Renaissance zu nennen Pflegt,
mit der neuen Kunst des Buchdrucks ist ursprünglich nicht vor-
handen. In Italien allerdings wurde die von den deutschen Bar-
baren importirte Kunst sehr bald, wie es bei der geistigen Atmosphäre
dieses Landes natürlich war, in den Dienst des Humanismus gestellt,
und Rom und Venedig wetteiferten mit einander in der Heraus-
gabe dort der lateinischen, hier der griechischen Klassiker. Aber das
Heimathland dieser Kunst, Deutschland, hat bis in das 16. Jahr-
hundert hinein in seiner Buchproduktion den bisherigen Charakter,
den der kirchlichen Erbauung und der volkstümlichen Unterhaltung,
durchaus bewahrt. In dem geistigen Leben Deutschlands bedeutet
die Erfindung des Buchdrucks zunächst keinen wesentlichen Umschwung.
Genau wie bisher waren es die theologischen und philosophischen
Werke der älteren und jüngeren Scholastik, die man vervielfältigte,
weiter die Schriften der Kirchenväter, vor allem die heilige Schrift
selbst, die sehr oft ausgegeben wurde. Dazu kamen, wie bisher,
Passionalien und Heiligenleben, Plenarien und Postillen, Meß-
bücher, Beicht- und Gebetbücher, überhaupt eine starke Erbauungs-
literatur, dann Katechismen und Elementarschulbücher, neben um-
fassenden juristischen Wälzern auch populäre Rechtsbrecher, medizin-
ische Schriften, die Volksbücher, endlich die vielbegehrten Kalender,
Prognostiken und Praktiken. Alle diese Schriften haben die Kunst
des Lesens sicherlich gefördert, aber ein großer Theil von ihnen
auch die geistige Verdummung und den Wunderglauben. Und dieser
Theil war gerade der eigentlich volkstümliche. Selbst die Erbau-
ungsbücher, deren Titel schon einen niedrigen Geschmack zeigen,
z. B. „der beschlossene Garten des Rosenkranzes", „die vierund-
zwanzig goldenen Harfen", und ebenso die Heiligenleben wurden
nicht nur aus religiösem Bedürfniß gelesen, sondern dienten mit
ihrem oft lügenhaften und wunderlichen Inhalt ebenso der Unter-
haltung, wie sie dem Aber- und Schauerglauben der Zeit Nahrung
gaben. „Itzt lachet man solcher Lügen," sagte später Luther von
dem Chrysostomusleben, „und will es niemand glauben: aber wohl-
euch, junge Leute, die ihr das Licht habt — hätte noch vor 20 Jahren
einer sollen von dieser Legenden Chrysostomi halten, daß ein einiges
Wort-Stuck erlogen wäre, er hätte müssen zu Asche verbrannt
werden." Wie aber die neue Kunst auch dem gefährlichsten Aber-
glauben gedient hat, das zeigt der Druck des Hexenhammers mit
seinen neuen Auflagen.
Aber abgesehen davon, der vorwiegend kirchliche Charakter der
neuen Druckliteratur, die Einwirkung auf die religiöse Volkserzieh-
ung und den christlichen Schulunterricht erklärt uns die Förderung,
die Mönche, Pfarrer und hohe Kirchenfürsten in Deutschland, aber
auch italienische Cardinäle und die ganze Reihe der damaligen
Päpste der Druckkunst angedeihen ließen, ebenso wie die oben eu-
wähnten Lobsprüche zur Genüge.
„Unabhängig vom geistlichen Stand," wie unser trefflicher
Gustav Freytag sagt, hat sich die neue Erfindung also durchaus
nicht ausgebildet. Noch unvorsichtiger ist aber dessen weiterer Zu-
satz: „ja in Opposition gegen die mönchischen Abschreiber." Diese
gingen vielmehr Zu einem guten Theil, wie in Augsburg, Bamberg,
Erfurt, namentlich aber die „Brüder vom gemeinsamen Leben" sehr
früh dazu über, Klosterdruckereien anzulegen.
Ueberhaupt darf man auch den technischen Umschwung für
jene Zeit nicht überschätzen. Die Abschreiber — es handelt sich
nicht nur um mönchische Abschreiber — waren damals ungemein
leistungsfähig. Die Art der Vervielfältigung und des Vertriebes
geistiger Erzeugnisse hatte sich fast dem durch die Sklavenwirthschaft
erleichterten Großbetrieb, wie er in Athen, Alexandria, namentlich
aber im kaiserlichen Rom bestand, genähert. Die Kirche war die
Trägerin der antiken Tradition geworden, aus geringen Anfängen
heraus entwickelte sich in den Klöstern, namentlich bei den Bene-
diktinern und Cisterziensern, eine eifrige Schreibthätigkeit, die, .eine
Lieblingsbeschäftigung der Mönche, uns nicht nur die kirchliche,
sondern auch den größten Theil der klassischen Literatur übermittelt
hat, die aber allmählich bei der Verwilderung des Klerus einerseits
und der literarischen Interesselosigkeit der neuen Bettelorden anderer-
seits zurückging, die Bibliotheken verfallen ließ und erst im 15.
Jahrhundert wieder auflebte. Inzwischen waren aber die übrigens
auch durchaus kirchlich und scholastisch gefärbten italienischen Uni-
versitäten, namentlich Bologna, bei dem Aufschwung des gelehrten
Lebens und in Anknüpfung an wohl noch vorhandene Reste des
antiken Schreibgewerbes zu energischen Förderern und Organisatoren
des Handschriftenwesens und des Handschriftenhandels geworden.
Ihre' ziemlich strengen Bestimmungen für die sogenannten Statio-
narii gingen auf Paris, auch auf deutsche Universitäten über. Wich-
tiger, wenigstens für Deutschland, war aber in dieser Beziehung
der Aufschwung der Städte, der Mittelpunkte eines neuen Ver-
kehrs und neuen wirthschastlichen Lebens. Hatten dem geringen
außerkirchlichen Bedürfniß von Privaten, Fürsten und Städten bis-
her Kleriker für Geld als Abschreiber gedient, so fällt diese Thätig-
keit mehr und mehr den Laien, zunächst den Stadtschreibern und
Schulmeistern, dann gewerbsmäßigen Schreibern, auch Schreiber-
innen zu, die uns schon im 13. Jahrhundert begegnen, sich allerdings
4)0