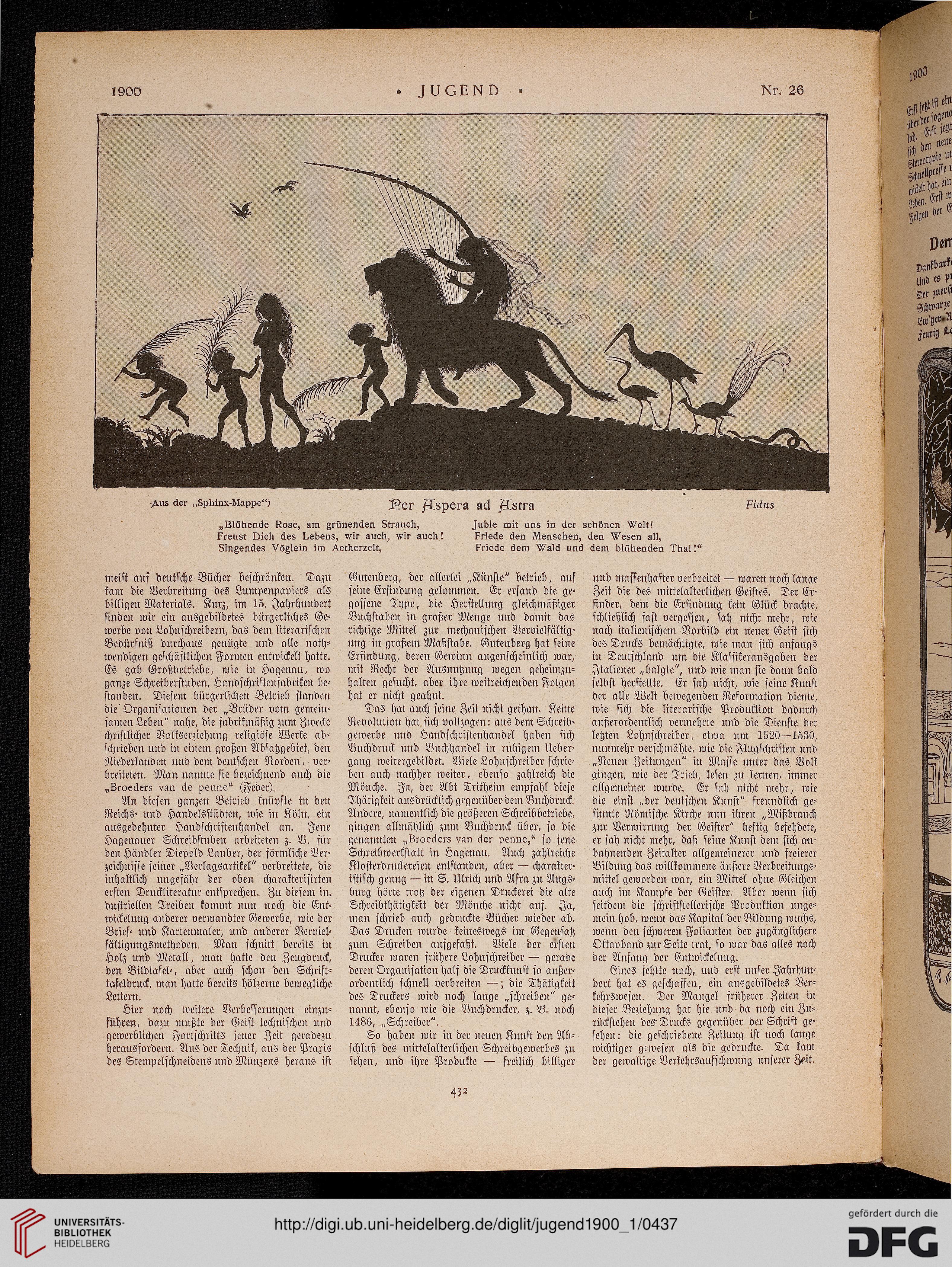SEMW
Und es P'
Der zucrp
Schwarze
Lw'gev»^
Feurig L<
1900
. JUGEND .
Nr. 26
vA-US der „Sphinx-Mappe“;
Ver £Espera ad £Estra
Fidus
„Blühende Rose, am grünenden Strauch,
Freust Dich des Lebens, wir auch, wir auch!
Singendes Voglein im Aetherzel-t,
Juble mit uns in der schönen Welt!
Friede den Menschen, den Wesen all,
Friede dem Wald und dem blühenden Thal!“
meist auf deutsche Bücher beschränken. Dazu
kam die Verbreitung des Lumpenpapiers als
billigen Materials. Kurz, im 15. Jahrhundert
finden wir ein ausgebildetes bürgerliches Ge-
werbe von Lohnschreibern, das dem literarischen
Bedürfniß durchaus genügte und alle noth-
wendigen geschäftlichen Formen entwickelt hatte.
Es gab Großbetriebe, wie in Hagenau, wo
ganze Schreiberstuben, Handschriftenfabriken be-
standen. Diesem bürgerlichen Betrieb standen
die'Organisationen der „Brüder vom gemein-
samen Leben" nahe, die fabrikmäßig zum Zwecke
christlicher Volkserziehung religiöse Werke ab-
schrieben und in einem großen Absatzgebiet, den
Niederlanden und dem deutschen Norden, ver-
breiteten. Man nannte sie bezeichnend auch die
„Broeders van de penneu (Feder).
An diesen ganzen Betrieb knüpfte in den
Reichs- und Handelsstädten, wie in Köln, ein
ausgedehnter Handschriftenhandel an. Jene
Hagenauer Schreibstuben arbeiteten z. B. für
den Händler Diepold Lauber, der förmliche Ver-
zeichnisse seiner „Verlagsartikel" verbreitete, die
inhaltlich ungefähr der oben charakterisirten
ersten Druckliteratur entsprechen. Zu diesem in-
dustriellen Treiben kommt nun noch die Ent-
wickelung anderer verwandter Gewerbe, wie der
Brief- und Kartenmaler, und anderer Verviel-
fältigungsmethoden. Man schnitt bereits in
Holz und Metall, man hatte den Zeugdruck,
den Bildtafel-, aber auch schon den Schrift-
tafeldruck, man hatte bereits hölzerne bewegliche
Lettern.
Hier noch weitere Verbesserungen einzu-
führen, dazu mußte der Geist technischen und
gewerblichen Fortschritts jener Zeit geradezu
herausfordern. Aus der Technik, aus der Praxis
des Stempelschneidens und Münzens heraus ist
Gutenberg, der allerlei „Künste" betrieb, auf
seine Erfindung gekommen. Er erfand die ge-
gossene Type, die Herstellung gleichmäßiger
Buchstaben in großer Menge und damit das
richtige Mittel zur mechanischen Vervielfältig-
ung in großem Maßstabe. Gutenberg hat seine
Erfindung, deren Gewinn augenscheinlich war,
mit Recht der Ausnutzung wegen geheimzu-
halten gesucht, aber ihre weitreichenden Folgen
hat er nicht geahnt.
Das hat auch seine Zeit nicht gethan. Keine
Revolution hat sich vollzogen: aus dem Schreib-
gewerbe und Handschriftenhandel haben sich
Buchdruck und Buchhandel in ruhigem Ueber-
gang weitergebildet. Viele Lohnschreiber schrie-
ben auch nachher weiter, ebenso zahlreich die
Mönche. Ja, der Abt Tritheim empfahl diese
Thätigkeit ausdrücklich gegenüber dem Buchdruck.
Andere, namentlich die größeren Schreibbetriebe,
gingen allmählich zum Buchdruck über, so die
genannten „Broeders van der penne/ so jene
Schreibwerkstatt in Hagenau. Auch zahlreiche
Klosterdruckereien entstanden, aber — charakter-
istisch genug — in S. Ulrich und Afra zu Augs-
burg hörte trotz der eigenen Druckerei die alte
Schreibthätigkeit der Mönche nicht auf. Ja,
man schrieb auch gedruckte Bücher wieder ab.
Das Drucken wurde keineswegs im Gegensatz
zum Schreiben aufgefaßt. Viele der ersten
Drucker waren frühere Lohnschreiber — gerade
deren Organisation half die Druckkunst so außer-
ordentlich schnell verbreiten —; die Thätigkeit
des Druckers wird noch lange „schreiben" ge-
nannt, ebenso wie die Buchdrucker, z. B. noch
1486, „Schreiber".
So haben wir in der neuen Kunst den Ab-
schluß des mittelalterlichen Schreibgewerbes zu
sehen, und ihre Produkte — freilich billiger
und massenhafter verbreitet — waren noch lange
Zeit die des mittelalterlichen Geistes. Der Er-
finder, dem die Erfindung kein Glück brachte,
schließlich fast vergessen, sah nicht mehr, wie
nach italienischem Vorbild ein neuer Geist sich
des Drucks bemächtigte, wie man sich anfangs
in Deutschland um die Klassikerausgaben der
Italiener „balgte", und wie man sie dann bald
selbst herftellte. Er sah nicht, wie seine Kunst
der alle Welt bewegenden Reformation diente,
wie sich die literarische Produktion dadurch
außerordentlich vermehrte und die Dienste der
letzten Lohnschreiber, etwa um 1520—1530,
nunmehr verschmähte, wie die Flugschriften und
„Neuen Zeitungen" in Masse unter das Volk
gingen, wie der Trieb, lesen zu lernen, immer
allgemeiner wurde. Er sah uicht mehr, wie
die einst „der deutschen Kunst" freundlich ge-
sinnte Römische Kirche nun ihren „Mißbrauch
zur Verwirrung der Geister" heftig befehdete,
er sah nicht mehr, daß seine Kunst dem sich am
bahnenden Zeitalter allgemeinerer und freierer
Bildung das willkommene äußere Verbreitungs-
mittel geworden war, ein Mittel ohne Gleichen
auch im Kampfe der Geister. Aber wenn sich
seitdem die schriftstellerische Produktion unge-
mein hob, wenn das Kapital der Bildung wuchs,
wenn den schweren Folianten der zugänglichere
Oktavband zur Seite trat, so war das alles noch
der Anfang der Entwickelung.
Eines fehlte noch, und erst unser Jahrhun-
dert hat es geschaffen, ein ausgebildetes Ver-
kehrswesen. Der Mangel früherer Zeiten in
dieser Beziehung hat hie und da noch ein Zu-
rückstehen des' Drucks gegenüber der Schrift ge-
sehen: die geschriebene Zeitung ist noch lange
wichtiger gewesen als die gedruckte. Da kam
der gewaltige Verkehrsaufschwung unserer Z?it.
4P
Und es P'
Der zucrp
Schwarze
Lw'gev»^
Feurig L<
1900
. JUGEND .
Nr. 26
vA-US der „Sphinx-Mappe“;
Ver £Espera ad £Estra
Fidus
„Blühende Rose, am grünenden Strauch,
Freust Dich des Lebens, wir auch, wir auch!
Singendes Voglein im Aetherzel-t,
Juble mit uns in der schönen Welt!
Friede den Menschen, den Wesen all,
Friede dem Wald und dem blühenden Thal!“
meist auf deutsche Bücher beschränken. Dazu
kam die Verbreitung des Lumpenpapiers als
billigen Materials. Kurz, im 15. Jahrhundert
finden wir ein ausgebildetes bürgerliches Ge-
werbe von Lohnschreibern, das dem literarischen
Bedürfniß durchaus genügte und alle noth-
wendigen geschäftlichen Formen entwickelt hatte.
Es gab Großbetriebe, wie in Hagenau, wo
ganze Schreiberstuben, Handschriftenfabriken be-
standen. Diesem bürgerlichen Betrieb standen
die'Organisationen der „Brüder vom gemein-
samen Leben" nahe, die fabrikmäßig zum Zwecke
christlicher Volkserziehung religiöse Werke ab-
schrieben und in einem großen Absatzgebiet, den
Niederlanden und dem deutschen Norden, ver-
breiteten. Man nannte sie bezeichnend auch die
„Broeders van de penneu (Feder).
An diesen ganzen Betrieb knüpfte in den
Reichs- und Handelsstädten, wie in Köln, ein
ausgedehnter Handschriftenhandel an. Jene
Hagenauer Schreibstuben arbeiteten z. B. für
den Händler Diepold Lauber, der förmliche Ver-
zeichnisse seiner „Verlagsartikel" verbreitete, die
inhaltlich ungefähr der oben charakterisirten
ersten Druckliteratur entsprechen. Zu diesem in-
dustriellen Treiben kommt nun noch die Ent-
wickelung anderer verwandter Gewerbe, wie der
Brief- und Kartenmaler, und anderer Verviel-
fältigungsmethoden. Man schnitt bereits in
Holz und Metall, man hatte den Zeugdruck,
den Bildtafel-, aber auch schon den Schrift-
tafeldruck, man hatte bereits hölzerne bewegliche
Lettern.
Hier noch weitere Verbesserungen einzu-
führen, dazu mußte der Geist technischen und
gewerblichen Fortschritts jener Zeit geradezu
herausfordern. Aus der Technik, aus der Praxis
des Stempelschneidens und Münzens heraus ist
Gutenberg, der allerlei „Künste" betrieb, auf
seine Erfindung gekommen. Er erfand die ge-
gossene Type, die Herstellung gleichmäßiger
Buchstaben in großer Menge und damit das
richtige Mittel zur mechanischen Vervielfältig-
ung in großem Maßstabe. Gutenberg hat seine
Erfindung, deren Gewinn augenscheinlich war,
mit Recht der Ausnutzung wegen geheimzu-
halten gesucht, aber ihre weitreichenden Folgen
hat er nicht geahnt.
Das hat auch seine Zeit nicht gethan. Keine
Revolution hat sich vollzogen: aus dem Schreib-
gewerbe und Handschriftenhandel haben sich
Buchdruck und Buchhandel in ruhigem Ueber-
gang weitergebildet. Viele Lohnschreiber schrie-
ben auch nachher weiter, ebenso zahlreich die
Mönche. Ja, der Abt Tritheim empfahl diese
Thätigkeit ausdrücklich gegenüber dem Buchdruck.
Andere, namentlich die größeren Schreibbetriebe,
gingen allmählich zum Buchdruck über, so die
genannten „Broeders van der penne/ so jene
Schreibwerkstatt in Hagenau. Auch zahlreiche
Klosterdruckereien entstanden, aber — charakter-
istisch genug — in S. Ulrich und Afra zu Augs-
burg hörte trotz der eigenen Druckerei die alte
Schreibthätigkeit der Mönche nicht auf. Ja,
man schrieb auch gedruckte Bücher wieder ab.
Das Drucken wurde keineswegs im Gegensatz
zum Schreiben aufgefaßt. Viele der ersten
Drucker waren frühere Lohnschreiber — gerade
deren Organisation half die Druckkunst so außer-
ordentlich schnell verbreiten —; die Thätigkeit
des Druckers wird noch lange „schreiben" ge-
nannt, ebenso wie die Buchdrucker, z. B. noch
1486, „Schreiber".
So haben wir in der neuen Kunst den Ab-
schluß des mittelalterlichen Schreibgewerbes zu
sehen, und ihre Produkte — freilich billiger
und massenhafter verbreitet — waren noch lange
Zeit die des mittelalterlichen Geistes. Der Er-
finder, dem die Erfindung kein Glück brachte,
schließlich fast vergessen, sah nicht mehr, wie
nach italienischem Vorbild ein neuer Geist sich
des Drucks bemächtigte, wie man sich anfangs
in Deutschland um die Klassikerausgaben der
Italiener „balgte", und wie man sie dann bald
selbst herftellte. Er sah nicht, wie seine Kunst
der alle Welt bewegenden Reformation diente,
wie sich die literarische Produktion dadurch
außerordentlich vermehrte und die Dienste der
letzten Lohnschreiber, etwa um 1520—1530,
nunmehr verschmähte, wie die Flugschriften und
„Neuen Zeitungen" in Masse unter das Volk
gingen, wie der Trieb, lesen zu lernen, immer
allgemeiner wurde. Er sah uicht mehr, wie
die einst „der deutschen Kunst" freundlich ge-
sinnte Römische Kirche nun ihren „Mißbrauch
zur Verwirrung der Geister" heftig befehdete,
er sah nicht mehr, daß seine Kunst dem sich am
bahnenden Zeitalter allgemeinerer und freierer
Bildung das willkommene äußere Verbreitungs-
mittel geworden war, ein Mittel ohne Gleichen
auch im Kampfe der Geister. Aber wenn sich
seitdem die schriftstellerische Produktion unge-
mein hob, wenn das Kapital der Bildung wuchs,
wenn den schweren Folianten der zugänglichere
Oktavband zur Seite trat, so war das alles noch
der Anfang der Entwickelung.
Eines fehlte noch, und erst unser Jahrhun-
dert hat es geschaffen, ein ausgebildetes Ver-
kehrswesen. Der Mangel früherer Zeiten in
dieser Beziehung hat hie und da noch ein Zu-
rückstehen des' Drucks gegenüber der Schrift ge-
sehen: die geschriebene Zeitung ist noch lange
wichtiger gewesen als die gedruckte. Da kam
der gewaltige Verkehrsaufschwung unserer Z?it.
4P