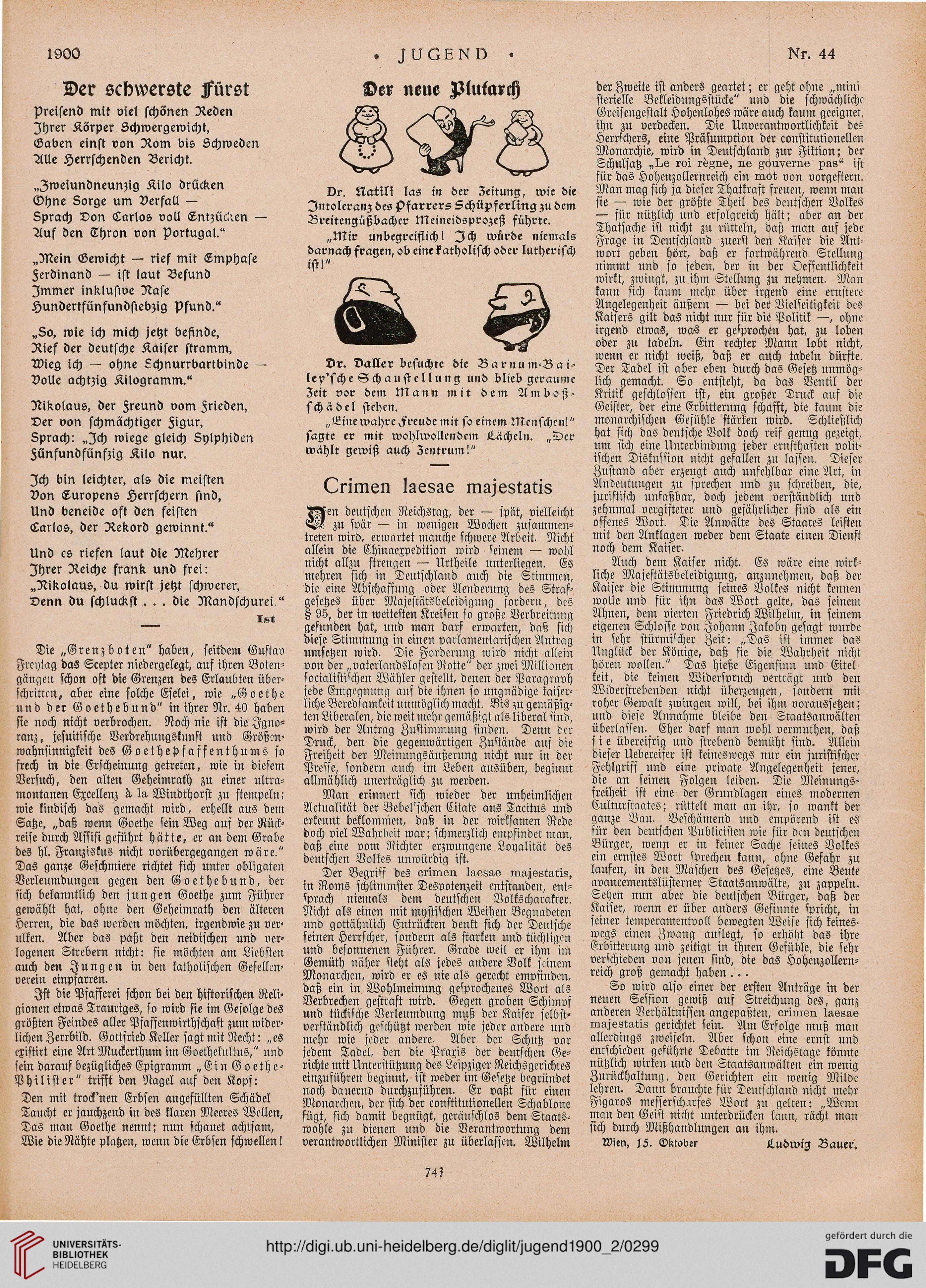1900
Nr. 44
Der schwerste jfürst
preisend mit viel schönen Reden
Ihrer Körper Schwergewicht,
Gaben einst von Rom bis Schweden
Alle Herrschenden Bericht.
„Zweiundneunzig Kilo drücken
Dhne Sorge um verfall —
Sprach Don Larlos voll Entzücken —
Aus den Thron von Portugal."
„Mein Gewicht — rief mit Emphase
Ferdinand — ift laut Befund
Zmmer inklusive Rase
Hundertfünsundsiebzig Pfund."
„So, wie ich mich seht befinde,
Ries der deutsche Kaiser stramm,
Wieg ich — ohne Lchnurrbartbinde —
volle achtzig Kilogramm."
Rikolaus, der Freund vom Frieden,
Der von schmächtiger Figur,
Sprach: „Ich wiege gleich Sylphiden
Fünsundsünszig Kilo nur.
Ich bin leichter, als die meisten
von Luropens Herrschern sind,
Und beneide oft den feisten
Larlos, der Rekord gewinnt."
Und cs riefen laut die Mehrer
Ihrer Reiche frank und frei:
„Rikolaus, du wirst jetzt schwerer,
Denn du schluckst ... die Mandschurei "
Ist
Die „Grenz b oten" haben, seitdem Gustav
Frcyiag das Scepter niedergelegt, auf ihren Boten-
gängen schon oft die Grenzen des Erlaubten über-
schritten, aber eine solche Eselei, wie „Goethe
und der Goethebund" in ihrer Nr. 40 haben
sie noch nicht verbrochen. Noch nie ist die Igno-
ranz, jesuitische Verdrehungskuust und Größen-
wahnsinnigkeit des G oethepfaffenthuins so
frech in die Erscheinung getreten, wie in diesem
Versuch, den alten Geheimrath zu einer ultra-
montanen Excellenz ä la Windthorst zu stempeln:
wie kindisch das gemacht wird, erhellt aus dem
Satze, „daß wenn Goethe sein Weg auf der Rück-
reise durch Assisi geführt hätte, er au dem Grabe
des hl. Franziskus nicht vorübergegangen wäre."
Das ganze Geschmiere richtet sich unter obligaten
Verleumdungen gegen den Goethebund, der
sich bekanntlich den jungen Goethe zum Führer
gewählt hat, ohne den Geheimrath den älteren
Herren, die das werden möchten, irgendwie zu ver-
ulken. Aber das paßt den neidischen und ver-
logenen Strebern nicht: sie möchten am Liebsten
auch den Jungen in den katholischen Gesellen-
verein einpfarren.
Ist die Pfafferei schon bei den historischen Reli-
gionen etwas Trauriges, so wird sie im Gefolge des
größten Feindes aller Pfaffenwirthschaft zum wider-
lichen Zerrbild. Gottfried Keller sagt mit Recht: „es
existirt eine Art Muckcrthum im Goethekultus," und
sein darauf bezügliches Epigramm „Ein Goethe-
Philister" trifft den Nagel auf den Kopf:
Den mit trock'nen Erbsen angefülltcn Schädel
Taucht er jauchzend in des klaren Meeres Wellen,
Das man Goethe nennt; nun schauet achtsam,
Wie die Nähte platzen, wenn die Erbsen schwellen I
. J U GE N D .
Der neue Müarch
<är
Dr. Natili las in dev Zeitung, wie die
Intoleranz des Pfarrers Schlixferling zu dem
Breitengüßbachcr Mcincidsprozeß führte.
„Mir unbegreiflich! Ick würde niemals
darnach frage», ob eine katholisch oder lutherisch
ist!"
Dr. Daller besuchte die Barnum-Bai-
lep'sche Schaustellung und blieb geraume
Zeit vor dem Mann mit dem Ambo li-
sch ädcl stehen.
„Eine wahre Freude mit so einem Menschen!"
sagte er mit wohlwollendem Lächeln. „Der
wählt gewiß auch Zentrum!"
Crimen laesae majestatis
«9fen deutschen Reichstag, der — spät, vielleicht
zu spät — in wenigen Wochen zusammen-
treten wird, erwartet manche schwere Arbeit. Nicht
allein die Chinaexpedition wird seinem — wohl
nicht allzu strengen — Urtheile unterliegen. Es
mehren sich in Deutschland auch die Stimmen,
die eine Abschaffung oder Aenderung des Straf-
gesetzes über Majestätsbeleidigung fordern, des
8 95, der in weitesten Kreisen so große Verbreitung
gefunden hat, und man darf erwarten, daß sich
diese Stimmung in einen parlamentarischen Antrag
umsetzen wird. Die Forderung wird nicht allein
von der „vaterlandslosen Rotte" der zwei Millionen
socialistischen Wähler gestellt, denen der Paragraph
jede Entgegnung auf die ihnen so ungnädige kaiser-
liche Beredsamkeit unmöglich macht. Bis zu gemäßig-
ten Liberalen, die weit mehr gemäßigt als liberal sind,
wird der Antrag Zustimmung finden. Denn der
Druck, den die gegenwärtigen Zustände auf die
Freiheit der Meinungsäußerung nicht nur in der
Presse, sondern auch im Leben ausüben, beginnt
allmählich unerträglich zu werden.
Man erinnert sich wieder der unheimlichen
Actualität der Bebel'schen Citatc aus Tacitus und
erkennt beklomnien, daß in der wirksamen Rede
doch viel Wahrbeit war; schmerzlich empfindet man,
daß eine vom Richter erzwungene Loyalität des
deutschen Volkes unwürdig ist.
Der Begriff des crimen laesae majestatis,
in Roms schlimmster Despotenzeit entstanden, ent-
sprach niemals dem deutschen Volkscharakter.
Nicht als einen mit mystischen Weihen Begnadeten
und gottähnlich Entrückten denkt sich der Deutsche
seinen Herrscher, sondern als starken und tüchtigen
und besonnenen Führer. Grade weil er ihm im
Gemüth näher steht als jedes andere Volk seinem
Monarchen, wird er es nie als gerecht empfinden,
daß ein in Wohlmeinung gesprochenes Wort als
Verbrechen gestraft wird. Gegen groben Schiinpf
und tückische Verleumdung muß der Kaiser selbst-
verständlich geschützt werden wie jeder andere und
mehr wie jeder andere. Aber der Schutz vor
jedem Tadel, den die Praxis der deutschen Ge-
richte mit Unterstützung des Leipziger Reichsgerichtes
einzuführen beginnt, ist weder im Gesetze begründet
noch dauernd durchzuführen. Er paßt für einen
Monarchen, der sich der constitutionellen Schablone
fügt, sich damit begnügt, geräuschlos dem Staats-
wohle zu dienen und die Verantwortung dem
verantwortlichen Minister zu überlassen. Wilhelm
der Zweite ist anders geartet; er geht ohne „mini
sterielle Bekleidungsstücke" und die schwächliche
Greisengestalt Hohenlohes wäre auch kaum geeignet,
ihn zu verdecken. Die Unverantwortlichkeit des
Herrschers, eine Präsumption der constitutionellen
Monarchie, wird in Deutschland zur Fiktion; der
Schulsatz „I-s roi regne, ne gouverne pas“ ist
für das Hohcnzollernreich ein met von vorgestern.
Man mag sich ja dieser Thatkraft freuen, wenn man
sie — wie der größte Theil des deutschen Volkes
— für nützlich und erfolgreich hält; aber an der
Thatsnche ist nicht zu rütteln, daß man auf jede
Frage in Deutschland zuerst den Kaiser die Ant-
wort geben hört, daß er fortwährend Stellung
nimmt und so jeden, der in der Oeffeutlichkeit
wirkt, zwingt, zu ihm Stellung zu nehmen. Man
kann sich kaum mehr über irgend eine ernstere
Angelegenheit äußern — bei der Vielseitigkeit des
Kaisers gilt das nicht nur für die Politik —, ohne
irgend etwas, was er gesprochen hat, zu lohen
oder zu tadeln. Ein rechter Mann lobt nicht,
wenn er nicht weiß, daß er auch tadeln dürfte.
Der Tadel ist aber eben durch das Gesetz unmög-
lich gemacht. So entsteht, da das Ventil der
Kritik geschlossen ist, ein großer Druck auf die
Geister, der eine Erbitterung schafft, die kaum die
monarchischen Gefühle stärken wird. Schließlich
hat sich das deutsche Volk doch reif genug gezeigt,
um sich eine Unterbindung jeder ernsthaften polit-
ischen Diskussion nicht gefallen zu lassen. Dieser
Zustand aber erzeugt auch unfehlbar eine Art, in
Andeutungen zu sprechen und zu schreiben, die,
juristisch unfaßbar, doch jedem verständlich und
zehnmal vergifteter und gefährlicher sind als ein
offenes Wort. Die Anwälte des Staates leisten
mit den Anklagen weder dem Staate einen Dienst
noch dem Kaiser.
Auch dem Kaiser nicht. Es wäre eine wirk-
liche Majestätsbeleidigung, anzunehmen, daß der
Kaiser die Stimmung seines Volkes nicht kennen
wolle und für ihn das Wort gelte, das seinem
Ahnen, dem vierten Friedrich Wilhelm, in seinem
eigenen Schlosse von Johann Jakob» gesagt wurde
in sehr stürmischer Zeit: „Das ist immer das
Unglück der Könige, daß sie die Wahrheit nicht
hören wollen." Das hieße Eigensinn und Eitel
feit, die keinen Widerspruch verträgt und den
Widerstrebenden nicht überzeugen, sondern mit
roher Gewalt zwingen will, bei ihm voraussetzen;
und diese Annahme bleibe den Staatsanwälten
überlassen. Eher darf man wohl vermuthen, daß
s i e übereifrig und strebend bemüht sind. Allein
dieser Uebereifer ist keineswegs nur ein juristischer
Fehlgriff und eine private Angelegenheit jener,
die an seinen Folgen leiden. Die Meinungs-
freiheit ist eine der Grundlagen eines modernen
Culturstaates; rüttelt man an ihr, so wankt der
ganze Bau. Beschämend und empörend ist es
für den deutschen Publicisten wie für den deutschen
Bürger, wenn er in keiner Sache seines Volkes
ein ernstes Wort sprechen kann, ohne Gefahr zu
laufen, in den Maschen des Gesetzes, eine Beute
avancementslüsterner Staatsanwälte, zu zappeln.
Sehen nun aher die deutschen Bürger, daß der
Kaiser, wenn er über anders Gesinnte spricht, in
seiner temperamentvoll bewegten Weise sich keines-
wegs einen Zwang auflegt, so erhöht das ihre
Erbitterung und zeitigt in ihnen Gefühle, die sehr
verschieden von jenen sind, die das Hohcnzollern-
reich grob gemacht haben...
So wird also einer der ersten Anträge in der
neuen Session gewiß auf Streichung des, ganz
anderen Verhältnissen angepaßten, erimen laesae
majestatis gerichtet feilt. Am Erfolge muß man
allerdings zweifeln. Aber schon eine ernst und
entschieden geführte Debatte im Reichstage könnte
nützlich wirken und den Staatsanwälten ein wenig
Zurückhaltung, den Gerichten ein wenig Milde
lehren. Dann brauchte für Deutschland nicht mehr
Figaros messerscharfes Wort zu gelten: „Wenn
man den Geist nicht unterdrücken kann, rächt mau
sich durch Mißhandlungen an ihm.
Men, IS. Oktober Ludwig Bauer.
74?
Nr. 44
Der schwerste jfürst
preisend mit viel schönen Reden
Ihrer Körper Schwergewicht,
Gaben einst von Rom bis Schweden
Alle Herrschenden Bericht.
„Zweiundneunzig Kilo drücken
Dhne Sorge um verfall —
Sprach Don Larlos voll Entzücken —
Aus den Thron von Portugal."
„Mein Gewicht — rief mit Emphase
Ferdinand — ift laut Befund
Zmmer inklusive Rase
Hundertfünsundsiebzig Pfund."
„So, wie ich mich seht befinde,
Ries der deutsche Kaiser stramm,
Wieg ich — ohne Lchnurrbartbinde —
volle achtzig Kilogramm."
Rikolaus, der Freund vom Frieden,
Der von schmächtiger Figur,
Sprach: „Ich wiege gleich Sylphiden
Fünsundsünszig Kilo nur.
Ich bin leichter, als die meisten
von Luropens Herrschern sind,
Und beneide oft den feisten
Larlos, der Rekord gewinnt."
Und cs riefen laut die Mehrer
Ihrer Reiche frank und frei:
„Rikolaus, du wirst jetzt schwerer,
Denn du schluckst ... die Mandschurei "
Ist
Die „Grenz b oten" haben, seitdem Gustav
Frcyiag das Scepter niedergelegt, auf ihren Boten-
gängen schon oft die Grenzen des Erlaubten über-
schritten, aber eine solche Eselei, wie „Goethe
und der Goethebund" in ihrer Nr. 40 haben
sie noch nicht verbrochen. Noch nie ist die Igno-
ranz, jesuitische Verdrehungskuust und Größen-
wahnsinnigkeit des G oethepfaffenthuins so
frech in die Erscheinung getreten, wie in diesem
Versuch, den alten Geheimrath zu einer ultra-
montanen Excellenz ä la Windthorst zu stempeln:
wie kindisch das gemacht wird, erhellt aus dem
Satze, „daß wenn Goethe sein Weg auf der Rück-
reise durch Assisi geführt hätte, er au dem Grabe
des hl. Franziskus nicht vorübergegangen wäre."
Das ganze Geschmiere richtet sich unter obligaten
Verleumdungen gegen den Goethebund, der
sich bekanntlich den jungen Goethe zum Führer
gewählt hat, ohne den Geheimrath den älteren
Herren, die das werden möchten, irgendwie zu ver-
ulken. Aber das paßt den neidischen und ver-
logenen Strebern nicht: sie möchten am Liebsten
auch den Jungen in den katholischen Gesellen-
verein einpfarren.
Ist die Pfafferei schon bei den historischen Reli-
gionen etwas Trauriges, so wird sie im Gefolge des
größten Feindes aller Pfaffenwirthschaft zum wider-
lichen Zerrbild. Gottfried Keller sagt mit Recht: „es
existirt eine Art Muckcrthum im Goethekultus," und
sein darauf bezügliches Epigramm „Ein Goethe-
Philister" trifft den Nagel auf den Kopf:
Den mit trock'nen Erbsen angefülltcn Schädel
Taucht er jauchzend in des klaren Meeres Wellen,
Das man Goethe nennt; nun schauet achtsam,
Wie die Nähte platzen, wenn die Erbsen schwellen I
. J U GE N D .
Der neue Müarch
<är
Dr. Natili las in dev Zeitung, wie die
Intoleranz des Pfarrers Schlixferling zu dem
Breitengüßbachcr Mcincidsprozeß führte.
„Mir unbegreiflich! Ick würde niemals
darnach frage», ob eine katholisch oder lutherisch
ist!"
Dr. Daller besuchte die Barnum-Bai-
lep'sche Schaustellung und blieb geraume
Zeit vor dem Mann mit dem Ambo li-
sch ädcl stehen.
„Eine wahre Freude mit so einem Menschen!"
sagte er mit wohlwollendem Lächeln. „Der
wählt gewiß auch Zentrum!"
Crimen laesae majestatis
«9fen deutschen Reichstag, der — spät, vielleicht
zu spät — in wenigen Wochen zusammen-
treten wird, erwartet manche schwere Arbeit. Nicht
allein die Chinaexpedition wird seinem — wohl
nicht allzu strengen — Urtheile unterliegen. Es
mehren sich in Deutschland auch die Stimmen,
die eine Abschaffung oder Aenderung des Straf-
gesetzes über Majestätsbeleidigung fordern, des
8 95, der in weitesten Kreisen so große Verbreitung
gefunden hat, und man darf erwarten, daß sich
diese Stimmung in einen parlamentarischen Antrag
umsetzen wird. Die Forderung wird nicht allein
von der „vaterlandslosen Rotte" der zwei Millionen
socialistischen Wähler gestellt, denen der Paragraph
jede Entgegnung auf die ihnen so ungnädige kaiser-
liche Beredsamkeit unmöglich macht. Bis zu gemäßig-
ten Liberalen, die weit mehr gemäßigt als liberal sind,
wird der Antrag Zustimmung finden. Denn der
Druck, den die gegenwärtigen Zustände auf die
Freiheit der Meinungsäußerung nicht nur in der
Presse, sondern auch im Leben ausüben, beginnt
allmählich unerträglich zu werden.
Man erinnert sich wieder der unheimlichen
Actualität der Bebel'schen Citatc aus Tacitus und
erkennt beklomnien, daß in der wirksamen Rede
doch viel Wahrbeit war; schmerzlich empfindet man,
daß eine vom Richter erzwungene Loyalität des
deutschen Volkes unwürdig ist.
Der Begriff des crimen laesae majestatis,
in Roms schlimmster Despotenzeit entstanden, ent-
sprach niemals dem deutschen Volkscharakter.
Nicht als einen mit mystischen Weihen Begnadeten
und gottähnlich Entrückten denkt sich der Deutsche
seinen Herrscher, sondern als starken und tüchtigen
und besonnenen Führer. Grade weil er ihm im
Gemüth näher steht als jedes andere Volk seinem
Monarchen, wird er es nie als gerecht empfinden,
daß ein in Wohlmeinung gesprochenes Wort als
Verbrechen gestraft wird. Gegen groben Schiinpf
und tückische Verleumdung muß der Kaiser selbst-
verständlich geschützt werden wie jeder andere und
mehr wie jeder andere. Aber der Schutz vor
jedem Tadel, den die Praxis der deutschen Ge-
richte mit Unterstützung des Leipziger Reichsgerichtes
einzuführen beginnt, ist weder im Gesetze begründet
noch dauernd durchzuführen. Er paßt für einen
Monarchen, der sich der constitutionellen Schablone
fügt, sich damit begnügt, geräuschlos dem Staats-
wohle zu dienen und die Verantwortung dem
verantwortlichen Minister zu überlassen. Wilhelm
der Zweite ist anders geartet; er geht ohne „mini
sterielle Bekleidungsstücke" und die schwächliche
Greisengestalt Hohenlohes wäre auch kaum geeignet,
ihn zu verdecken. Die Unverantwortlichkeit des
Herrschers, eine Präsumption der constitutionellen
Monarchie, wird in Deutschland zur Fiktion; der
Schulsatz „I-s roi regne, ne gouverne pas“ ist
für das Hohcnzollernreich ein met von vorgestern.
Man mag sich ja dieser Thatkraft freuen, wenn man
sie — wie der größte Theil des deutschen Volkes
— für nützlich und erfolgreich hält; aber an der
Thatsnche ist nicht zu rütteln, daß man auf jede
Frage in Deutschland zuerst den Kaiser die Ant-
wort geben hört, daß er fortwährend Stellung
nimmt und so jeden, der in der Oeffeutlichkeit
wirkt, zwingt, zu ihm Stellung zu nehmen. Man
kann sich kaum mehr über irgend eine ernstere
Angelegenheit äußern — bei der Vielseitigkeit des
Kaisers gilt das nicht nur für die Politik —, ohne
irgend etwas, was er gesprochen hat, zu lohen
oder zu tadeln. Ein rechter Mann lobt nicht,
wenn er nicht weiß, daß er auch tadeln dürfte.
Der Tadel ist aber eben durch das Gesetz unmög-
lich gemacht. So entsteht, da das Ventil der
Kritik geschlossen ist, ein großer Druck auf die
Geister, der eine Erbitterung schafft, die kaum die
monarchischen Gefühle stärken wird. Schließlich
hat sich das deutsche Volk doch reif genug gezeigt,
um sich eine Unterbindung jeder ernsthaften polit-
ischen Diskussion nicht gefallen zu lassen. Dieser
Zustand aber erzeugt auch unfehlbar eine Art, in
Andeutungen zu sprechen und zu schreiben, die,
juristisch unfaßbar, doch jedem verständlich und
zehnmal vergifteter und gefährlicher sind als ein
offenes Wort. Die Anwälte des Staates leisten
mit den Anklagen weder dem Staate einen Dienst
noch dem Kaiser.
Auch dem Kaiser nicht. Es wäre eine wirk-
liche Majestätsbeleidigung, anzunehmen, daß der
Kaiser die Stimmung seines Volkes nicht kennen
wolle und für ihn das Wort gelte, das seinem
Ahnen, dem vierten Friedrich Wilhelm, in seinem
eigenen Schlosse von Johann Jakob» gesagt wurde
in sehr stürmischer Zeit: „Das ist immer das
Unglück der Könige, daß sie die Wahrheit nicht
hören wollen." Das hieße Eigensinn und Eitel
feit, die keinen Widerspruch verträgt und den
Widerstrebenden nicht überzeugen, sondern mit
roher Gewalt zwingen will, bei ihm voraussetzen;
und diese Annahme bleibe den Staatsanwälten
überlassen. Eher darf man wohl vermuthen, daß
s i e übereifrig und strebend bemüht sind. Allein
dieser Uebereifer ist keineswegs nur ein juristischer
Fehlgriff und eine private Angelegenheit jener,
die an seinen Folgen leiden. Die Meinungs-
freiheit ist eine der Grundlagen eines modernen
Culturstaates; rüttelt man an ihr, so wankt der
ganze Bau. Beschämend und empörend ist es
für den deutschen Publicisten wie für den deutschen
Bürger, wenn er in keiner Sache seines Volkes
ein ernstes Wort sprechen kann, ohne Gefahr zu
laufen, in den Maschen des Gesetzes, eine Beute
avancementslüsterner Staatsanwälte, zu zappeln.
Sehen nun aher die deutschen Bürger, daß der
Kaiser, wenn er über anders Gesinnte spricht, in
seiner temperamentvoll bewegten Weise sich keines-
wegs einen Zwang auflegt, so erhöht das ihre
Erbitterung und zeitigt in ihnen Gefühle, die sehr
verschieden von jenen sind, die das Hohcnzollern-
reich grob gemacht haben...
So wird also einer der ersten Anträge in der
neuen Session gewiß auf Streichung des, ganz
anderen Verhältnissen angepaßten, erimen laesae
majestatis gerichtet feilt. Am Erfolge muß man
allerdings zweifeln. Aber schon eine ernst und
entschieden geführte Debatte im Reichstage könnte
nützlich wirken und den Staatsanwälten ein wenig
Zurückhaltung, den Gerichten ein wenig Milde
lehren. Dann brauchte für Deutschland nicht mehr
Figaros messerscharfes Wort zu gelten: „Wenn
man den Geist nicht unterdrücken kann, rächt mau
sich durch Mißhandlungen an ihm.
Men, IS. Oktober Ludwig Bauer.
74?