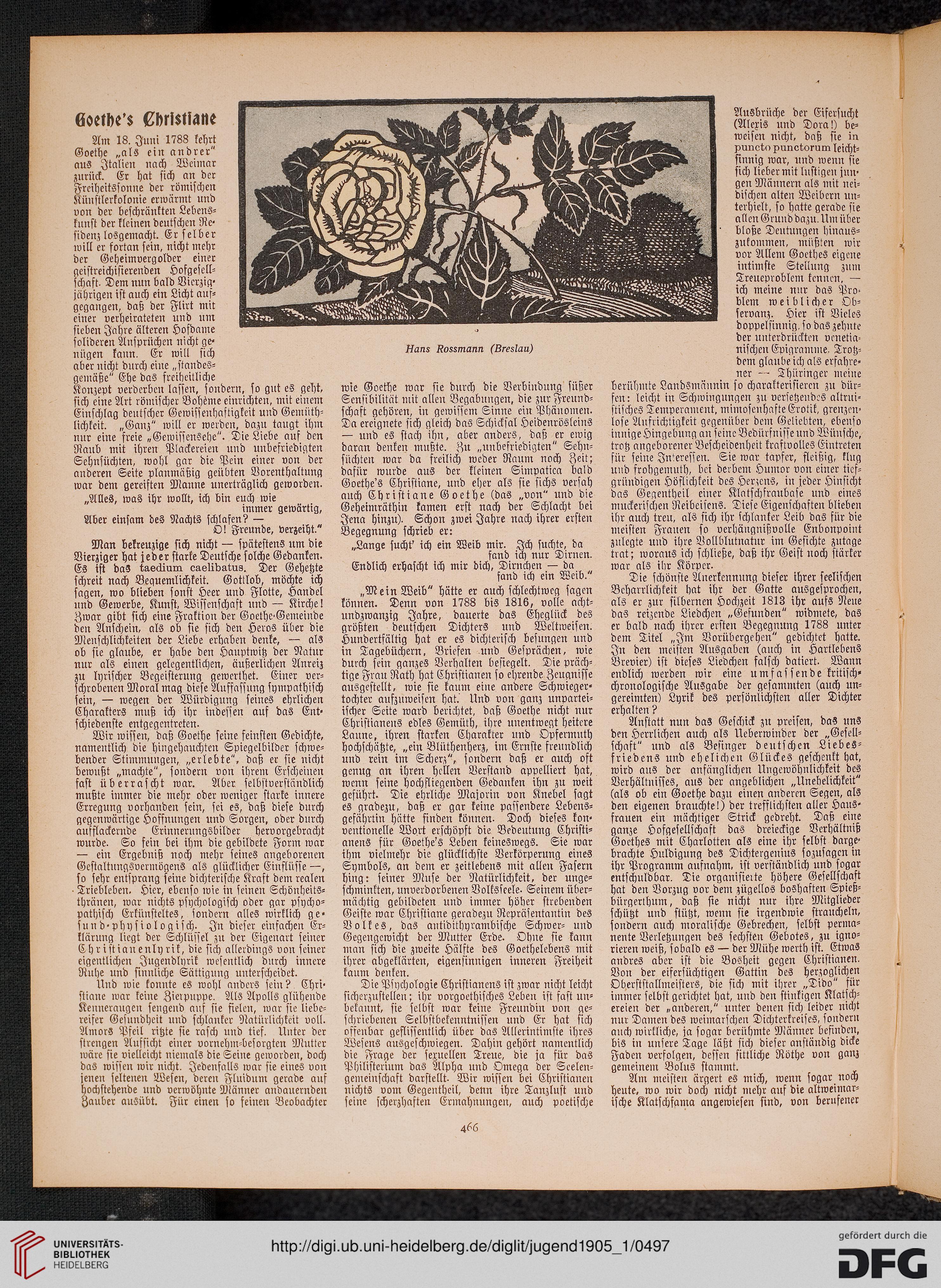Soetste's Christiane
Am 18. Juni 1788 kehrt
Goethe „als ein andrer"
aus Italien nach Weimar
zurück. Er hat sich an der
Frciheitssonne der römischen
Künstlerkolonie erwärmt und
von der beschränkten Lebens-
kunst der kleinen deutschen Re-
sidenz losgemacht. Er selber
will er fortan sein, nicht mehr
der Geheimvergolder einer
geistreichisierenden Hofgesell-
schaft. Dem nun bald Vierzig-
jährigen ist auch ein Licht auf-
gegangen, daß der Flirt mit
einer verheirateten und um
sieben Jahre älteren Hofdame
solideren Ansprüchen nicht ge-
nügen kann. Er will sich
aber nicht durch eine „standes-
gemäße" Ehe das freiheitliche
Konzept verderben lassen, sondern, so gut es geht,
sich eine Art römischer Bohime einrichten, mit einem
Einschlag deutscher Gewissenhaftigkeit und Gemüth-
lichkeit. „Ganz" will er werden, dazu taugt ihm
nur eine freie „Gewissensehe". Die Liebe^ ans den
Raub mit ihren Plackereien und unbefriedigten
Sehnsüchten, wohl gar die Pein einer von der
anderen Seite planmäßig geübten Vorenthaltung
war dem gereiften Manne unerträglich geworden.
„Alles, was ihr wollt, ich bin euch wie
immer gewärtig,
Aber einsam des Nachts schlafen? —
O! Freunde, verzeiht."
Man bekreuzige sich nicht — spätestens um die
Vierziger hat jeder starke Deutsche solche Gedanken.
Es ist daS taedium caelibatus. Der Gehetzte
schreit nach Bequemlichkeit. Gotilob, möchte ich
sagen, wo blieben sonst Heer und Flotte, Handel
und Gewerbe, Kunst, Wissenschaft und — Kirche!
Zwar gibt sich eine Fraktion der Goethe-Gemeinde
den Anschein, als ob sie sich den Heros über die
Menschlichkeiten der Liebe erhaben denke, — als
ob sie glaube, er habe den Hauptwitz der Natur
nur als einen gelegentlichen, äußerlichen Anreiz
zu lyrischer Begeisterung gewerthet. Einer ver-
schrobenen Moral mag diese Auffassung sympathisch
sein, — wegen der Würdigung seines ehrlichen
Charakters muß ich ihr indessen auf das Ent-
schiedenste entgegentreten.
Wir wissen, daß Goethe seine feinsten Gedichte,
namentlich die hingehanchtcn Spiegelbilder schwe-
bender Stimmungen, „erlebte", daß er sie nicht
bewußt „machte", sondern von ihrem Erscheinen
fast überrascht war. Aber selbstverständlich
mußte immer die mehr oder weniger starke innere
Erregung vorhanden sein, sei es, daß diese durch
gegenwärtige Hoffnungen und Sorgen, oder durch
ansflackernde Erinnerungsbilder hervorgebracht
wurde. So fein bei ihm die gebildete Form war
— ein Ergebniß noch mehr seines angeborenen
Gestaltungsvermögens als glücklicher Einflüsse—,
so sehr entsprang seine dichterische Kraft dem realen
Trieblcben. Hier, ebenso wie in seinen Schönheits-
thränen, war nichts psychologisch oder gar psycho-
pathisch Erkünsteltes, sondern alles wirklich ge-
sund-physiologisch.^ In dieser einfachen Er-
klärung liegt der Schlüssel zu der Eigenart seiner
Christianenlyrik, die sich allerdings von seiner
eigentlichen Jugendlyrik wesentlich durch innere
Ruhe und sinnliche Sättigung unterscheidet.
Und wie konnte es wohl anders sein? Chri-
stiane war keine Zierpuppe. Als Apolls glühende
Kenneraugen sengend auf sie sielen, war sie liebe-
reifer Gesundheit und schlanker Natürlichkeit voll.
Amors Pfeil ritzte sie rasch und tief. Unter der
strengen Aufsicht einer vornehm-besorgten Mutter
wäre sie vielleicht niemals die Seine geworden, doch
das wissen wir nicht. Jedenfalls war sie eines von
jenen seltenen Wesen, deren Fluidum gerade auf
hochstehende und verwöhnte Männer andauernden
Zauber ausübt. Für einen so feinen Beobachter
wie Goethe war sie durch die Verbindung süßer
Sensibilität mit allen Begabungen, die zur Freund-
schaft gehören, in gewissem Sinne ein Phänomen.
Da ereignete sich gleich das Schicksal Heidenrösleins
— und es stach ihn, aber anders, daß er eivig
daran denken mußte. Zu „unbefriedigten" Sehn-
süchten war da freilich weder Raum noch Zeit;
dafür wurde aus der kleinen Simpatica bald
Goethe's Christiane, und eher als sie sichs versah
auch Christiane Goethe (das „von" und die
Geheimräthin kamen erst nach der Schlacht bei
Jena hinzu). Schon zwei Jahre nach ihrer ersten
Begegnung schrieb er:
„Lange sucht' ich ein Weib mir. Ich suchte, da
fand ich nur Dirnen.
Endlich erhascht ich mir dich, Dirnchen — da
fand ich ein Weib."
„Mein Weib" hätte er auch schlechtweg sagen
können. Denn von 1788 bis 1816, volle acht-
nndzwanzig Jahre, dauerte das Eheglück des
größten deutschen Dichters und Weltweisen.
Hundertfältig hat er es dichterisch besungen und
in Tagebüchern. Briefen und Gesprächen, wie
durch sein ganzes Verhalten besiegelt. Die präch-
tige Frau Rath hat Christianen so ehrende Zeugnisse
ausgestellt, wie sie kaum eine andere Schwieger-
tochter aufznweiscn hat. Und von ganz unpartei-
ischer Seite ward berichtet, daß Goethe nicht nur
Christianens edles Gemüth, ihre unentwegt heitere
Laune, ihren starken Charakter und Opfermuth
hochschätzte, „ein Blüthenherz, im Ernste freundlich
und rein im Scherz", sondern daß er auch oft
genug an ihren Hellen Verstand appelliert hat,
wenn seine hochfliegendcn Gedanken ihn zu weit
geführt. Die ehrliche Majorin von Knebel sagt
es gradezu, daß er gar keine passendere Lebens-
gefährtin hätte finden können. Doch dieses kon-
ventionelle Wort erschöpft die Bedeutung Christi-
anens für Goethe's Leben keineswegs. Sie war
ihm vielmehr die glücklichste Verkörperung eines
Symbols, an dem er zeitlebens mit allen Fasern
hing: seiner Muse der Natürlichkeit, der unge-
schminkten, unverdorbenen Volksseele- Seinem über-
mächtig gebildeten und immer höher strebenden
Geiste war Christiane geradezu Repräsentantin des
Volkes, das antidithyrambische Schwer- und
Gegengewicht der Mutter Erde. Ohne sie kann
man sich die zweite Hälfte des Goethelebens mit
ihrer abgeklärten, eigensinnigen inneren Freiheit
kaum denken.
Die Psychologie Christianens ist zwar nicht leicht
sicherzustellen: ihr vorgoethisches Leben ist fast un-
bekannt, sie selbst war keine Freundin von ge-
schriebenen Selbstbekenntnissen und Er hat sich
offenbar geflissentlich über das Allerintimste ihres
Wesens ausgeschwiegen. Dahin gehört namentlich
die Frage der sexuellen Treue, die ja für das
Philisterium das Alpha und Omega der Scelen-
gemeinschaft darstellt. Wir wissen bei Christianen
nichts vom Gegenthcil, denn ihre Tanzlust und
seine scherzhaften Ermahnungen, auch poetische
Ausbrüche der Eifersucht
(Alexis und Dora!) be-
weisen nicht, daß sie in
puncto punctorum leicht-
sinnig war, und wenn sie
sich lieber mit lustigen jun-
gen Männern als mit nei-
dischen alten Weibern un-
terhielt, so hatte gerade sie
allen Grund dazu. Um über
bloße Deutungen hinaus-
zukommen, müßten wir
vor Allem Goethes eigene
intimste Stellung zum
Treueproblem kennen, —
ich meine nur das Pro-
blem weiblicher Ob-
servanz. Hier ist Vieles
doppelsinnig, so das zehnte
der unterdrückten venezia-
nischen Epigramme. Trotz-
dem glaubeich als erfahre-
ner — Thüringer meine
berühmte Landsmännin so charakterisieren zu dür-
fen: leicht in Schwingungen zu versetzendes altrui-
stisches Temperament, mimosenhafte Erotik, grenzen-
lose Aufrichtigkeit gegenüber dem Geliebten, ebenso
innige Hingebung an seine Bedürfnisse und Wünsche,
trotz angeborener Bescheidenheit kraftvolles Eintreten
für feine Interessen. Sie war tapfer, fleißig, klug
und frohgemuth, bei derbem Humor von einer tief-
gründigen Höflichkeit des Herzens, in jeder Hinsicht
das Gegentheil einer Klatschfraubase und eines
muckerischen Reibeisens. Diese Eigenschaften blieben
ihr auch treu, als sich ihr schlanker Leib das für die
meisten Frauen so vcrhängnißvolle Enbonpoint
zulcgte und ihre Vollblutnatnr im Gesichte zutage
trat; woraus ich schließe, daß ihr Geist noch stärker
war als ihr Körper.
Die schönste Anerkennung dieser ihrer seelischen
Beharrlichkeit hat ihr der Gatte ausgesprochen,
als er zur silbernen Hochzeit 1813 ihr aufs Neue
das reizende Liedchen „Gefunden" widmete, das
er bald nach ihrer ersten Begegnung 1788 unter
dem Titel „Im Vorübergehen" gedichtet hatte.
In den meisten Ausgaben (auch in Hartlebcns
Brevier) ist dieses Liedchen falsch datiert. Wann
endlich werden wir eine umfassende kritisch-
chronologische Ausgabe der gesummten (auch un-
gereimten) Lyrik des persönlichsten aller Dichter
erhalten?
Anstatt nun das Geschick zu preisen, da? uns
den Herrlichen auch als Ueberwinder der „Gesell-
schaft" und als Besingcr deutschen Liebes-
friedcns und ehelichen Glückes geschenkt hat,
wird ans der anfänglichen Ungewöhnlichkeit des
Verhältnisses, aus der angeblichen „Unehelichkeit"
(als ob ein Goethe dazu einen anderen Segen, als
den eigenen brauchte!) der trefflichsten aller Haus-
frauen ein mächtiger Strick gedreht. Daß eine
ganze Hofgesellschaft das dreieckige Vcrhältniß
Goethes mit Charlotten als eine ihr selbst darge-
brachte Huldigung des Dichtergenius sozusagen in
ihr Programm anfnahm, ist verständlich und sogar
entschuldbar. Tie organisieUe höhere Gesellschaft
hat den Vorzug vor dem zügellos boshaften Spieß-
bürgerlhnm, daß sie nicht nur ihre Mitglieder
schützt und stützt, wenn sie irgendwie straucheln,
sondern auch moralische Gebrechen, selbst perma-
nente Verletzungen des sechsten Gebotes, zu igno-
rieren weiß, sobald es — der Mühe werth ist. Etwas
andres aber ist die Bosheit gegen Christianen.
Von der eifersüchtigen Gattin des herzoglichen
Oberststallmeisters, die sich mit ihrer „Dido" für
immer selbst gerichtet hat, und den stinkigen Klatsch-
ereien der „anderen," unter denen sich leider nicht
nur Damen des weimarschen Dichterkreises, sondern
auch wirkliche, ja sogar berühmte Männer befinden,
bis in unsere Tage läßt sich dieser anständig dicke
Faden verfolgen, dessen sittliche Röthe von ganz
gemeinem Bolus stammt.
Am meisten ärgert es mich, wenn sogar noch
heute, wo wir doch nicht niehr auf die altweimar-
ische Klatschfama angewiesen sind, von berufener
Am 18. Juni 1788 kehrt
Goethe „als ein andrer"
aus Italien nach Weimar
zurück. Er hat sich an der
Frciheitssonne der römischen
Künstlerkolonie erwärmt und
von der beschränkten Lebens-
kunst der kleinen deutschen Re-
sidenz losgemacht. Er selber
will er fortan sein, nicht mehr
der Geheimvergolder einer
geistreichisierenden Hofgesell-
schaft. Dem nun bald Vierzig-
jährigen ist auch ein Licht auf-
gegangen, daß der Flirt mit
einer verheirateten und um
sieben Jahre älteren Hofdame
solideren Ansprüchen nicht ge-
nügen kann. Er will sich
aber nicht durch eine „standes-
gemäße" Ehe das freiheitliche
Konzept verderben lassen, sondern, so gut es geht,
sich eine Art römischer Bohime einrichten, mit einem
Einschlag deutscher Gewissenhaftigkeit und Gemüth-
lichkeit. „Ganz" will er werden, dazu taugt ihm
nur eine freie „Gewissensehe". Die Liebe^ ans den
Raub mit ihren Plackereien und unbefriedigten
Sehnsüchten, wohl gar die Pein einer von der
anderen Seite planmäßig geübten Vorenthaltung
war dem gereiften Manne unerträglich geworden.
„Alles, was ihr wollt, ich bin euch wie
immer gewärtig,
Aber einsam des Nachts schlafen? —
O! Freunde, verzeiht."
Man bekreuzige sich nicht — spätestens um die
Vierziger hat jeder starke Deutsche solche Gedanken.
Es ist daS taedium caelibatus. Der Gehetzte
schreit nach Bequemlichkeit. Gotilob, möchte ich
sagen, wo blieben sonst Heer und Flotte, Handel
und Gewerbe, Kunst, Wissenschaft und — Kirche!
Zwar gibt sich eine Fraktion der Goethe-Gemeinde
den Anschein, als ob sie sich den Heros über die
Menschlichkeiten der Liebe erhaben denke, — als
ob sie glaube, er habe den Hauptwitz der Natur
nur als einen gelegentlichen, äußerlichen Anreiz
zu lyrischer Begeisterung gewerthet. Einer ver-
schrobenen Moral mag diese Auffassung sympathisch
sein, — wegen der Würdigung seines ehrlichen
Charakters muß ich ihr indessen auf das Ent-
schiedenste entgegentreten.
Wir wissen, daß Goethe seine feinsten Gedichte,
namentlich die hingehanchtcn Spiegelbilder schwe-
bender Stimmungen, „erlebte", daß er sie nicht
bewußt „machte", sondern von ihrem Erscheinen
fast überrascht war. Aber selbstverständlich
mußte immer die mehr oder weniger starke innere
Erregung vorhanden sein, sei es, daß diese durch
gegenwärtige Hoffnungen und Sorgen, oder durch
ansflackernde Erinnerungsbilder hervorgebracht
wurde. So fein bei ihm die gebildete Form war
— ein Ergebniß noch mehr seines angeborenen
Gestaltungsvermögens als glücklicher Einflüsse—,
so sehr entsprang seine dichterische Kraft dem realen
Trieblcben. Hier, ebenso wie in seinen Schönheits-
thränen, war nichts psychologisch oder gar psycho-
pathisch Erkünsteltes, sondern alles wirklich ge-
sund-physiologisch.^ In dieser einfachen Er-
klärung liegt der Schlüssel zu der Eigenart seiner
Christianenlyrik, die sich allerdings von seiner
eigentlichen Jugendlyrik wesentlich durch innere
Ruhe und sinnliche Sättigung unterscheidet.
Und wie konnte es wohl anders sein? Chri-
stiane war keine Zierpuppe. Als Apolls glühende
Kenneraugen sengend auf sie sielen, war sie liebe-
reifer Gesundheit und schlanker Natürlichkeit voll.
Amors Pfeil ritzte sie rasch und tief. Unter der
strengen Aufsicht einer vornehm-besorgten Mutter
wäre sie vielleicht niemals die Seine geworden, doch
das wissen wir nicht. Jedenfalls war sie eines von
jenen seltenen Wesen, deren Fluidum gerade auf
hochstehende und verwöhnte Männer andauernden
Zauber ausübt. Für einen so feinen Beobachter
wie Goethe war sie durch die Verbindung süßer
Sensibilität mit allen Begabungen, die zur Freund-
schaft gehören, in gewissem Sinne ein Phänomen.
Da ereignete sich gleich das Schicksal Heidenrösleins
— und es stach ihn, aber anders, daß er eivig
daran denken mußte. Zu „unbefriedigten" Sehn-
süchten war da freilich weder Raum noch Zeit;
dafür wurde aus der kleinen Simpatica bald
Goethe's Christiane, und eher als sie sichs versah
auch Christiane Goethe (das „von" und die
Geheimräthin kamen erst nach der Schlacht bei
Jena hinzu). Schon zwei Jahre nach ihrer ersten
Begegnung schrieb er:
„Lange sucht' ich ein Weib mir. Ich suchte, da
fand ich nur Dirnen.
Endlich erhascht ich mir dich, Dirnchen — da
fand ich ein Weib."
„Mein Weib" hätte er auch schlechtweg sagen
können. Denn von 1788 bis 1816, volle acht-
nndzwanzig Jahre, dauerte das Eheglück des
größten deutschen Dichters und Weltweisen.
Hundertfältig hat er es dichterisch besungen und
in Tagebüchern. Briefen und Gesprächen, wie
durch sein ganzes Verhalten besiegelt. Die präch-
tige Frau Rath hat Christianen so ehrende Zeugnisse
ausgestellt, wie sie kaum eine andere Schwieger-
tochter aufznweiscn hat. Und von ganz unpartei-
ischer Seite ward berichtet, daß Goethe nicht nur
Christianens edles Gemüth, ihre unentwegt heitere
Laune, ihren starken Charakter und Opfermuth
hochschätzte, „ein Blüthenherz, im Ernste freundlich
und rein im Scherz", sondern daß er auch oft
genug an ihren Hellen Verstand appelliert hat,
wenn seine hochfliegendcn Gedanken ihn zu weit
geführt. Die ehrliche Majorin von Knebel sagt
es gradezu, daß er gar keine passendere Lebens-
gefährtin hätte finden können. Doch dieses kon-
ventionelle Wort erschöpft die Bedeutung Christi-
anens für Goethe's Leben keineswegs. Sie war
ihm vielmehr die glücklichste Verkörperung eines
Symbols, an dem er zeitlebens mit allen Fasern
hing: seiner Muse der Natürlichkeit, der unge-
schminkten, unverdorbenen Volksseele- Seinem über-
mächtig gebildeten und immer höher strebenden
Geiste war Christiane geradezu Repräsentantin des
Volkes, das antidithyrambische Schwer- und
Gegengewicht der Mutter Erde. Ohne sie kann
man sich die zweite Hälfte des Goethelebens mit
ihrer abgeklärten, eigensinnigen inneren Freiheit
kaum denken.
Die Psychologie Christianens ist zwar nicht leicht
sicherzustellen: ihr vorgoethisches Leben ist fast un-
bekannt, sie selbst war keine Freundin von ge-
schriebenen Selbstbekenntnissen und Er hat sich
offenbar geflissentlich über das Allerintimste ihres
Wesens ausgeschwiegen. Dahin gehört namentlich
die Frage der sexuellen Treue, die ja für das
Philisterium das Alpha und Omega der Scelen-
gemeinschaft darstellt. Wir wissen bei Christianen
nichts vom Gegenthcil, denn ihre Tanzlust und
seine scherzhaften Ermahnungen, auch poetische
Ausbrüche der Eifersucht
(Alexis und Dora!) be-
weisen nicht, daß sie in
puncto punctorum leicht-
sinnig war, und wenn sie
sich lieber mit lustigen jun-
gen Männern als mit nei-
dischen alten Weibern un-
terhielt, so hatte gerade sie
allen Grund dazu. Um über
bloße Deutungen hinaus-
zukommen, müßten wir
vor Allem Goethes eigene
intimste Stellung zum
Treueproblem kennen, —
ich meine nur das Pro-
blem weiblicher Ob-
servanz. Hier ist Vieles
doppelsinnig, so das zehnte
der unterdrückten venezia-
nischen Epigramme. Trotz-
dem glaubeich als erfahre-
ner — Thüringer meine
berühmte Landsmännin so charakterisieren zu dür-
fen: leicht in Schwingungen zu versetzendes altrui-
stisches Temperament, mimosenhafte Erotik, grenzen-
lose Aufrichtigkeit gegenüber dem Geliebten, ebenso
innige Hingebung an seine Bedürfnisse und Wünsche,
trotz angeborener Bescheidenheit kraftvolles Eintreten
für feine Interessen. Sie war tapfer, fleißig, klug
und frohgemuth, bei derbem Humor von einer tief-
gründigen Höflichkeit des Herzens, in jeder Hinsicht
das Gegentheil einer Klatschfraubase und eines
muckerischen Reibeisens. Diese Eigenschaften blieben
ihr auch treu, als sich ihr schlanker Leib das für die
meisten Frauen so vcrhängnißvolle Enbonpoint
zulcgte und ihre Vollblutnatnr im Gesichte zutage
trat; woraus ich schließe, daß ihr Geist noch stärker
war als ihr Körper.
Die schönste Anerkennung dieser ihrer seelischen
Beharrlichkeit hat ihr der Gatte ausgesprochen,
als er zur silbernen Hochzeit 1813 ihr aufs Neue
das reizende Liedchen „Gefunden" widmete, das
er bald nach ihrer ersten Begegnung 1788 unter
dem Titel „Im Vorübergehen" gedichtet hatte.
In den meisten Ausgaben (auch in Hartlebcns
Brevier) ist dieses Liedchen falsch datiert. Wann
endlich werden wir eine umfassende kritisch-
chronologische Ausgabe der gesummten (auch un-
gereimten) Lyrik des persönlichsten aller Dichter
erhalten?
Anstatt nun das Geschick zu preisen, da? uns
den Herrlichen auch als Ueberwinder der „Gesell-
schaft" und als Besingcr deutschen Liebes-
friedcns und ehelichen Glückes geschenkt hat,
wird ans der anfänglichen Ungewöhnlichkeit des
Verhältnisses, aus der angeblichen „Unehelichkeit"
(als ob ein Goethe dazu einen anderen Segen, als
den eigenen brauchte!) der trefflichsten aller Haus-
frauen ein mächtiger Strick gedreht. Daß eine
ganze Hofgesellschaft das dreieckige Vcrhältniß
Goethes mit Charlotten als eine ihr selbst darge-
brachte Huldigung des Dichtergenius sozusagen in
ihr Programm anfnahm, ist verständlich und sogar
entschuldbar. Tie organisieUe höhere Gesellschaft
hat den Vorzug vor dem zügellos boshaften Spieß-
bürgerlhnm, daß sie nicht nur ihre Mitglieder
schützt und stützt, wenn sie irgendwie straucheln,
sondern auch moralische Gebrechen, selbst perma-
nente Verletzungen des sechsten Gebotes, zu igno-
rieren weiß, sobald es — der Mühe werth ist. Etwas
andres aber ist die Bosheit gegen Christianen.
Von der eifersüchtigen Gattin des herzoglichen
Oberststallmeisters, die sich mit ihrer „Dido" für
immer selbst gerichtet hat, und den stinkigen Klatsch-
ereien der „anderen," unter denen sich leider nicht
nur Damen des weimarschen Dichterkreises, sondern
auch wirkliche, ja sogar berühmte Männer befinden,
bis in unsere Tage läßt sich dieser anständig dicke
Faden verfolgen, dessen sittliche Röthe von ganz
gemeinem Bolus stammt.
Am meisten ärgert es mich, wenn sogar noch
heute, wo wir doch nicht niehr auf die altweimar-
ische Klatschfama angewiesen sind, von berufener