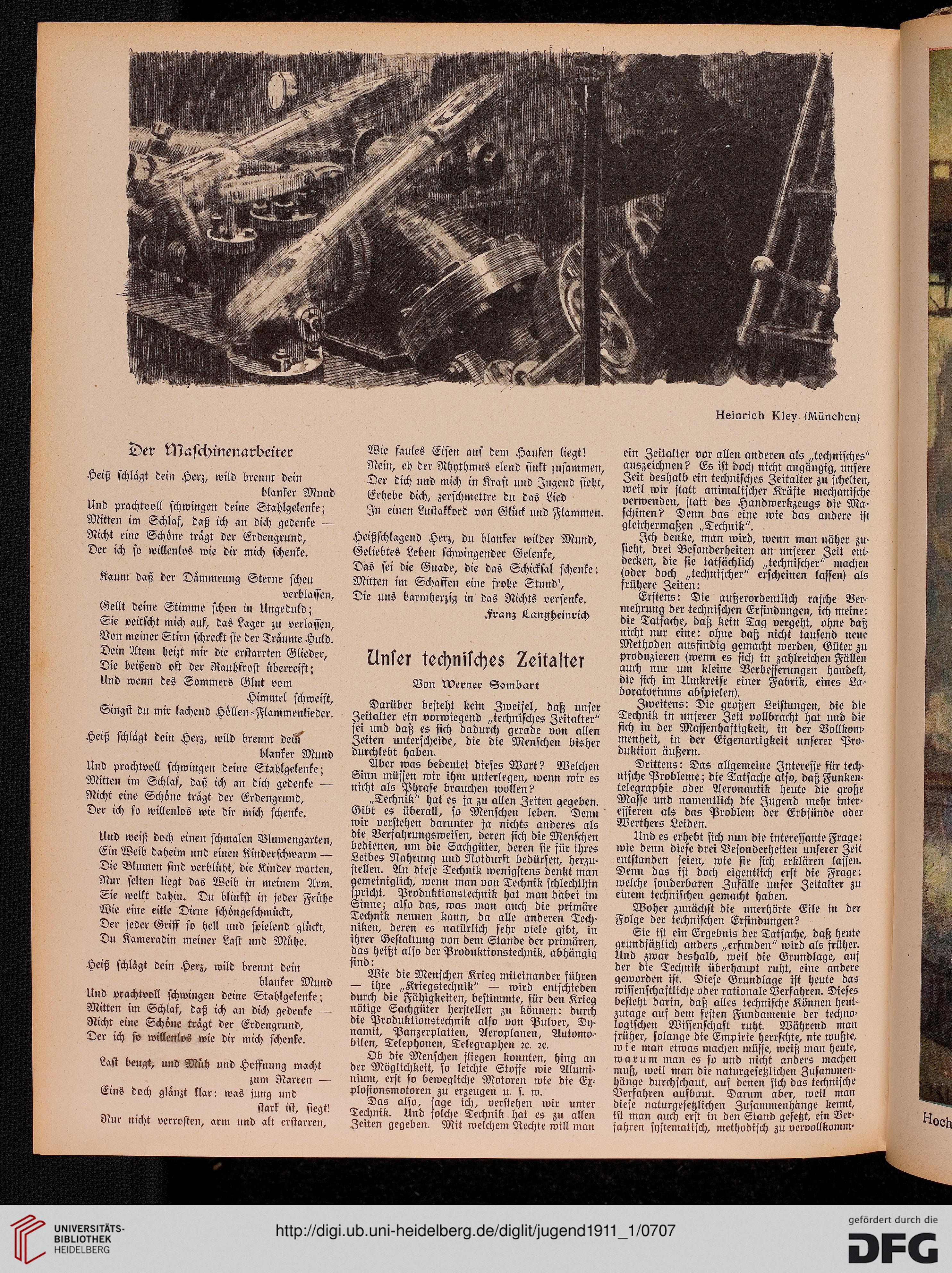Heinrich Kley (München)
Der Maschinenarbeiten
Heiß schlägt dein Herz, wild brennt dein
blanker Mund
Und prachtvoll schwingen deine Stahlgelenke;
Mitten im Schlaf, daß ich an dich gedenke —
Nicht eine Schöne tragt der Erdengrund,
Der ich so willenlos wie dir mich schenke.
Kaum daß der Dammrung Sterne scheu
verblassen,
Gellt deine Stimme schon in Ungeduld;
Sie peitscht mich auf, das Lager zu verlassen,
Von meiner Stirn schreckt sie der Träume Huld.
Dein Atem heizt mir die erstarrten Glieder,
Die beißend oft der Rauhfrost überreift;
Und wenn des Sommers Glut vom
Himmel schweift,
Singst du mir lachend Höllen-Flammenlieder.
Heiß schlägt dein Herz, wild brennt betlf
blanker Mund
Und prachtvoll schwingen deine Stahlgelenke;
Mitten im Schlaf, daß ich an dich gedenke —
Nicht eine Schöne trägt der Erdengrund,
Der ich so willenlos wie dir mich schenke.
Und weiß doch einen schmalen Blumengarten,
Ein Weib daheim und einen Kinderschwarm —
Die Blumen sind verblüht, die Kinder warten,
Nur selten liegt das Weib in meinem Arm.
Sie welkt dahin. Du blinkst in jeder Frühe
Wie eine eitle Dirne schöngeschmückt.
Der jeder Griff so hell und spielend glückt,
Du Kameradin meiner Last und Mühe.
Heiß schlägt dein Herz, wild brennt dein
blanker Mund
Und prachtvoll schwingen deine Stahlgelenke;
Mitten im Schlaf, daß ich an dich gedenke —
Nicht eine Schöne trägt der Erdengrund,
Der ich so willenlos wie dir mich schenke.
Last beugt, und Müh und Hoffnung macht
zum Narren —
Eins doch glänzt klar: was jung und
stark ist, siegt!
Nur nicht verrosten, arm und alt erstarren,
Wie faules Eisen auf dem Haufen liegt!
Nein, eh der Rhythmus elend sinkt zusammen,
Der dich und mich in Kraft und Jugend sieht,
Erhebe dich, zerschmettre du das Lied
In einen Lustakkord von Glück und Flammen.
Heißschlagend Herz, du blanker wilder Mund,
Geliebtes Leben schwingender Gelenke,
Das sei die Gnade, die das Schicksal schenke:
Mitten im Schaffen eine frohe Stund',
Die uns barmherzig in das Nichts versenke.
Franz Langheinrich
Unter technischer Zeitalter
Von Wentel1 Sombart
Darüber besteht kein Zweifel, daß unser
Zeitalter ein vorwiegend „technisches Zeitalter"
sei und daß es sich dadurch gerade von allen
Zeiten unterscheide, die die Menschen bisher
durchlebt haben.
Aber was bedeutet dieses Wort? Welchen
Sinn müssen wir ihm unterlegen, wenn wir es
nicht als Phrase brauchen wollen?
„Technik" hat es ja zu allen Zeiten gegeben.
Gibt es überall, so Menschen leben. Denn
wir verstehen darunter ja nichts anderes als
die Verfahrungsweisen, deren sich die Menschen
bedienen, um die Sachgüter, deren sie für ihres
Leibes Nahrung und Notdurft bedürfen, herzu-
stellen. An diese Technik wenigstens denkt man
gemeiniglich, wenn man von Technik schlechthin
spricht. Produktionstechnik hat man dabei im
Sinne; also das, was man auch die primäre
Technik nennen kann, da alle anderen Tech-
niken, deren es natürlich sehr viele gibt, in
ihrer Gestaltung von dem Stande der primären,
das heißt also der Produktionstechnik, abhängig
sind:
Wie die Menschen Krieg miteinander führen
— ihre „Kriegstechnik" — wird entschieden
durch die Fähigkeiten, bestimmte, für den Krieg
nötige Sachgüter Herstellen zu können: durch
die Produktionstechnik also von Pulver, Dy-
namit, Panzerplatten, Aeroplanen, Automo-
bilen, Telephonen, Telegraphen re. re.
Ob die Menschen fliegen konnten, hing an
der Möglichkeit, so leichte Stoffe wie Alumi-
nium, erst so bewegliche Motoren wie die Ex-
plosionsmotoren zu erzeugen u. s. w.
Das also, sage ich, verstehen wir unter
Technik. Und solche Technik hat es zu allen
Zeiten gegeben. Mit welchem Rechte will man
ein Zeitalter vor allen anderen als „technisches"
auszeichnen? Es ist doch nicht angängig, unsere
Zeit deshalb ein technisches Zeitalter zu schelten,
weil wir statt animalischer Kräfte mechanische
verwenden, statt des Handwerkzeugs die Ma-
schinen? Denn das eine wie das andere ist
gleichermaßen „Technik".
Ich denke, man wird, wenn man näher zu-
sieht, drei Besonderheiten an unserer Zeit ent-
decken, die sie tatsächlich „technischer" machen
(oder doch „technischer" erscheinen lassen) als
frühere Zeiten:
Erstens: Die außerordentlich rasche Ver-
mehrung der technischen Erfindungen, ich meine:
die Tatsache, daß kein Tag vergeht, ohne daß
nicht nur eine: ohne daß nicht tausend neue
Methoden ausfindig gemacht werden, Güter zu
produzieren (wenn es sich in zahlreichen Fällen
auch nur um kleine Verbesserungen handelt,
die sich im Umkreise einer Fabrik, eines La-
boratoriums abspielen).
Zweitens: Die großen Leistungen, die die
Technik in unserer Zeit vollbracht hat und die
sich in der Massenhaftigkeit, in der Vollkom-
menheit, in der Eigenartigkeit unserer Pro-
duktion äußern.
Drittens: Das allgemeine Interesse für tech-
nische Probleme; die Tatsache also, daß Funken-
telegraphie oder Aeronautik heute die große
Masse und namentlich die Jugend mehr inter-
essieren als das Problem der Erbsünde oder
Werthers Leiden.
Und es erhebt sich nun die interessante Frage:
wie denn diese drei Besonderheiten unserer Zeit
entstanden seien, wie sie sich erklären lassen.
Denn das ist doch eigentlich erst die Frage:
welche sonderbaren Zufälle unser Zeitalter zu
einem technischen gemacht haben.
Woher zunächst die unerhörte Eile in der
Folge der technischen Erfindungen?
Sie ist ein Ergebnis der Tatsache, daß heute
grundsätzlich anders „erfunden" wird als früher.
Und zwar deshalb, weil die Grundlage, auf
der die Technik überhaupt ruht, eine andere
geworden ist. Diese Grundlage ist heute das
wissenschaftliche oder rationale Verfahren. Dieses
besteht darin, daß alles technische Können heut-
zutage auf dem festen Fundamente der techno-
logischen Wissenschaft ruht. Während man
früher, solange die Empirie herrschte, nie wußte,
w i e man etwas machen müsse, weiß man heute,
warum man es so und nicht anders machen
muß, weil man die naturgesetzlichen Zusammen-
hänge durchschaut, auf denen sich das technische
Verfahren aufbaut. Darum aber, weil man
diese naturgesetzlichen Zusammenhänge kennt,
ist man auch erst in den Stand gesetzt, ein Ver-
fahren systematisch, methodisch zu vervollkomm-
Der Maschinenarbeiten
Heiß schlägt dein Herz, wild brennt dein
blanker Mund
Und prachtvoll schwingen deine Stahlgelenke;
Mitten im Schlaf, daß ich an dich gedenke —
Nicht eine Schöne tragt der Erdengrund,
Der ich so willenlos wie dir mich schenke.
Kaum daß der Dammrung Sterne scheu
verblassen,
Gellt deine Stimme schon in Ungeduld;
Sie peitscht mich auf, das Lager zu verlassen,
Von meiner Stirn schreckt sie der Träume Huld.
Dein Atem heizt mir die erstarrten Glieder,
Die beißend oft der Rauhfrost überreift;
Und wenn des Sommers Glut vom
Himmel schweift,
Singst du mir lachend Höllen-Flammenlieder.
Heiß schlägt dein Herz, wild brennt betlf
blanker Mund
Und prachtvoll schwingen deine Stahlgelenke;
Mitten im Schlaf, daß ich an dich gedenke —
Nicht eine Schöne trägt der Erdengrund,
Der ich so willenlos wie dir mich schenke.
Und weiß doch einen schmalen Blumengarten,
Ein Weib daheim und einen Kinderschwarm —
Die Blumen sind verblüht, die Kinder warten,
Nur selten liegt das Weib in meinem Arm.
Sie welkt dahin. Du blinkst in jeder Frühe
Wie eine eitle Dirne schöngeschmückt.
Der jeder Griff so hell und spielend glückt,
Du Kameradin meiner Last und Mühe.
Heiß schlägt dein Herz, wild brennt dein
blanker Mund
Und prachtvoll schwingen deine Stahlgelenke;
Mitten im Schlaf, daß ich an dich gedenke —
Nicht eine Schöne trägt der Erdengrund,
Der ich so willenlos wie dir mich schenke.
Last beugt, und Müh und Hoffnung macht
zum Narren —
Eins doch glänzt klar: was jung und
stark ist, siegt!
Nur nicht verrosten, arm und alt erstarren,
Wie faules Eisen auf dem Haufen liegt!
Nein, eh der Rhythmus elend sinkt zusammen,
Der dich und mich in Kraft und Jugend sieht,
Erhebe dich, zerschmettre du das Lied
In einen Lustakkord von Glück und Flammen.
Heißschlagend Herz, du blanker wilder Mund,
Geliebtes Leben schwingender Gelenke,
Das sei die Gnade, die das Schicksal schenke:
Mitten im Schaffen eine frohe Stund',
Die uns barmherzig in das Nichts versenke.
Franz Langheinrich
Unter technischer Zeitalter
Von Wentel1 Sombart
Darüber besteht kein Zweifel, daß unser
Zeitalter ein vorwiegend „technisches Zeitalter"
sei und daß es sich dadurch gerade von allen
Zeiten unterscheide, die die Menschen bisher
durchlebt haben.
Aber was bedeutet dieses Wort? Welchen
Sinn müssen wir ihm unterlegen, wenn wir es
nicht als Phrase brauchen wollen?
„Technik" hat es ja zu allen Zeiten gegeben.
Gibt es überall, so Menschen leben. Denn
wir verstehen darunter ja nichts anderes als
die Verfahrungsweisen, deren sich die Menschen
bedienen, um die Sachgüter, deren sie für ihres
Leibes Nahrung und Notdurft bedürfen, herzu-
stellen. An diese Technik wenigstens denkt man
gemeiniglich, wenn man von Technik schlechthin
spricht. Produktionstechnik hat man dabei im
Sinne; also das, was man auch die primäre
Technik nennen kann, da alle anderen Tech-
niken, deren es natürlich sehr viele gibt, in
ihrer Gestaltung von dem Stande der primären,
das heißt also der Produktionstechnik, abhängig
sind:
Wie die Menschen Krieg miteinander führen
— ihre „Kriegstechnik" — wird entschieden
durch die Fähigkeiten, bestimmte, für den Krieg
nötige Sachgüter Herstellen zu können: durch
die Produktionstechnik also von Pulver, Dy-
namit, Panzerplatten, Aeroplanen, Automo-
bilen, Telephonen, Telegraphen re. re.
Ob die Menschen fliegen konnten, hing an
der Möglichkeit, so leichte Stoffe wie Alumi-
nium, erst so bewegliche Motoren wie die Ex-
plosionsmotoren zu erzeugen u. s. w.
Das also, sage ich, verstehen wir unter
Technik. Und solche Technik hat es zu allen
Zeiten gegeben. Mit welchem Rechte will man
ein Zeitalter vor allen anderen als „technisches"
auszeichnen? Es ist doch nicht angängig, unsere
Zeit deshalb ein technisches Zeitalter zu schelten,
weil wir statt animalischer Kräfte mechanische
verwenden, statt des Handwerkzeugs die Ma-
schinen? Denn das eine wie das andere ist
gleichermaßen „Technik".
Ich denke, man wird, wenn man näher zu-
sieht, drei Besonderheiten an unserer Zeit ent-
decken, die sie tatsächlich „technischer" machen
(oder doch „technischer" erscheinen lassen) als
frühere Zeiten:
Erstens: Die außerordentlich rasche Ver-
mehrung der technischen Erfindungen, ich meine:
die Tatsache, daß kein Tag vergeht, ohne daß
nicht nur eine: ohne daß nicht tausend neue
Methoden ausfindig gemacht werden, Güter zu
produzieren (wenn es sich in zahlreichen Fällen
auch nur um kleine Verbesserungen handelt,
die sich im Umkreise einer Fabrik, eines La-
boratoriums abspielen).
Zweitens: Die großen Leistungen, die die
Technik in unserer Zeit vollbracht hat und die
sich in der Massenhaftigkeit, in der Vollkom-
menheit, in der Eigenartigkeit unserer Pro-
duktion äußern.
Drittens: Das allgemeine Interesse für tech-
nische Probleme; die Tatsache also, daß Funken-
telegraphie oder Aeronautik heute die große
Masse und namentlich die Jugend mehr inter-
essieren als das Problem der Erbsünde oder
Werthers Leiden.
Und es erhebt sich nun die interessante Frage:
wie denn diese drei Besonderheiten unserer Zeit
entstanden seien, wie sie sich erklären lassen.
Denn das ist doch eigentlich erst die Frage:
welche sonderbaren Zufälle unser Zeitalter zu
einem technischen gemacht haben.
Woher zunächst die unerhörte Eile in der
Folge der technischen Erfindungen?
Sie ist ein Ergebnis der Tatsache, daß heute
grundsätzlich anders „erfunden" wird als früher.
Und zwar deshalb, weil die Grundlage, auf
der die Technik überhaupt ruht, eine andere
geworden ist. Diese Grundlage ist heute das
wissenschaftliche oder rationale Verfahren. Dieses
besteht darin, daß alles technische Können heut-
zutage auf dem festen Fundamente der techno-
logischen Wissenschaft ruht. Während man
früher, solange die Empirie herrschte, nie wußte,
w i e man etwas machen müsse, weiß man heute,
warum man es so und nicht anders machen
muß, weil man die naturgesetzlichen Zusammen-
hänge durchschaut, auf denen sich das technische
Verfahren aufbaut. Darum aber, weil man
diese naturgesetzlichen Zusammenhänge kennt,
ist man auch erst in den Stand gesetzt, ein Ver-
fahren systematisch, methodisch zu vervollkomm-