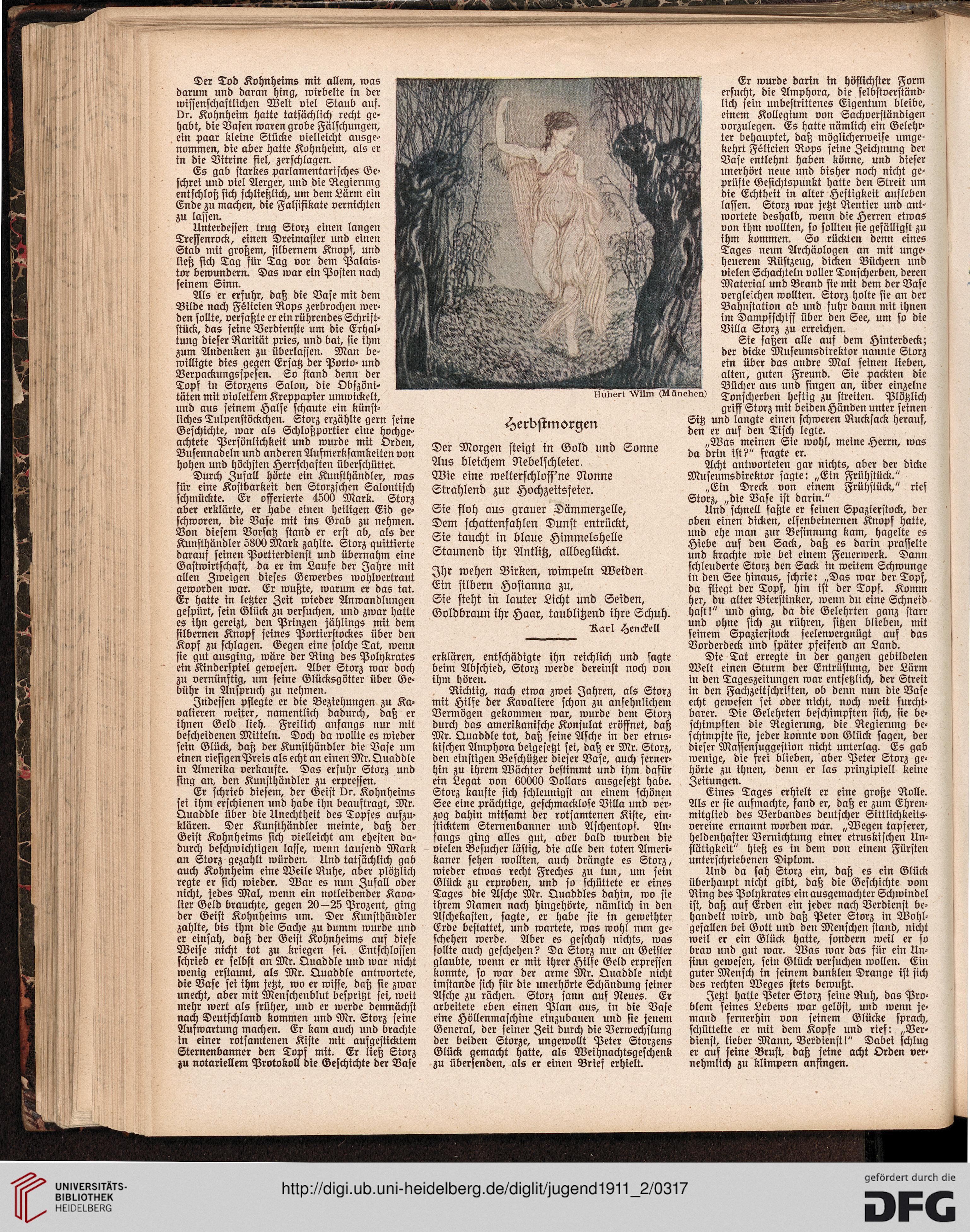Der Tod Kohnheims mit allem, was
darum und daran hing, wirbelte in der
wissenschaftlichen Welt viel Staub auf.
Or. Kohnheim hatte tatsächlich recht ge-
habt, die Vasen waren grobe Fälschungen,
ein paar kleine Stücke vielleicht ausge-
nommen, die aber hatte Kohnheim, als er
in die Vitrine fiel, zerschlagen.
Es gab starkes parlamentarisches Ge-
schrei und viel Aerger, und die Regierung
entschloß sich schließlich, um dem Lärm ein
Ende zu machen, die Falsifikate vernichten
zu lassen.
Unterdessen trug Storz einen langen
Tressenrock, einen Dreimaster und einen
Stab mit großem, silbernem Knopf, und
ließ sich Tag für Tag vor dem Palais-
tor bewundern. Das war ein Posten nach
seinem Sinn.
Als er erfuhr, daß die Vase mit dem
Bilde nach Fslicien Rops zerbrochen wer-
den sollte, verfaßte er ein rührendes Schrift-
stück, das seine Verdienste um die Erhal-
tung dieser Rarität pries, und bat, sie ihm
zum Andenken zu überlassen. Man be-
willigte dies gegen Ersatz der Porto- und
Verpackungsspesen. So stand denn der
Topf in Storzens Salon, die Obszöni-
täten mit violettem Kreppapier umwickelt,
und aus seinem Halse schaute ein künst-
liches Tulpenstöckchen. Storz erzählte gern seine
Geschichte, war als Schloßportier eine hochge-
achtete Persönlichkeit und wurde mit Orden,
Busennadeln und anderen Aufmerksamkeiten von
hohen und höchsten Herrschaften überschüttet.
Durch Zufall hörte ein Kunsthändler, was
für eine Kostbarkeit den Storzschen Salontisch
schmückte. Er offerierte 4500 Mark. Storz
aber erklärte, er habe einen heiligen Eid ge-
schworen, die Vase mit ins Grab zu nehmen.
Von diesem Vorsatz stand er erst ab, als der
Kunsthändler 5800 Mark zahlte. Storz quittierte
darauf seinen Portierdienst und übernahm eine
Gastwirtschaft, da er im Laufe der Jahre mit
allen Zweigen dieses Gewerbes wohlvertraut
geworden war. Er wußte, warum er das tat.
Er hatte in letzter Zeit wieder Anwandlungen
gespürt, sein Glück zu versuchen, und zwar hatte
es ihn gereizt, den Prinzen jählings mit dem
silbernen Knopf seines Portierstockes über den
Kopf zu schlagen. Gegen eine solche Tat, wenn
sie gut ausging, wäre der Ring des Polykrates
ein Kinderspiel gewesen. Aber Storz war doch
zu vernünftig, um seine Glücksgötter über Ge-
bühr in Anspruch zu nehmen.
Indessen pflegte er die Beziehungen zu Ka-
valieren weiter, namentlich dadurch, daß er
ihnen Geld lieh. Freilich anfangs nur mit
bescheidenen Mitteln. Doch da wollte es wieder
sein Glück, daß der Kunsthändler die Vase um
einen riesigen Preis als echt an einen Mr. Quaddle
in Amerika verkaufte. Das erfuhr Storz und
fing an, den Kunsthändler zu erpressen.
Er schrieb diesem, der Geist Or. Kohnheims
sei ihm erschienen und habe ihn beauftragt, Mr.
Quaddle über die Unechtheit des Topfes aufzu-
klären. Der Kunsthändler meinte, daß der
Geist Kohnheims sich vielleicht am ehesten da-
durch beschwichtigen lasse, wenn tausend Mark
an Storz gezahlt würden. Und tatsächlich gab
auch Kohnheim eine Weile Ruhe, aber plötzlich
regte er sich wieder. War es nun Zufall oder
nicht, jedes Mal, wenn ein notleidender Kava-
lier Geld brauchte, gegen 20—25 Prozent, ging
der Geist Kohnheims um. Der Kunsthändler
zahlte, bis ihm die Sache zu dumm wurde und
er einsah, daß der Geist Kohnheims auf diese
Weise nicht tot zu kriegen sei. Entschlossen
schrieb er selbst an Mr. Quaddle und war nicht
wenig erstaunt, als Mr. Quaddle antwortete,
die Vase sei ihm jetzt, wo er wisse, daß sie zwar
unecht, aber mit Menschenblut bespritzt sei, weit
mehr wert als früher, und er werde demnächst
nach Deutschland kommen und Mr. Storz seine
Aufwartung machen. Er kam auch und brachte
in einer rotsamtenen Kiste mit aufgesticktem
Sternenbanner den Topf mit. Er ließ Storz
zu notariellem Protokoll die Geschichte der Vase
Herdstmorgen
Der Morgen steigt in Gold und Sonne
Aus bleichem Nebelschleier.
Wie eine welterschloss'ne Nonne
Strahlend zur Hochzeitsfeier.
Sie floh aus grauer Dämmerzelle,
Dem schattenfahlen Dunst entrückt,
Sie taucht in blaue Himmelshelle
Staunend ihr Antlitz, allbeglückt.
Ihr wehen Birken, Wimpeln Weiden
Ein silbern Hosianna zu.
Sie steht in lauter Licht und Seiden,
Goldbraun ihr Haar, taublitzend ihre Schuh.
Rarl Henckell
erklären, entschädigte ihn reichlich und sagte
beim Abschied, Storz werde dereinst noch von
ihm hören.
Richtig, nach etwa zwei Jahren, als Storz
mit Hilfe der Kavaliere schon zu ansehnlichem
Vermögen gekommen war, wurde dem Storz
durch das amerikanische Konsulat eröffnet, daß
Mr. Quaddle tot, daß seine Asche in der etrus-
kischen Amphora beigesetzt sei, daß er Mr. Storz,
den einstigen Beschützer dieser Vase, auch ferner-
hin zu ihrem Wächter bestimmt und ihm dafür
ein Legat von 60000 Dollars ausgesetzt habe.
Storz kaufte sich schleunigst an einem schönen
See eine prächtige, geschmacklose Villa und ver-
zog dahin mitsamt der rotsamtenen Kiste, ein-
sticktem Sternenbanner und Aschentopf. An-
fangs ging alles gut, aber bald wurden die
vielen Besucher lästig, die alle den toten Ameri-
kaner sehen wollten, auch drängte es Storz,
wieder etwas recht Freches zu tun, um sein
Glück zu erproben, und so schüttete er eines
Tages die Asche Mr. Quaddles dahin, wo sie
ihrem Namen nach hingehörte, nämlich in den
Aschekasten, sagte, er habe sie in geweihter
Erde bestattet, und wartete, was wohl nun ge-
schehen werde. Aber es geschah nichts, was
sollte auch geschehen? Da Storz nur an Geister
glaubte, wenn er mit ihrer Hilfe Geld erpressen
konnte, so war der arme Mr. Quaddle nicht
imstande sich für die unerhörte Schändung seiner
Asche zu rächen. Storz sann auf Neues. Er
arbeitete eben einen Plan aus, in die Vase
eine Höllenmaschine einzubauen und sie jenem
General, der seiner Zeit durch die Verwechslung
der beiden Storze, ungewollt Peter Storzens
Glück gemacht hatte, als Weihnachtsgeschenk
zu übersenden, als er einen Brief erhielt.
Er wurde darin in höflichster Form
ersucht, die Amphora, die selbstverständ-
lich sein unbestrittenes Eigentum bleibe,
einem Kollegium von Sachverständigen
vorzulegen. Es hatte nämlich ein Gelehr-
ter behauptet, daß möglicherweise umge-
kehrt Fslicien Rops seine Zeichnung der
Vase entlehnt haben könne, und dieser
unerhört neue und bisher noch nicht ge-
prüfte Gesichtspunkt hatte den Streit um
die Echtheit in alter Heftigkeit aufleben
lassen. Storz war jetzt Rentier und ant-
wortete deshalb, wenn die Herren etwas
von ihm wollten, so sollten sie gefälligst zu
ihm kommen. So rückten denn eines
Tages neun Archäologen an mit unge-
heuerem Rüstzeug, dicken Büchern und
vielen Schachteln voller Tonscherben, deren
Material und Brand sie mit dem der Vase
vergleichen wollten. Storz holte sie an der
Bahnstation ab und fuhr dann mit ihnen
im Dampfschiff über den See, um so die
Villa Storz zu erreichen.
Sie saßen alle auf dem Hinterdeck;
der dicke Museumsdirektor nannte Storz
ein über das andre Mal seinen lieben,
alten, guten Freund. Sie packten die
Bücher aus und fingen an, über einzelne
Tonscherben heftig zu streiten. Plötzlich
griff Storz mit beiden Händen unter seinen
Sitz und langte einen schweren Rucksack herauf,
den er auf den Tisch legte.
„Was meinen Sie wohl, meine Herrn, was
da drin ist?" fragte er.
Acht antworteten gar nichts, aber der dicke
Museumsdirektor sagte: „Ein Frühstück."
„Ein Dreck von einem Frühstück," ries
Storz, „die Vase ist darin."
Und schnell faßte er seinen Spazierstock, der
oben einen dicken, elfenbeinernen Knopf hatte,
und ehe man zur Besinnung kam, hagelte es
Hiebe auf den Sack, daß es darin prasselte
und krachte wie bei einem Feuerwerk. Dann
schleuderte Storz den Sack in weitem Schwünge
in den See hinaus, schrie: „Das war der Topf,
da fliegt der Topf, hin ist der Topf. Komm
her, du alter Bierstinker, wenn du eine Schneid
hast!" und ging, da die Gelehrten ganz starr
und ohne sich zu rühren, sitzen blieben, mit
seinem Spazierstock seelenvergnügt auf das
Vorderdeck und später pfeifend an Land.
Die Tat erregte in der ganzen gebildeten
Welt einen Sturm der Entrüstung, der Lärm
in den Tageszeitungen war entsetzlich, der Streit
in den Fachzeitschriften, ob denn nun die Vase
echt gewesen sei oder nicht, noch weit furcht-
barer. Die Gelehrten beschimpften sich, sie be-
schimpften die Regierung, die Regierung be-
schimpfte sie, jeder konnte von Glück sagen, der
dieser Massensuggestion nicht unterlag. Es gab
wenige, die frei blieben, aber Peter Storz ge-
hörte zu ihnen, denn er las prinzipiell keine
Zeitungen.
Eines Tages erhielt er eine große Rolle.
Als er sie aufmachte, fand er, daß er zum Ehren-
mitglied des Verbandes deutscher Sittlichkeits-
vereine ernannt worden war. „Wegen tapferer,
heldenhafter Vernichtung einer etruskischen Un-
flätigkeit" hieß es in dem von einem Fürsten
unterschriebenen Diplom.
Und da sah Storz ein, daß es ein Glück
überhaupt nicht gibt, daß die Geschichte vom
Ring des Polpkrates ein ausgemachter Schwindel
ist, daß auf Erden ein jeder nach Verdienst be-
handelt wird, und daß Peter Storz in Wohl-
gefallen bei Gott und den Menschen stand, nicht
weil er ein Glück hatte, sondern weil er so
brav und gut war. Was war das für ein Un-
sinn gewesen, sein Glück versuchen wollen. Ein
guter Mensch in seinem dunklen Drange ist sich
des rechten Weges stets bewußt.
Jetzt hatte Peter Storz seine Ruh, das Pro-
blem seines Lebens war gelöst, und wenn je-
mand fernerhin von seinem Glücke sprach,
schüttelte er mit dem Kopfe und rief: „Ver-
dienst, lieber Mann, Verdienst!" Dabei schlug
er auf seine Brust, daß seine acht Orden ver-
nehmlich zu klimpern anfingen.
darum und daran hing, wirbelte in der
wissenschaftlichen Welt viel Staub auf.
Or. Kohnheim hatte tatsächlich recht ge-
habt, die Vasen waren grobe Fälschungen,
ein paar kleine Stücke vielleicht ausge-
nommen, die aber hatte Kohnheim, als er
in die Vitrine fiel, zerschlagen.
Es gab starkes parlamentarisches Ge-
schrei und viel Aerger, und die Regierung
entschloß sich schließlich, um dem Lärm ein
Ende zu machen, die Falsifikate vernichten
zu lassen.
Unterdessen trug Storz einen langen
Tressenrock, einen Dreimaster und einen
Stab mit großem, silbernem Knopf, und
ließ sich Tag für Tag vor dem Palais-
tor bewundern. Das war ein Posten nach
seinem Sinn.
Als er erfuhr, daß die Vase mit dem
Bilde nach Fslicien Rops zerbrochen wer-
den sollte, verfaßte er ein rührendes Schrift-
stück, das seine Verdienste um die Erhal-
tung dieser Rarität pries, und bat, sie ihm
zum Andenken zu überlassen. Man be-
willigte dies gegen Ersatz der Porto- und
Verpackungsspesen. So stand denn der
Topf in Storzens Salon, die Obszöni-
täten mit violettem Kreppapier umwickelt,
und aus seinem Halse schaute ein künst-
liches Tulpenstöckchen. Storz erzählte gern seine
Geschichte, war als Schloßportier eine hochge-
achtete Persönlichkeit und wurde mit Orden,
Busennadeln und anderen Aufmerksamkeiten von
hohen und höchsten Herrschaften überschüttet.
Durch Zufall hörte ein Kunsthändler, was
für eine Kostbarkeit den Storzschen Salontisch
schmückte. Er offerierte 4500 Mark. Storz
aber erklärte, er habe einen heiligen Eid ge-
schworen, die Vase mit ins Grab zu nehmen.
Von diesem Vorsatz stand er erst ab, als der
Kunsthändler 5800 Mark zahlte. Storz quittierte
darauf seinen Portierdienst und übernahm eine
Gastwirtschaft, da er im Laufe der Jahre mit
allen Zweigen dieses Gewerbes wohlvertraut
geworden war. Er wußte, warum er das tat.
Er hatte in letzter Zeit wieder Anwandlungen
gespürt, sein Glück zu versuchen, und zwar hatte
es ihn gereizt, den Prinzen jählings mit dem
silbernen Knopf seines Portierstockes über den
Kopf zu schlagen. Gegen eine solche Tat, wenn
sie gut ausging, wäre der Ring des Polykrates
ein Kinderspiel gewesen. Aber Storz war doch
zu vernünftig, um seine Glücksgötter über Ge-
bühr in Anspruch zu nehmen.
Indessen pflegte er die Beziehungen zu Ka-
valieren weiter, namentlich dadurch, daß er
ihnen Geld lieh. Freilich anfangs nur mit
bescheidenen Mitteln. Doch da wollte es wieder
sein Glück, daß der Kunsthändler die Vase um
einen riesigen Preis als echt an einen Mr. Quaddle
in Amerika verkaufte. Das erfuhr Storz und
fing an, den Kunsthändler zu erpressen.
Er schrieb diesem, der Geist Or. Kohnheims
sei ihm erschienen und habe ihn beauftragt, Mr.
Quaddle über die Unechtheit des Topfes aufzu-
klären. Der Kunsthändler meinte, daß der
Geist Kohnheims sich vielleicht am ehesten da-
durch beschwichtigen lasse, wenn tausend Mark
an Storz gezahlt würden. Und tatsächlich gab
auch Kohnheim eine Weile Ruhe, aber plötzlich
regte er sich wieder. War es nun Zufall oder
nicht, jedes Mal, wenn ein notleidender Kava-
lier Geld brauchte, gegen 20—25 Prozent, ging
der Geist Kohnheims um. Der Kunsthändler
zahlte, bis ihm die Sache zu dumm wurde und
er einsah, daß der Geist Kohnheims auf diese
Weise nicht tot zu kriegen sei. Entschlossen
schrieb er selbst an Mr. Quaddle und war nicht
wenig erstaunt, als Mr. Quaddle antwortete,
die Vase sei ihm jetzt, wo er wisse, daß sie zwar
unecht, aber mit Menschenblut bespritzt sei, weit
mehr wert als früher, und er werde demnächst
nach Deutschland kommen und Mr. Storz seine
Aufwartung machen. Er kam auch und brachte
in einer rotsamtenen Kiste mit aufgesticktem
Sternenbanner den Topf mit. Er ließ Storz
zu notariellem Protokoll die Geschichte der Vase
Herdstmorgen
Der Morgen steigt in Gold und Sonne
Aus bleichem Nebelschleier.
Wie eine welterschloss'ne Nonne
Strahlend zur Hochzeitsfeier.
Sie floh aus grauer Dämmerzelle,
Dem schattenfahlen Dunst entrückt,
Sie taucht in blaue Himmelshelle
Staunend ihr Antlitz, allbeglückt.
Ihr wehen Birken, Wimpeln Weiden
Ein silbern Hosianna zu.
Sie steht in lauter Licht und Seiden,
Goldbraun ihr Haar, taublitzend ihre Schuh.
Rarl Henckell
erklären, entschädigte ihn reichlich und sagte
beim Abschied, Storz werde dereinst noch von
ihm hören.
Richtig, nach etwa zwei Jahren, als Storz
mit Hilfe der Kavaliere schon zu ansehnlichem
Vermögen gekommen war, wurde dem Storz
durch das amerikanische Konsulat eröffnet, daß
Mr. Quaddle tot, daß seine Asche in der etrus-
kischen Amphora beigesetzt sei, daß er Mr. Storz,
den einstigen Beschützer dieser Vase, auch ferner-
hin zu ihrem Wächter bestimmt und ihm dafür
ein Legat von 60000 Dollars ausgesetzt habe.
Storz kaufte sich schleunigst an einem schönen
See eine prächtige, geschmacklose Villa und ver-
zog dahin mitsamt der rotsamtenen Kiste, ein-
sticktem Sternenbanner und Aschentopf. An-
fangs ging alles gut, aber bald wurden die
vielen Besucher lästig, die alle den toten Ameri-
kaner sehen wollten, auch drängte es Storz,
wieder etwas recht Freches zu tun, um sein
Glück zu erproben, und so schüttete er eines
Tages die Asche Mr. Quaddles dahin, wo sie
ihrem Namen nach hingehörte, nämlich in den
Aschekasten, sagte, er habe sie in geweihter
Erde bestattet, und wartete, was wohl nun ge-
schehen werde. Aber es geschah nichts, was
sollte auch geschehen? Da Storz nur an Geister
glaubte, wenn er mit ihrer Hilfe Geld erpressen
konnte, so war der arme Mr. Quaddle nicht
imstande sich für die unerhörte Schändung seiner
Asche zu rächen. Storz sann auf Neues. Er
arbeitete eben einen Plan aus, in die Vase
eine Höllenmaschine einzubauen und sie jenem
General, der seiner Zeit durch die Verwechslung
der beiden Storze, ungewollt Peter Storzens
Glück gemacht hatte, als Weihnachtsgeschenk
zu übersenden, als er einen Brief erhielt.
Er wurde darin in höflichster Form
ersucht, die Amphora, die selbstverständ-
lich sein unbestrittenes Eigentum bleibe,
einem Kollegium von Sachverständigen
vorzulegen. Es hatte nämlich ein Gelehr-
ter behauptet, daß möglicherweise umge-
kehrt Fslicien Rops seine Zeichnung der
Vase entlehnt haben könne, und dieser
unerhört neue und bisher noch nicht ge-
prüfte Gesichtspunkt hatte den Streit um
die Echtheit in alter Heftigkeit aufleben
lassen. Storz war jetzt Rentier und ant-
wortete deshalb, wenn die Herren etwas
von ihm wollten, so sollten sie gefälligst zu
ihm kommen. So rückten denn eines
Tages neun Archäologen an mit unge-
heuerem Rüstzeug, dicken Büchern und
vielen Schachteln voller Tonscherben, deren
Material und Brand sie mit dem der Vase
vergleichen wollten. Storz holte sie an der
Bahnstation ab und fuhr dann mit ihnen
im Dampfschiff über den See, um so die
Villa Storz zu erreichen.
Sie saßen alle auf dem Hinterdeck;
der dicke Museumsdirektor nannte Storz
ein über das andre Mal seinen lieben,
alten, guten Freund. Sie packten die
Bücher aus und fingen an, über einzelne
Tonscherben heftig zu streiten. Plötzlich
griff Storz mit beiden Händen unter seinen
Sitz und langte einen schweren Rucksack herauf,
den er auf den Tisch legte.
„Was meinen Sie wohl, meine Herrn, was
da drin ist?" fragte er.
Acht antworteten gar nichts, aber der dicke
Museumsdirektor sagte: „Ein Frühstück."
„Ein Dreck von einem Frühstück," ries
Storz, „die Vase ist darin."
Und schnell faßte er seinen Spazierstock, der
oben einen dicken, elfenbeinernen Knopf hatte,
und ehe man zur Besinnung kam, hagelte es
Hiebe auf den Sack, daß es darin prasselte
und krachte wie bei einem Feuerwerk. Dann
schleuderte Storz den Sack in weitem Schwünge
in den See hinaus, schrie: „Das war der Topf,
da fliegt der Topf, hin ist der Topf. Komm
her, du alter Bierstinker, wenn du eine Schneid
hast!" und ging, da die Gelehrten ganz starr
und ohne sich zu rühren, sitzen blieben, mit
seinem Spazierstock seelenvergnügt auf das
Vorderdeck und später pfeifend an Land.
Die Tat erregte in der ganzen gebildeten
Welt einen Sturm der Entrüstung, der Lärm
in den Tageszeitungen war entsetzlich, der Streit
in den Fachzeitschriften, ob denn nun die Vase
echt gewesen sei oder nicht, noch weit furcht-
barer. Die Gelehrten beschimpften sich, sie be-
schimpften die Regierung, die Regierung be-
schimpfte sie, jeder konnte von Glück sagen, der
dieser Massensuggestion nicht unterlag. Es gab
wenige, die frei blieben, aber Peter Storz ge-
hörte zu ihnen, denn er las prinzipiell keine
Zeitungen.
Eines Tages erhielt er eine große Rolle.
Als er sie aufmachte, fand er, daß er zum Ehren-
mitglied des Verbandes deutscher Sittlichkeits-
vereine ernannt worden war. „Wegen tapferer,
heldenhafter Vernichtung einer etruskischen Un-
flätigkeit" hieß es in dem von einem Fürsten
unterschriebenen Diplom.
Und da sah Storz ein, daß es ein Glück
überhaupt nicht gibt, daß die Geschichte vom
Ring des Polpkrates ein ausgemachter Schwindel
ist, daß auf Erden ein jeder nach Verdienst be-
handelt wird, und daß Peter Storz in Wohl-
gefallen bei Gott und den Menschen stand, nicht
weil er ein Glück hatte, sondern weil er so
brav und gut war. Was war das für ein Un-
sinn gewesen, sein Glück versuchen wollen. Ein
guter Mensch in seinem dunklen Drange ist sich
des rechten Weges stets bewußt.
Jetzt hatte Peter Storz seine Ruh, das Pro-
blem seines Lebens war gelöst, und wenn je-
mand fernerhin von seinem Glücke sprach,
schüttelte er mit dem Kopfe und rief: „Ver-
dienst, lieber Mann, Verdienst!" Dabei schlug
er auf seine Brust, daß seine acht Orden ver-
nehmlich zu klimpern anfingen.