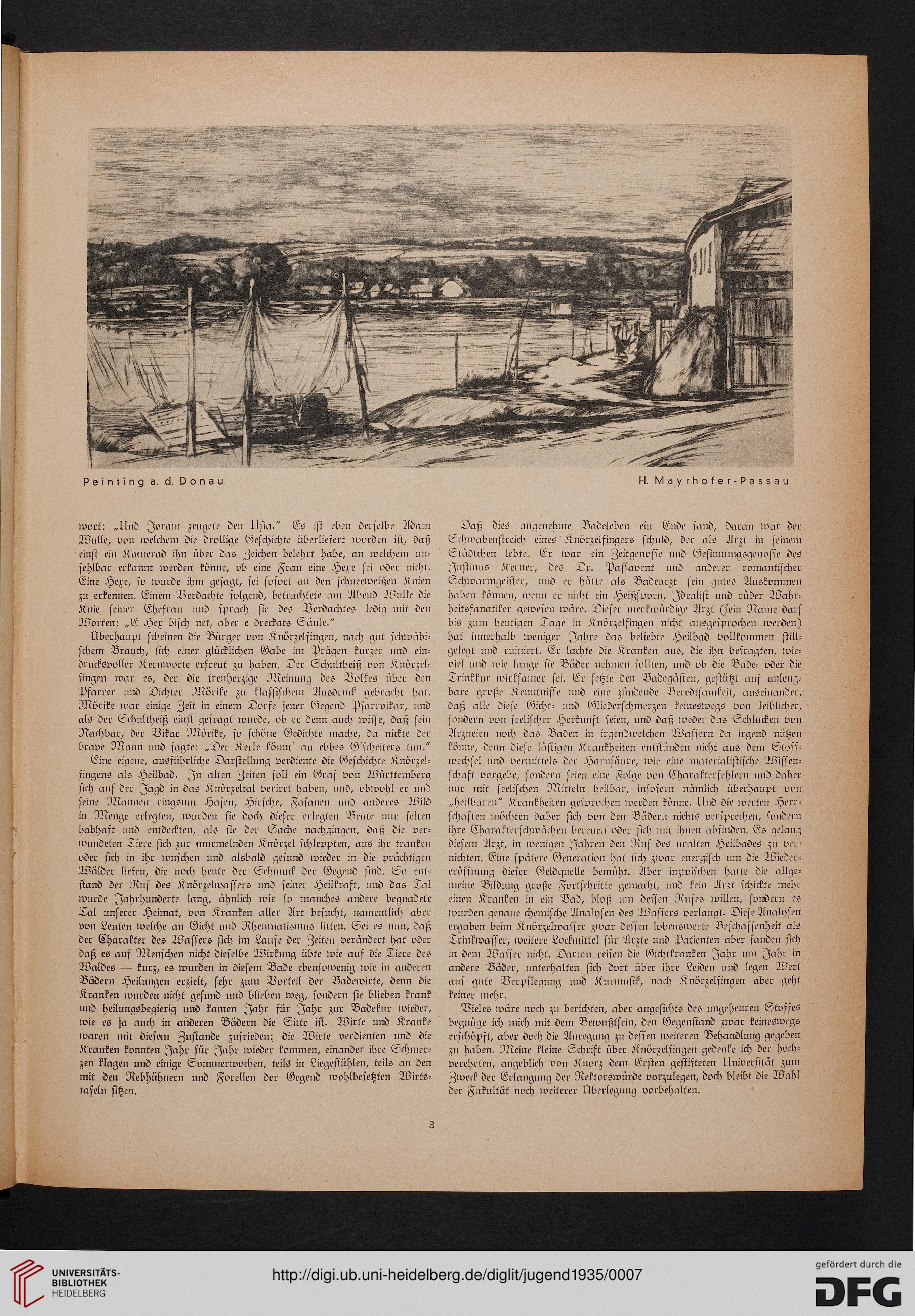wort: „Und Zoram zeugete den Usia." Es ist eben derselbe Adam
Wulle, von lvelchem die drollige Geschichte überliefert worden ijt, dci);
einst ein Äamcuad ihn über daö Zeichen belehrt habe, an welchem un-
fehlbar erkannt werden könne, ob eine Iran eine Hexe sei oder nicht.
Eine Hexe, so wurde ihm gesagt, sei sofort an den schneeweißen Knien
zu erkennen. Einem Verdachte folgend, betrachtete am Abend Wulle die
Knie seiner Ehefrau und sprach sie des Verdachtes ledig mit den
Worten: „E Hex bisch net, aber e dreekats Gäule."
Überhaupt scheinen die Bürger von Knörzelfingen, nach gut schwäbi-
schem Brauch, sich einer glücklichen Gabe im Prägen kurzer und ein-
drucksvoller Kernworte erfreut zu haben. Der Schultheiß von Knörzel-
fingen war es, der die treuherzige Meinung des Volkes über den
Pfarrer und Dichter Mörike zu klassischem Ausdruck gebracht hat.
Mörike war einige Zeit in einem Dorfe jener Gegend Pfarrvikar, und
als der Schultheiß einst gefragt wurde, ob er denn auch wisse, daß sein
Nachbar, der Vikar Mörike, so schöne Gedichte mache, da nickte der
brave Mann und sagte: „Der Kerle könnt' an ebb es G scheiters tun."
Eine eigene, ausführliche Darstellung verdiente die Geschichte Knörzel-
fingenS als Heilbad. Zn alten Zeiten soll ein Graf von Württemberg
sich auf der Zagd in das Knörzeltal verirrt haben, und, obwohl er und
seine Mannen ringsum Hafen, Hirsche, Fasanen und anderes Wild
in Menge erlegten, lvurden sie doch dieser erlegten Beute nur selten
habhaft und entdeckten, als sie der Sache nachgingen, daß die ver-
wundeten Tiere sich zur murmelnden Knörzel schleppten, aus ihr tranken
oder sich in ihr wuschen und alsbald gesund wieder in die prächtigen
Wälder liefen, die noch heute der Schmuck der Gegend sind. So ent-
stand der Nus deö KnörzelwasserS und seiner Heilkraft, und das Tal
wurde Zahrhunderte lang, ähnlich wie so manches andere begnadete
Tal unserer Heimat, von Kranken aller Art besucht, namentlich aber
von Leuten welche an Gicht und Rheumatismus litten. Sei es nun, daß
der Charakter des Wassers sich im Laufe der Zeiten verändert hat oder
daß eS auf Menschen nicht dieselbe Wirkung übte wie auf die Tiere des
Waldes — kurz, eS wurden in diesem Bade ebensowenig wie in anderen
Bädern Heilungen erzielt, sehr zum Vorteil der Badewirte, denn die
Kranken wurden nicht gesund und blieben weg, sondern sie blieben krank
und heilungSbegierig und kamen Zahr für Zahr zur Badekur wieder,
wie es ja auch in anderen Bädern die Sitte ist. Wirte und Kranke
waren mit diesem Zustande zufrieden; die Wirte verdienten und die
Kranken konnten Zahr für Zahr wieder kommen, einander ihre Schmer-
zen klagen und einige Sommerwochen, teils in Liegestühlen, teils an den
mit den Rebhühnern und Forellen der Gegend wohlbesetzten Wirts-
lafeln sitzen.
Daß dies angenehme Badeleben ein Ende fand, daran war der
Schwabenstreich eines KnörzelfingerS schuld, der als Arzt in seinem
Städtchen lebte. Er war ein Zeitgenosse und Gesinnungsgenosse des
ZustinnS Kerner, des Dr. Pasfavent und anderer romantischer
Schwarmgeister, und er hätte als Badearzt sein gutes Auskommen
haben können, wenn er nicht ein Heißsporn, Idealist und rüder Wahr-
heitsfanatiker gewesen wäre. Dieser merkwürdige Arzt (sein Name darf
bis zum heutigen Tage in Knörzelfingen nicht ausgesprochen werden)
hat innerhalb weniger Zahre das beliebte Heilbad vollkommen still-
gelegt und ruiniert. Er lachte die Kranken aus, die ihn befragten, wie-
viel und wie lange sie Bäder nehmen sollten, und ob die Bade- oder die
Trinkkur wirksamer sei. Er setzte den Badegästen, gestützt ans unleug-
bare große Kenntnisse und eine zündende Beredsamkeit, auseinander,
daß alle diese Gicht- und Gliederschmerzen keineswegs von leiblicher,
sondern von seelischer Herkunft seien, und daß weder das Schlucken von
Arzneien noch das Baden in irgendwelchen Wassern da irgend nützen
könne, denn diese lästigen Krankheiten entstünden nicht auS dem Stoff-
wechsel und vermittels der Harnsäure, wie eine materialistische Wissen-
schaft vorgebe, sondern seien eine Folge von Charaktersehlern und daher
nur mit seelischen Mitteln heilbar, insofern nämlich überhaupt von
„heilbaren" Krankheiten gesprochen werden könne. Und die werten Herr-
schaften möchten daher sich von den Bädern nichts versprechen, sondern
ihre Charakterschlvächcn bereuen oder sich mit ihnen abfinden. Es gelang
diesem Arzt, in wenigen Zähren den Ruf des uralten Heilbades zu ver-
nichten. Eine spätere Generation hat sich zwar energisch um die Wieder-
eröffnung dieser Geldquelle bemüht. Aber inzwischen hatte die allge-
nieine Bildung große Fortschritte gemacht, und kein Arzt schickte mehr
einen Kranken in ein Bad, bloß um dessen Rufes willen, sondern es
lvurden genaue chemische Analysen des Wassers verlangt. Diese Analysen
ergaben beim Knörzelwasser zwar dessen lobenswerte Beschaffenheit als
Trinkwasser, weitere Lockmittel für Ärzte und Patienten aber fanden sich
in dem Wasser nicht. Darum reisen die Gichtkranken Zahr um Zahr in
andere Bäder, unterhalten sich dort über ihre Leiden und legen Wert
auf gute Verpflegung und Kurmnsik, nach Knörzelfingen aber geht
keiner mehr.
Vieles wäre noch zu berichten, aber angesichts des ungeheuren Stoffes
begnüge ich mich mit dem Bewußtsein, den Gegenstand zwar keineswegs
erschöpft, aber doch die Anregung zu dessen weiteren Behandlung gegeben
zu haben. Meine kleine Schrift über Knörzelfingen gedenke ich der hoch-
verehrten, angeblich von Knorz dem Ersten gestifteten Universität zum
Zweck der Erlangung der Rektorswürde vorzulegen, doch bleibt die Wahl
der Fakultät noch weiterer Überlegung Vorbehalten.
3
Wulle, von lvelchem die drollige Geschichte überliefert worden ijt, dci);
einst ein Äamcuad ihn über daö Zeichen belehrt habe, an welchem un-
fehlbar erkannt werden könne, ob eine Iran eine Hexe sei oder nicht.
Eine Hexe, so wurde ihm gesagt, sei sofort an den schneeweißen Knien
zu erkennen. Einem Verdachte folgend, betrachtete am Abend Wulle die
Knie seiner Ehefrau und sprach sie des Verdachtes ledig mit den
Worten: „E Hex bisch net, aber e dreekats Gäule."
Überhaupt scheinen die Bürger von Knörzelfingen, nach gut schwäbi-
schem Brauch, sich einer glücklichen Gabe im Prägen kurzer und ein-
drucksvoller Kernworte erfreut zu haben. Der Schultheiß von Knörzel-
fingen war es, der die treuherzige Meinung des Volkes über den
Pfarrer und Dichter Mörike zu klassischem Ausdruck gebracht hat.
Mörike war einige Zeit in einem Dorfe jener Gegend Pfarrvikar, und
als der Schultheiß einst gefragt wurde, ob er denn auch wisse, daß sein
Nachbar, der Vikar Mörike, so schöne Gedichte mache, da nickte der
brave Mann und sagte: „Der Kerle könnt' an ebb es G scheiters tun."
Eine eigene, ausführliche Darstellung verdiente die Geschichte Knörzel-
fingenS als Heilbad. Zn alten Zeiten soll ein Graf von Württemberg
sich auf der Zagd in das Knörzeltal verirrt haben, und, obwohl er und
seine Mannen ringsum Hafen, Hirsche, Fasanen und anderes Wild
in Menge erlegten, lvurden sie doch dieser erlegten Beute nur selten
habhaft und entdeckten, als sie der Sache nachgingen, daß die ver-
wundeten Tiere sich zur murmelnden Knörzel schleppten, aus ihr tranken
oder sich in ihr wuschen und alsbald gesund wieder in die prächtigen
Wälder liefen, die noch heute der Schmuck der Gegend sind. So ent-
stand der Nus deö KnörzelwasserS und seiner Heilkraft, und das Tal
wurde Zahrhunderte lang, ähnlich wie so manches andere begnadete
Tal unserer Heimat, von Kranken aller Art besucht, namentlich aber
von Leuten welche an Gicht und Rheumatismus litten. Sei es nun, daß
der Charakter des Wassers sich im Laufe der Zeiten verändert hat oder
daß eS auf Menschen nicht dieselbe Wirkung übte wie auf die Tiere des
Waldes — kurz, eS wurden in diesem Bade ebensowenig wie in anderen
Bädern Heilungen erzielt, sehr zum Vorteil der Badewirte, denn die
Kranken wurden nicht gesund und blieben weg, sondern sie blieben krank
und heilungSbegierig und kamen Zahr für Zahr zur Badekur wieder,
wie es ja auch in anderen Bädern die Sitte ist. Wirte und Kranke
waren mit diesem Zustande zufrieden; die Wirte verdienten und die
Kranken konnten Zahr für Zahr wieder kommen, einander ihre Schmer-
zen klagen und einige Sommerwochen, teils in Liegestühlen, teils an den
mit den Rebhühnern und Forellen der Gegend wohlbesetzten Wirts-
lafeln sitzen.
Daß dies angenehme Badeleben ein Ende fand, daran war der
Schwabenstreich eines KnörzelfingerS schuld, der als Arzt in seinem
Städtchen lebte. Er war ein Zeitgenosse und Gesinnungsgenosse des
ZustinnS Kerner, des Dr. Pasfavent und anderer romantischer
Schwarmgeister, und er hätte als Badearzt sein gutes Auskommen
haben können, wenn er nicht ein Heißsporn, Idealist und rüder Wahr-
heitsfanatiker gewesen wäre. Dieser merkwürdige Arzt (sein Name darf
bis zum heutigen Tage in Knörzelfingen nicht ausgesprochen werden)
hat innerhalb weniger Zahre das beliebte Heilbad vollkommen still-
gelegt und ruiniert. Er lachte die Kranken aus, die ihn befragten, wie-
viel und wie lange sie Bäder nehmen sollten, und ob die Bade- oder die
Trinkkur wirksamer sei. Er setzte den Badegästen, gestützt ans unleug-
bare große Kenntnisse und eine zündende Beredsamkeit, auseinander,
daß alle diese Gicht- und Gliederschmerzen keineswegs von leiblicher,
sondern von seelischer Herkunft seien, und daß weder das Schlucken von
Arzneien noch das Baden in irgendwelchen Wassern da irgend nützen
könne, denn diese lästigen Krankheiten entstünden nicht auS dem Stoff-
wechsel und vermittels der Harnsäure, wie eine materialistische Wissen-
schaft vorgebe, sondern seien eine Folge von Charaktersehlern und daher
nur mit seelischen Mitteln heilbar, insofern nämlich überhaupt von
„heilbaren" Krankheiten gesprochen werden könne. Und die werten Herr-
schaften möchten daher sich von den Bädern nichts versprechen, sondern
ihre Charakterschlvächcn bereuen oder sich mit ihnen abfinden. Es gelang
diesem Arzt, in wenigen Zähren den Ruf des uralten Heilbades zu ver-
nichten. Eine spätere Generation hat sich zwar energisch um die Wieder-
eröffnung dieser Geldquelle bemüht. Aber inzwischen hatte die allge-
nieine Bildung große Fortschritte gemacht, und kein Arzt schickte mehr
einen Kranken in ein Bad, bloß um dessen Rufes willen, sondern es
lvurden genaue chemische Analysen des Wassers verlangt. Diese Analysen
ergaben beim Knörzelwasser zwar dessen lobenswerte Beschaffenheit als
Trinkwasser, weitere Lockmittel für Ärzte und Patienten aber fanden sich
in dem Wasser nicht. Darum reisen die Gichtkranken Zahr um Zahr in
andere Bäder, unterhalten sich dort über ihre Leiden und legen Wert
auf gute Verpflegung und Kurmnsik, nach Knörzelfingen aber geht
keiner mehr.
Vieles wäre noch zu berichten, aber angesichts des ungeheuren Stoffes
begnüge ich mich mit dem Bewußtsein, den Gegenstand zwar keineswegs
erschöpft, aber doch die Anregung zu dessen weiteren Behandlung gegeben
zu haben. Meine kleine Schrift über Knörzelfingen gedenke ich der hoch-
verehrten, angeblich von Knorz dem Ersten gestifteten Universität zum
Zweck der Erlangung der Rektorswürde vorzulegen, doch bleibt die Wahl
der Fakultät noch weiterer Überlegung Vorbehalten.
3