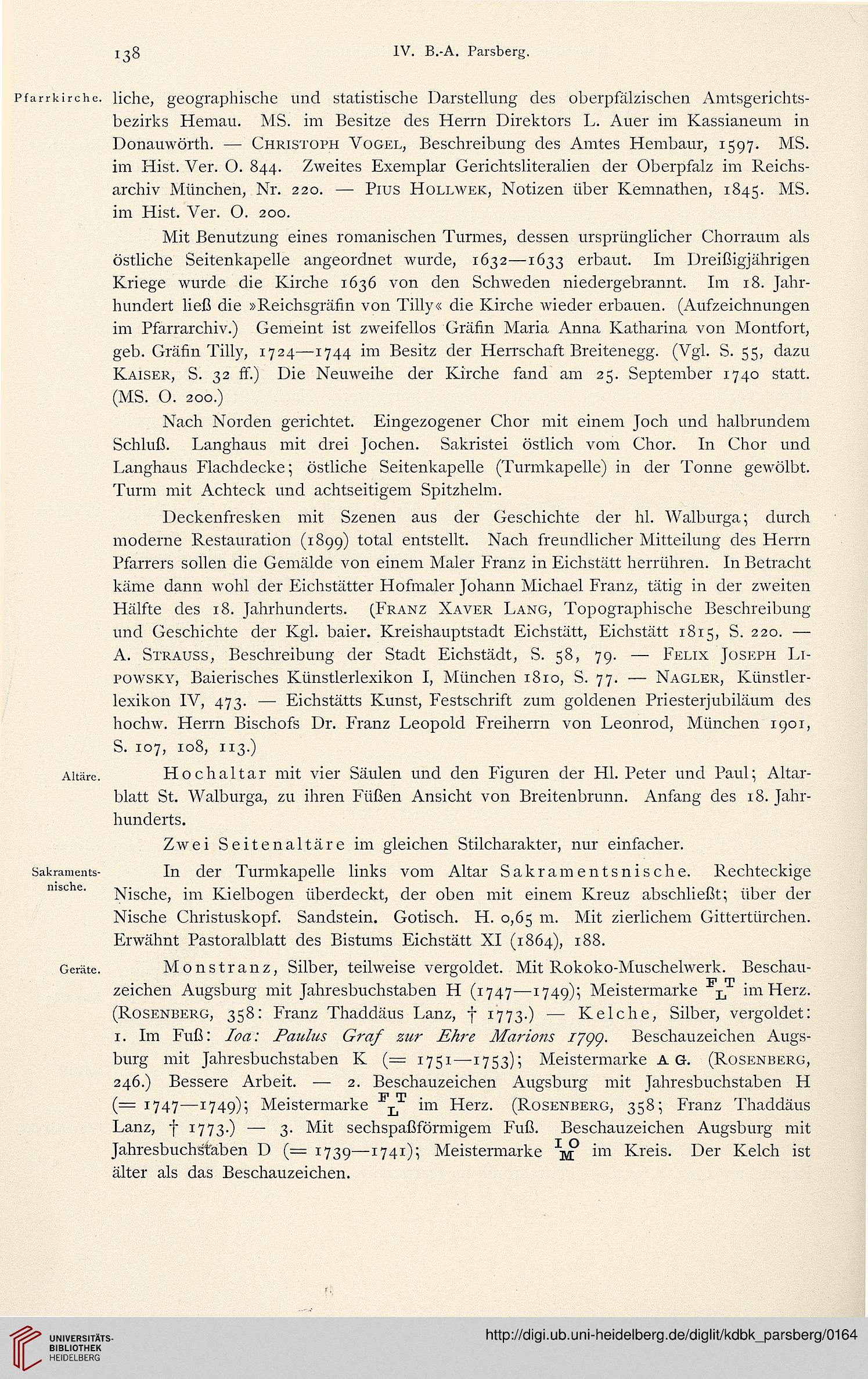IV. B.-A. Parsberg.
138
Pfarrkirche, liehe, geographische und statistische Darstellung des oberpfälzischen Amtsgerichts-
bezirks Hernau. MS. im Besitze des Herrn Direktors F. Auer im Kassianeum in
Donauwörth. — CHRISTOPH VOGEL, Beschreibung des Amtes Hembaur, 1597. MS.
im Hist. Ver. O. 844. Zweites Exemplar Gerichtsliteralien der Oberpfalz im Reichs-
archiv München, Nr. 220. — Pius HoLLWKK, Notizen über Kemnathen, 184g. MS.
im Hist. Ver. O. 200.
Alit Benutzung eines romanischen Turmes, dessen ursprünglicher Chorraum als
östliche Seitenkapelle angeordnet wurde, 1632—1633 erbaut. Im Dreißigjährigen
Kriege wurde die Kirche 1636 von den Schweden niedergebrannt. Im 18. Jahr-
hundert ließ die »Rcichsgräftn von Tilly« die Kirche wieder erbauen. (Aufzeichnungen
im Pfarrarchiv.) Gemeint ist zweifellos Gräfin Maria Anna Katharina von Montfort,
geb. Gräfin Tilly, 1724—1744 im Besitz der Herrschaft Breitenegg. (Vgl. S. gg, dazu
KAISER, S. 32 ff.) Die Neuweihe der Kirche fand am 2g. September 1740 statt.
(MS. O. 200.)
Nach Norden gerichtet. Eingezogener Chor mit einem Joch und halbrundem
Schluß. Langhaus mit drei Jochen. Sakristei östlich vom Chor. In Chor und
Langhaus Flachdecke; östliche Seitenkapclle (Turmkapelle) in der Tonne gewölbt.
Turm mit Achteck und achtseitigem Spitzhelm.
Deckenfresken mit Szenen aus der Geschichte der hl. Walburga; durch
moderne Restauration (1899) total entstellt. Nach freundlicher Mitteilung des Herrn
Pfarrers sollen die Gemälde von einem Maler Franz in Eichstätt herrühren. In Betracht
käme dann wohl der Eichstätter Hofmaler Johann Michael Franz, tätig in der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts. (FRANZ XAVER LANG, Topographische Beschreibung
und Geschichte der Kgl. baier. Kreishauptstadt Eichstätt, Eichstätt 181g, S. 220. —
A. STRAUSS, Beschreibung der Stadt Eichstädt, S. g8, 79. — FELIX JoSKPH Ei-
powsKY, Baierisches Künstlerlexikon I, München 1810, S. 77. — NAGLER, Künstler-
lexikon IV, 473. — Eichstätts Kunst, Festschrift zum goldenen Priesterjubiläum des
hochw. Herrn Bischofs Dr. Franz Leopold Freiherrn von Leonrod, München 1901,
S. 107, 108, 113.)
Attärc. Hochaltar mit vier Säulen und den Figuren der Hl. Peter und Paul; Altar-
blatt St. Walburga, zu ihren Füßen Ansicht von Breitenbrunn. Anfang des 18. Jahr-
hunderts.
Zwei Seitenaltäre im gleichen Stilcharakter, nur einfacher.
Sakraments- In der Turmkapelle links vom Altar Sakramentsnische. Rechteckige
mse e. Nische, im Kielbogen überdeckt, der oben mit einem Kreuz abschließt; über der
Nische Christuskopf. Sandstein. Gotisch. H. 0,6g m. Mit zierlichem Gittertürchen.
Erwähnt Pastoralblatt des Bistums Eichstätt XI (1864), 188.
Geräte. Monstranz, Silber, teilweise vergoldet. Mit Rokoko-Muschelwerk. Beschau-
zeichen Augsburg mit Jahresbuchstaben H (1747—1749); Meistermarke hn Herz.
(ROSENBERG, 3g8: Franz Thaddäus Tanz, j* 1773.) — Kelche, Silber, vergoldet:
1. Im Fuß: Vzk?.' Zbe/Zvi (Ww/* TO/Vwi zypp. Beschauzeichen Augs-
burg mit Jahresbuchstaben K (— 1731—1733); Meistermarke AG. (RosENBERC,
246.) Bessere Arbeit. — 2. Beschauzeichen Augsburg mit Jahresbuchstaben H
(= 1747—1749); Meistermarke im Herz. (RosENBERG, 338; Franz Thaddäus
Lanz, j* 1773.) — 3. Mit sechspaßförmigem Fuß. Beschauzeichen Augsburg mit
Jahresbuchstaben D (= 1739—1741); Meistermarke im Kreis. Der Kelch ist
älter als das Beschauzeichen.
138
Pfarrkirche, liehe, geographische und statistische Darstellung des oberpfälzischen Amtsgerichts-
bezirks Hernau. MS. im Besitze des Herrn Direktors F. Auer im Kassianeum in
Donauwörth. — CHRISTOPH VOGEL, Beschreibung des Amtes Hembaur, 1597. MS.
im Hist. Ver. O. 844. Zweites Exemplar Gerichtsliteralien der Oberpfalz im Reichs-
archiv München, Nr. 220. — Pius HoLLWKK, Notizen über Kemnathen, 184g. MS.
im Hist. Ver. O. 200.
Alit Benutzung eines romanischen Turmes, dessen ursprünglicher Chorraum als
östliche Seitenkapelle angeordnet wurde, 1632—1633 erbaut. Im Dreißigjährigen
Kriege wurde die Kirche 1636 von den Schweden niedergebrannt. Im 18. Jahr-
hundert ließ die »Rcichsgräftn von Tilly« die Kirche wieder erbauen. (Aufzeichnungen
im Pfarrarchiv.) Gemeint ist zweifellos Gräfin Maria Anna Katharina von Montfort,
geb. Gräfin Tilly, 1724—1744 im Besitz der Herrschaft Breitenegg. (Vgl. S. gg, dazu
KAISER, S. 32 ff.) Die Neuweihe der Kirche fand am 2g. September 1740 statt.
(MS. O. 200.)
Nach Norden gerichtet. Eingezogener Chor mit einem Joch und halbrundem
Schluß. Langhaus mit drei Jochen. Sakristei östlich vom Chor. In Chor und
Langhaus Flachdecke; östliche Seitenkapclle (Turmkapelle) in der Tonne gewölbt.
Turm mit Achteck und achtseitigem Spitzhelm.
Deckenfresken mit Szenen aus der Geschichte der hl. Walburga; durch
moderne Restauration (1899) total entstellt. Nach freundlicher Mitteilung des Herrn
Pfarrers sollen die Gemälde von einem Maler Franz in Eichstätt herrühren. In Betracht
käme dann wohl der Eichstätter Hofmaler Johann Michael Franz, tätig in der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts. (FRANZ XAVER LANG, Topographische Beschreibung
und Geschichte der Kgl. baier. Kreishauptstadt Eichstätt, Eichstätt 181g, S. 220. —
A. STRAUSS, Beschreibung der Stadt Eichstädt, S. g8, 79. — FELIX JoSKPH Ei-
powsKY, Baierisches Künstlerlexikon I, München 1810, S. 77. — NAGLER, Künstler-
lexikon IV, 473. — Eichstätts Kunst, Festschrift zum goldenen Priesterjubiläum des
hochw. Herrn Bischofs Dr. Franz Leopold Freiherrn von Leonrod, München 1901,
S. 107, 108, 113.)
Attärc. Hochaltar mit vier Säulen und den Figuren der Hl. Peter und Paul; Altar-
blatt St. Walburga, zu ihren Füßen Ansicht von Breitenbrunn. Anfang des 18. Jahr-
hunderts.
Zwei Seitenaltäre im gleichen Stilcharakter, nur einfacher.
Sakraments- In der Turmkapelle links vom Altar Sakramentsnische. Rechteckige
mse e. Nische, im Kielbogen überdeckt, der oben mit einem Kreuz abschließt; über der
Nische Christuskopf. Sandstein. Gotisch. H. 0,6g m. Mit zierlichem Gittertürchen.
Erwähnt Pastoralblatt des Bistums Eichstätt XI (1864), 188.
Geräte. Monstranz, Silber, teilweise vergoldet. Mit Rokoko-Muschelwerk. Beschau-
zeichen Augsburg mit Jahresbuchstaben H (1747—1749); Meistermarke hn Herz.
(ROSENBERG, 3g8: Franz Thaddäus Tanz, j* 1773.) — Kelche, Silber, vergoldet:
1. Im Fuß: Vzk?.' Zbe/Zvi (Ww/* TO/Vwi zypp. Beschauzeichen Augs-
burg mit Jahresbuchstaben K (— 1731—1733); Meistermarke AG. (RosENBERC,
246.) Bessere Arbeit. — 2. Beschauzeichen Augsburg mit Jahresbuchstaben H
(= 1747—1749); Meistermarke im Herz. (RosENBERG, 338; Franz Thaddäus
Lanz, j* 1773.) — 3. Mit sechspaßförmigem Fuß. Beschauzeichen Augsburg mit
Jahresbuchstaben D (= 1739—1741); Meistermarke im Kreis. Der Kelch ist
älter als das Beschauzeichen.