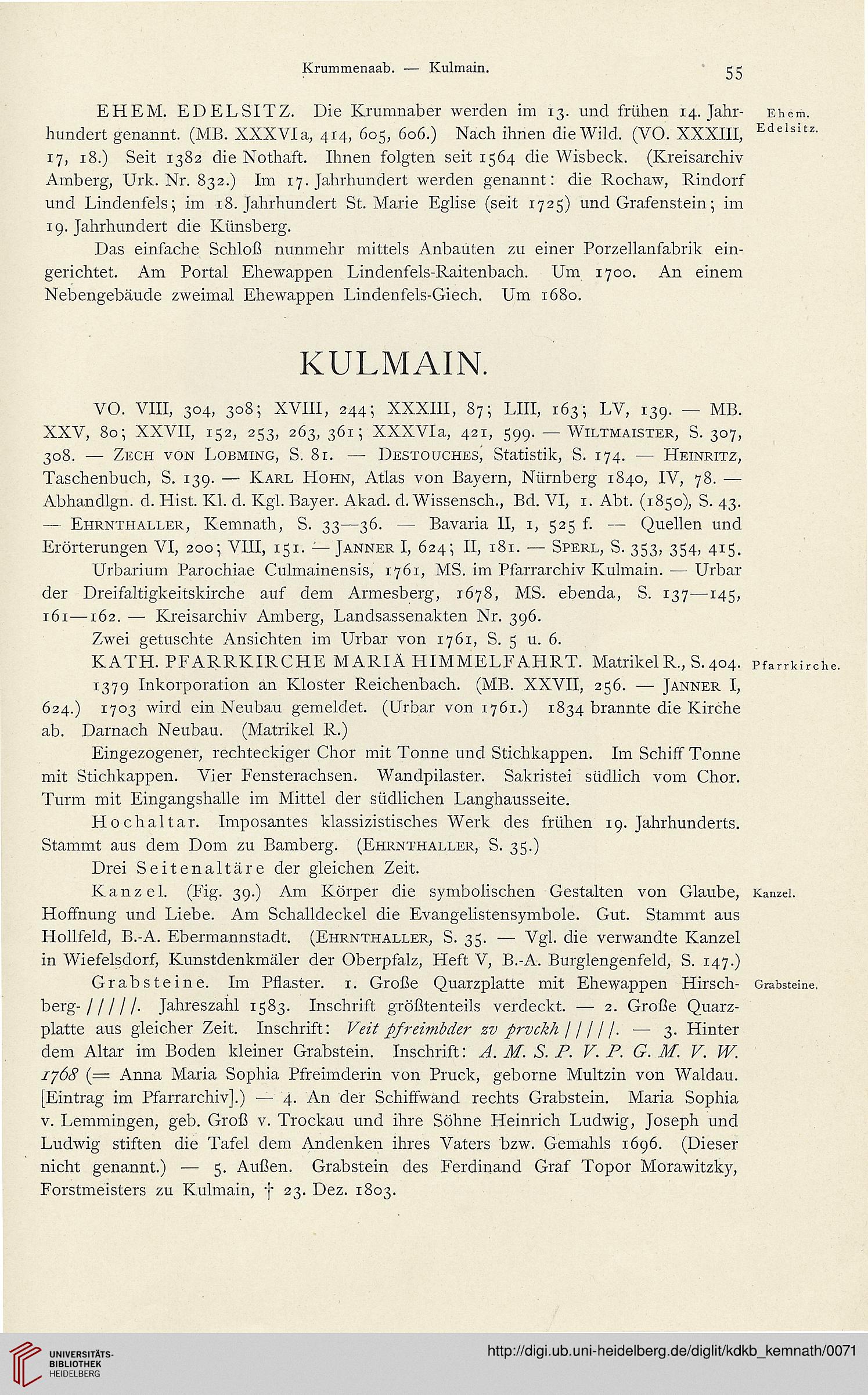Krummenaab. — Kulmain.
55
EHEM. EDELSITZ. Die Krumnaber werden im 13. und frühen 14. Jahr- Ehem.
hundert genannt. (MB. XXXVIa, 414, 605, 606.) Nach ihnen die Wild. (VO. XXXIII, Ldelsltz-
17, 18.) Seit 1382 die Nothaft. Ihnen folgten seit 1564 die Wisbeck. (Kreisarchiv
Amberg, Urk. Nr. 832.) Im 17. Jahrhundert werden genannt: die Rochaw, Rindorf
und Lindenfels; im 18. Jahrhundert St. Marie Eglise (seit 1725) und Grafenstein; im
19. Jahrhundert die Kiinsberg.
Das einfache Schloß nunmehr mittels Anbauten zu einer Porzellanfabrik ein-
gerichtet. Am Portal Ehewappen Lindenfels-Raitenbach. Um 1700. An einem
Nebengebäude zweimal Ehewappen Lindenfels-Giech. Um 1680.
KULMAIN.
VO. VIII, 304, 308; XVIII, 244; XXXIII, 87; LIII, 163; LV, 139. — MB.
XXV, 80; XXVII, 152, 253, 263, 361; XXXVIa, 421, 599. —Wiltmaister, S. 307,
308. — Zech von Lobming, S. 8r. — Destouches, Statistik, S. 174. — Heinritz,
Taschenbuch, S. 139. — Karl Hohn, Atlas von Bayern, Nürnberg 1840, IV, 78. —
Abhandlgn. d. Hist. Kl. d. Kgl. Bayer. Akad. d. Wissensch., Bel. VI, 1. Abt. (1850), S. 43.
— Ehrnthaller, Kemnath, S. 33—36. — Bavaria II, 1, 525 f. — Quellen und
Erörterungen VI, 200; VIII, 151. — Jänner I, 624; II, 181. — Sperl, S. 353, 354, 415.
Urbarium Parochiae Culmainensis, 1761, MS. im Pfarrarchiv Kulmain. — Urbar
der Dreifaltigkeitskirche auf dem Armesberg, 1678, MS. ebenda, S. 137—145,
161—162. — Kreisarchiv Amberg, Landsassenakten Nr. 396.
Zwei getuschte Ansichten im Urbar von 1761, S. 5 u. 6.
KATH. PFARRKIRCHE MARIÄ HIMMELFAHRT. MatrikelR., S. 404. Pfarrkirche.
1379 Inkorporation an Kloster Reichenbach. (MB. XXVII, 256. — Jänner I,
624.) 1703 wird ein Neubau gemeldet. (Urbar von 1761.) 1834 brannte die Kirche
ab. Darnach Neubau. (Matrikel R.)
Eingezogener, rechteckiger Chor mit Tonne und Stichkappen. Im Schiff Tonne
mit Stichkappen. Vier Fensterachsen. Wandpilaster. Sakristei südlich vom Chor.
Turm mit Eingangshalle im Mittel der südlichen Langhausseite.
Hochaltar. Imposantes klassizistisches Werk des frühen 19. Jahrhunderts.
Stammt aus dem Dom zu Bamberg. (Ehrnthaller, S. 35.)
Drei Seitenaltäre der gleichen Zeit.
Kanzel. (Fig. 39.) Am Körper die symbolischen Gestalten von Glaube, Kanzel.
Hoffnung und Liebe. Am Schalldeckel die Evangelistensymbole. Gut. Stammt aus
Hollfeld, B.-A. Ebermannstadt. (Ehrnthaller, S. 35. — Vgl. die verwandte Kanzel
in Wiefelsdorf, Kunstdenkmäler der Oberpfalz, Heft V, B.-A. Burglengenfeld, S. 147.)
Grabsteine. Im Pflaster. 1. Große Quarzplatte mit Ehewappen Hirsch- Grabsteine,
berg-/ / / //. Jahreszahl 1583. Inschrift größtenteils verdeckt. — 2. Große Quarz-
platte aus gleicher Zeit. Inschrift: Veit pfreimbder zv prvckh / / / / /. — 3. Hinter
dem Altar im Boden kleiner Grabstein. Inschrift: A. M. S. P. V. P. G. M. V. W.
ij68 (= Anna Maria Sophia Pfreimderin von Pruck, geborne Multzin von Waldau.
[Eintrag im Pfarrarchiv].) — 4. An der Schiffwand rechts Grabstein. Maria Sophia
v. Lemmingen, geb. Groß v. Trockau und ihre Söhne Heinrich Ludwig, Joseph und
Ludwig stiften die Tafel dem Andenken ihres Vaters bzw. Gemahls 1696. (Dieser
nicht genannt.) — 5. Außen. Grabstein des Ferdinand Graf Topor Morawitzky,
Forstmeisters zu Kulmain, •)• 23. Dez. 1803.
55
EHEM. EDELSITZ. Die Krumnaber werden im 13. und frühen 14. Jahr- Ehem.
hundert genannt. (MB. XXXVIa, 414, 605, 606.) Nach ihnen die Wild. (VO. XXXIII, Ldelsltz-
17, 18.) Seit 1382 die Nothaft. Ihnen folgten seit 1564 die Wisbeck. (Kreisarchiv
Amberg, Urk. Nr. 832.) Im 17. Jahrhundert werden genannt: die Rochaw, Rindorf
und Lindenfels; im 18. Jahrhundert St. Marie Eglise (seit 1725) und Grafenstein; im
19. Jahrhundert die Kiinsberg.
Das einfache Schloß nunmehr mittels Anbauten zu einer Porzellanfabrik ein-
gerichtet. Am Portal Ehewappen Lindenfels-Raitenbach. Um 1700. An einem
Nebengebäude zweimal Ehewappen Lindenfels-Giech. Um 1680.
KULMAIN.
VO. VIII, 304, 308; XVIII, 244; XXXIII, 87; LIII, 163; LV, 139. — MB.
XXV, 80; XXVII, 152, 253, 263, 361; XXXVIa, 421, 599. —Wiltmaister, S. 307,
308. — Zech von Lobming, S. 8r. — Destouches, Statistik, S. 174. — Heinritz,
Taschenbuch, S. 139. — Karl Hohn, Atlas von Bayern, Nürnberg 1840, IV, 78. —
Abhandlgn. d. Hist. Kl. d. Kgl. Bayer. Akad. d. Wissensch., Bel. VI, 1. Abt. (1850), S. 43.
— Ehrnthaller, Kemnath, S. 33—36. — Bavaria II, 1, 525 f. — Quellen und
Erörterungen VI, 200; VIII, 151. — Jänner I, 624; II, 181. — Sperl, S. 353, 354, 415.
Urbarium Parochiae Culmainensis, 1761, MS. im Pfarrarchiv Kulmain. — Urbar
der Dreifaltigkeitskirche auf dem Armesberg, 1678, MS. ebenda, S. 137—145,
161—162. — Kreisarchiv Amberg, Landsassenakten Nr. 396.
Zwei getuschte Ansichten im Urbar von 1761, S. 5 u. 6.
KATH. PFARRKIRCHE MARIÄ HIMMELFAHRT. MatrikelR., S. 404. Pfarrkirche.
1379 Inkorporation an Kloster Reichenbach. (MB. XXVII, 256. — Jänner I,
624.) 1703 wird ein Neubau gemeldet. (Urbar von 1761.) 1834 brannte die Kirche
ab. Darnach Neubau. (Matrikel R.)
Eingezogener, rechteckiger Chor mit Tonne und Stichkappen. Im Schiff Tonne
mit Stichkappen. Vier Fensterachsen. Wandpilaster. Sakristei südlich vom Chor.
Turm mit Eingangshalle im Mittel der südlichen Langhausseite.
Hochaltar. Imposantes klassizistisches Werk des frühen 19. Jahrhunderts.
Stammt aus dem Dom zu Bamberg. (Ehrnthaller, S. 35.)
Drei Seitenaltäre der gleichen Zeit.
Kanzel. (Fig. 39.) Am Körper die symbolischen Gestalten von Glaube, Kanzel.
Hoffnung und Liebe. Am Schalldeckel die Evangelistensymbole. Gut. Stammt aus
Hollfeld, B.-A. Ebermannstadt. (Ehrnthaller, S. 35. — Vgl. die verwandte Kanzel
in Wiefelsdorf, Kunstdenkmäler der Oberpfalz, Heft V, B.-A. Burglengenfeld, S. 147.)
Grabsteine. Im Pflaster. 1. Große Quarzplatte mit Ehewappen Hirsch- Grabsteine,
berg-/ / / //. Jahreszahl 1583. Inschrift größtenteils verdeckt. — 2. Große Quarz-
platte aus gleicher Zeit. Inschrift: Veit pfreimbder zv prvckh / / / / /. — 3. Hinter
dem Altar im Boden kleiner Grabstein. Inschrift: A. M. S. P. V. P. G. M. V. W.
ij68 (= Anna Maria Sophia Pfreimderin von Pruck, geborne Multzin von Waldau.
[Eintrag im Pfarrarchiv].) — 4. An der Schiffwand rechts Grabstein. Maria Sophia
v. Lemmingen, geb. Groß v. Trockau und ihre Söhne Heinrich Ludwig, Joseph und
Ludwig stiften die Tafel dem Andenken ihres Vaters bzw. Gemahls 1696. (Dieser
nicht genannt.) — 5. Außen. Grabstein des Ferdinand Graf Topor Morawitzky,
Forstmeisters zu Kulmain, •)• 23. Dez. 1803.