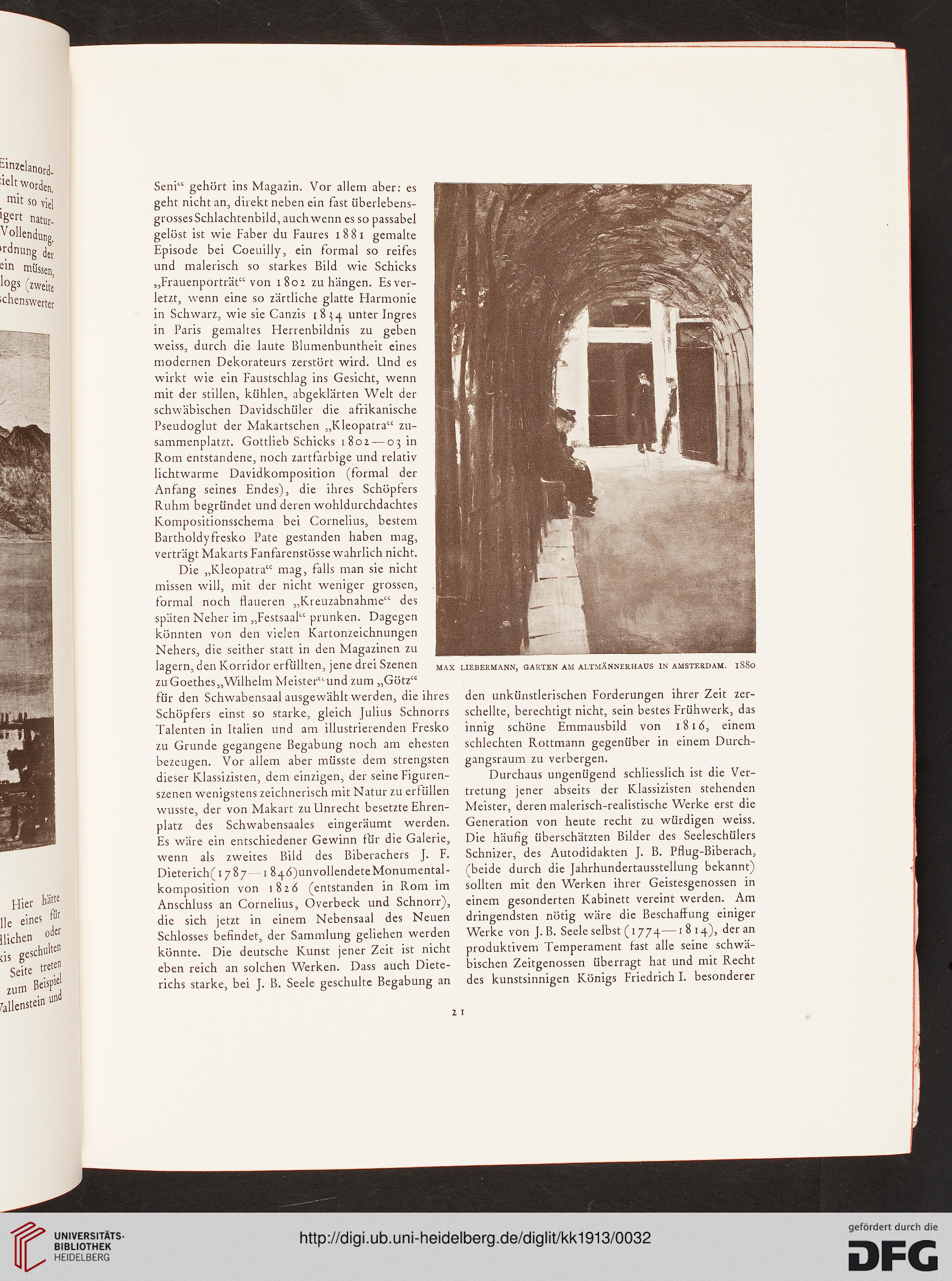7inzdanord-
;ielt Worden,
. mit so viel
'gert natur-
V°Hendung.
'rdnung der
Jln müssen,
logs (zweite
sehenswerter
Hier hatte
lle eine? f
Hieben ^
eis geschu^
Seite trete
zum Beisp^j
Gallenstein und
Seni'c gehört ins Magazin. Vor allem aber: es
geht nicht an, direkt neben ein fast überlebens-
grosses Schlachtenbild, auch wenn es so passabel
gelöst ist wie Faber du Faures 1881 gemalte
Episode bei Coeuilly, ein formal so reifes
und malerisch so starkes Bild wie Schicks
„Frauenporträt" von 1802 zuhängen. Es ver-
letzt, wenn eine so zärtliche glatte Harmonie
in Schwarz, wie sie Canzis [854 unter Ingres
in Paris gemaltes Herrenbildnis zu geben
weiss, durch die laute Blumenbuntheit eines
modernen Dekorateurs zerstört wird. Und es
wirkt wie ein Faustschlag ins Gesicht, wenn
mit der stillen, kühlen, abgeklärten Welt der
schwäbischen Davidschüler die afrikanische
Pseudoglut der Makartschen „Kleopatra" zu-
sammenplatzt. Gottlieb Schicks 1802 — 03 in
Rom entstandene, noch zartfarbige und relativ
lichtwarme Davidkomposition (formal der
Anfang seines Endes), die ihres Schöpfers
Ruhm begründet und deren wohldurchdachtes
Kompositionsschema bei Cornelius, bestem
Bartholdyfresko Pate gestanden haben mag,
verträgt Makarts Fanfarenstösse wahrlich nicht.
Die „Kleopatra" mag, falls man sie nicht
missen will, mit der nicht weniger grossen,
formal noch flaueren „Kreuzabnahme" des
späten Neher im „Festsaal" prunken. Dagegen
könnten von den vielen Kartonzeichnungen
Nehers, die seither statt in den Magazinen zu
Jagern, den Korridor erfüllten, jene drei Szenen
zu Goethes „Wilhelm Meister" und zum „Götz"
für den Schwabensaal ausgewählt werden, die ihres
Schöpfers einst so starke, gleich Julius Schnorrs
Talenten in Italien und am illustrierenden Fresko
zu Grunde gegangene Begabung noch am ehesten
bezeugen. Vor allem aber müsste dem strengsten
dieser Klassizisten, dem einzigen, der seine Figuren-
szenen wenigstens zeichnerisch mit Natur zu erfüllen
wusste, der von Makart zu Unrecht besetzte Ehren-
platz des Schwabensaales eingeräumt werden.
Es wäre ein entschiedener Gewinn für die Galerie,
wenn als zweites Bild des Biberachers J. F.
Dieterich(i/87- 184Ö)unvollendeteMonumental-
komposition von 1826 (entstanden in Rom im
Anschluss an Cornelius, Overbeck und Schnorr),
die sich jetzt in einem Nebensaal des Neuen
Schlosses befindet, der Sammlung geliehen werden
könnte. Die deutsche Kunst jener Zeit ist nicht
eben reich an solchen Werken. Dass auch Diete-
richs starke, bei J. B. Seele geschulte Begabung an
MAX LIEBERMANN, GARTEN AM ALTMÄNNERHAUS IN AMSTERDAM. l88o
den unkünstlerischen Forderungen ihrer Zeit zer-
schellte, berechtigt nicht, sein bestes Frühwerk, das
innig schöne Emmausbild von 1816, einem
schlechten Rottmann gegenüber in einem Durch-
gangsraum zu verbergen.
Durchaus ungenügend schliesslich ist die Ver-
tretung jener abseits der Klassizisten stehenden
Meister, deren malerisch-realistische Werke erst die
Generation von heute recht zu würdigen weiss.
Die häufig überschätzten Bilder des Seeleschülers
Schnizer, des Autodidakten J. B. Pflug-Biberach,
(beide durch die Jahrhundertaussteliung bekannt)
sollten mit den Werken ihrer Geistesgenossen in
einem gesonderten Kabinett vereint werden. Am
dringendsten nötig wäre die Beschaffung einiger
Werke von J. B. Seele selbst (i 774—18 14), der an
produktivem Temperament fast alle seine schwä-
bischen Zeitgenossen überragt hat und mit Recht
des kunstsinnigen Königs Friedrich I. besonderer
2 1
;ielt Worden,
. mit so viel
'gert natur-
V°Hendung.
'rdnung der
Jln müssen,
logs (zweite
sehenswerter
Hier hatte
lle eine? f
Hieben ^
eis geschu^
Seite trete
zum Beisp^j
Gallenstein und
Seni'c gehört ins Magazin. Vor allem aber: es
geht nicht an, direkt neben ein fast überlebens-
grosses Schlachtenbild, auch wenn es so passabel
gelöst ist wie Faber du Faures 1881 gemalte
Episode bei Coeuilly, ein formal so reifes
und malerisch so starkes Bild wie Schicks
„Frauenporträt" von 1802 zuhängen. Es ver-
letzt, wenn eine so zärtliche glatte Harmonie
in Schwarz, wie sie Canzis [854 unter Ingres
in Paris gemaltes Herrenbildnis zu geben
weiss, durch die laute Blumenbuntheit eines
modernen Dekorateurs zerstört wird. Und es
wirkt wie ein Faustschlag ins Gesicht, wenn
mit der stillen, kühlen, abgeklärten Welt der
schwäbischen Davidschüler die afrikanische
Pseudoglut der Makartschen „Kleopatra" zu-
sammenplatzt. Gottlieb Schicks 1802 — 03 in
Rom entstandene, noch zartfarbige und relativ
lichtwarme Davidkomposition (formal der
Anfang seines Endes), die ihres Schöpfers
Ruhm begründet und deren wohldurchdachtes
Kompositionsschema bei Cornelius, bestem
Bartholdyfresko Pate gestanden haben mag,
verträgt Makarts Fanfarenstösse wahrlich nicht.
Die „Kleopatra" mag, falls man sie nicht
missen will, mit der nicht weniger grossen,
formal noch flaueren „Kreuzabnahme" des
späten Neher im „Festsaal" prunken. Dagegen
könnten von den vielen Kartonzeichnungen
Nehers, die seither statt in den Magazinen zu
Jagern, den Korridor erfüllten, jene drei Szenen
zu Goethes „Wilhelm Meister" und zum „Götz"
für den Schwabensaal ausgewählt werden, die ihres
Schöpfers einst so starke, gleich Julius Schnorrs
Talenten in Italien und am illustrierenden Fresko
zu Grunde gegangene Begabung noch am ehesten
bezeugen. Vor allem aber müsste dem strengsten
dieser Klassizisten, dem einzigen, der seine Figuren-
szenen wenigstens zeichnerisch mit Natur zu erfüllen
wusste, der von Makart zu Unrecht besetzte Ehren-
platz des Schwabensaales eingeräumt werden.
Es wäre ein entschiedener Gewinn für die Galerie,
wenn als zweites Bild des Biberachers J. F.
Dieterich(i/87- 184Ö)unvollendeteMonumental-
komposition von 1826 (entstanden in Rom im
Anschluss an Cornelius, Overbeck und Schnorr),
die sich jetzt in einem Nebensaal des Neuen
Schlosses befindet, der Sammlung geliehen werden
könnte. Die deutsche Kunst jener Zeit ist nicht
eben reich an solchen Werken. Dass auch Diete-
richs starke, bei J. B. Seele geschulte Begabung an
MAX LIEBERMANN, GARTEN AM ALTMÄNNERHAUS IN AMSTERDAM. l88o
den unkünstlerischen Forderungen ihrer Zeit zer-
schellte, berechtigt nicht, sein bestes Frühwerk, das
innig schöne Emmausbild von 1816, einem
schlechten Rottmann gegenüber in einem Durch-
gangsraum zu verbergen.
Durchaus ungenügend schliesslich ist die Ver-
tretung jener abseits der Klassizisten stehenden
Meister, deren malerisch-realistische Werke erst die
Generation von heute recht zu würdigen weiss.
Die häufig überschätzten Bilder des Seeleschülers
Schnizer, des Autodidakten J. B. Pflug-Biberach,
(beide durch die Jahrhundertaussteliung bekannt)
sollten mit den Werken ihrer Geistesgenossen in
einem gesonderten Kabinett vereint werden. Am
dringendsten nötig wäre die Beschaffung einiger
Werke von J. B. Seele selbst (i 774—18 14), der an
produktivem Temperament fast alle seine schwä-
bischen Zeitgenossen überragt hat und mit Recht
des kunstsinnigen Königs Friedrich I. besonderer
2 1