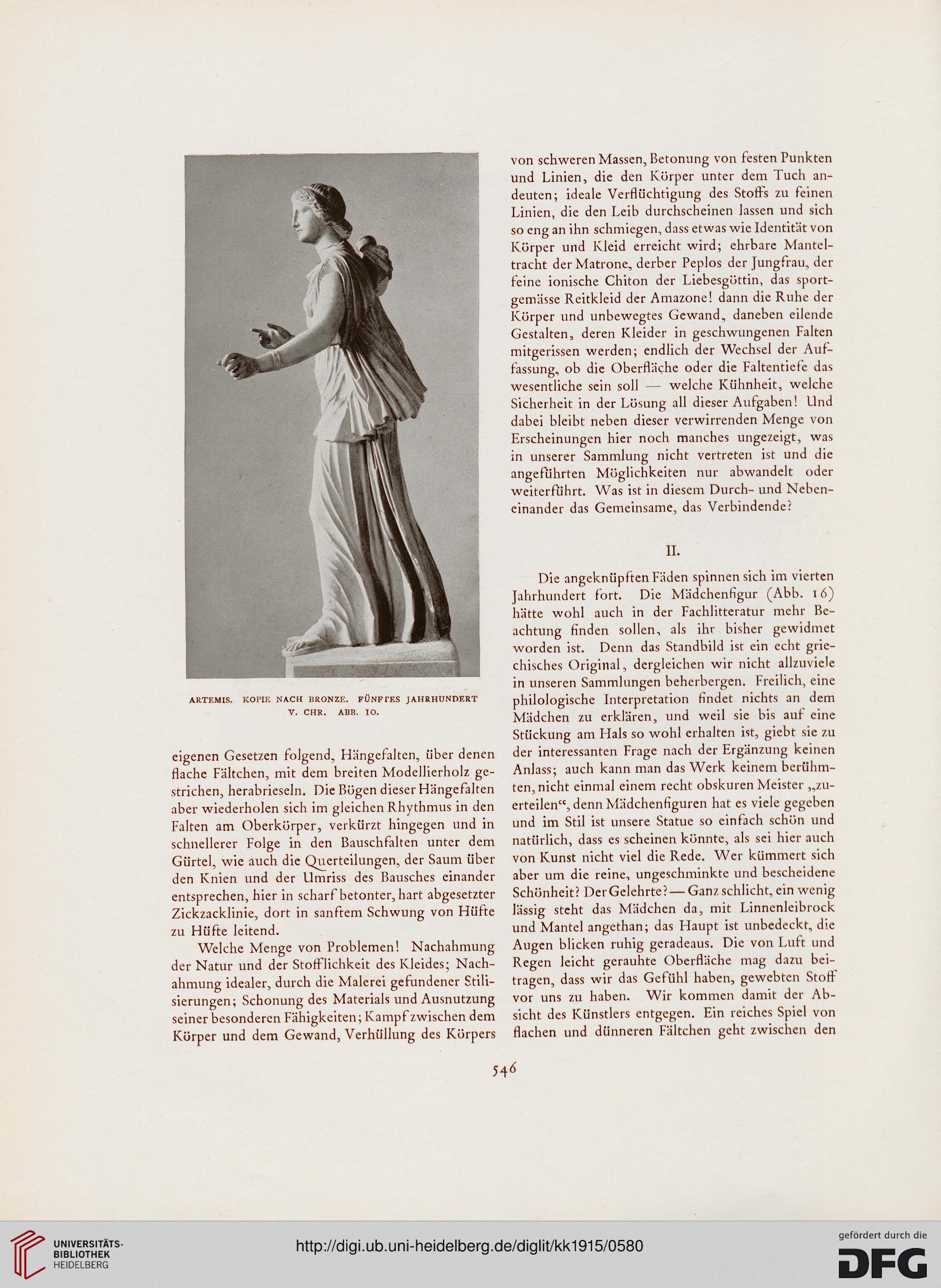KOPIE NACH BRONZE. FÜNFTES JAHRHUNDERT
V. CHR. ABB. TO.
eigenen Gesetzen folgend, Hangefaltcn, über denen
flache Fältchen, mit dem breiten Modellierholz ge-
strichen, herabrieseln. Die Bögen dieser Hängefalten
aber wiederholen sich im gleichen Rhythmus in den
Falten am Oberkörper, verkürzt hingegen und in
schnellerer Folge in den Bauschfalten unter dem
Gürtel, wie auch die Querteilungen, der Saum über
den Knien und der Umriss des Bausches einander
entsprechen, hier in scharf betonter, hart abgesetzter
Zickzacklinie, dort in sanftem Schwung von Hüfte
zu Hüfte leitend.
Welche Menge von Problemen! Nachahmung
der Natur und der Stofflichkeit des Kleides; Nach-
ahmung idealer, durch die Malerei gefundener Stili-
sierungen; Schonung des Materials und Ausnutzung
seiner besonderen Fähigkeiten; Kampf zwischen dem
Körper und dem Gewand, Verhüllung des Körpers
von schweren Massen, Betonung von festen Punkten
und Linien, die den Körper unter dem Tuch an-
deuten; ideale Verflüchtigung des Stoffs zu feinen
Linien, die den Leib durchscheinen lassen und sich
so eng an ihn schmiegen, dass etwas wie Identität von
Körper und Kleid erreicht wird; ehrbare Mantel-
tracht der Matrone, derber Peplos der Jungfrau, der
feine ionische Chiton der Liebesgöttin, das sport-
gemässe Reitkleid der Amazone! dann die Ruhe der
Körper und unbewegtes Gewand, daneben eilende
Gestalten, deren Kleider in geschwungenen Falten
mitgerissen werden; endlich der Wechsel der Auf-
fassung, ob die Oberfläche oder die Faltentiefe das
wesentliche sein soll — welche Kühnheit, welche
Sicherheit in der Lösung all dieser Aufgaben! Und
dabei bleibt neben dieser verwirrenden Menge von
Erscheinungen hier noch manches ungezeigt, was
in unserer Sammlung nicht vertreten ist und die
angeführten Möglichkeiten nur abwandelt oder
weiterführt. Was ist in diesem Durch- und Neben-
einander das Gemeinsame, das Verbindende?
IL
Die angeknüpften Fäden spinnen sich im vierten
Jahrhundert fort. Die Mädchenfigur (Abb. 16)
hätte wohl auch in der Fachlitteratur mehr Be-
achtung finden sollen, als ihr bisher gewidmet
worden ist. Denn das Standbild ist ein echt grie-
chisches Original, dergleichen wir nicht allzuviele
in unseren Sammlungen beherbergen. Freilich, eine
philologische Interpretation findet nichts an dem
Mädchen zu erklären, und weil sie bis auf eine
Stückung am Hals so wohl erhalten ist, giebt sie zu
der interessanten Frage nach der Ergänzung keinen
Anlass; auch kann man das Werk keinem berühm-
ten, nicht einmal einem recht obskuren Meister „zu-
erteilen", denn Mädchenfiguren hat es viele gegeben
und im Stil ist unsere Statue so einfach schön und
natürlich, dass es scheinen könnte, als sei hier auch
von Kunst nicht viel die Rede. Wer kümmert sich
aber um die reine, ungeschminkte und bescheidene
Schönheit? Der Gelehrte?—Ganz schlicht, ein wenig
lässig steht das Mädchen da, mit Linnenleibrock
und Mantel angethan; das Haupt ist unbedeckt, die
Augen blicken ruhig geradeaus. Die von Luft und
Regen leicht gerauhte Oberfläche mag dazu bei-
tragen, dass wir das Gefühl haben, gewebten Stoff
vor uns zu haben. Wir kommen damit der Ab-
sicht des Künstlers entgegen. Ein reiches Spiel von
flachen und dünneren Fältchen geht zwischen den
546
V. CHR. ABB. TO.
eigenen Gesetzen folgend, Hangefaltcn, über denen
flache Fältchen, mit dem breiten Modellierholz ge-
strichen, herabrieseln. Die Bögen dieser Hängefalten
aber wiederholen sich im gleichen Rhythmus in den
Falten am Oberkörper, verkürzt hingegen und in
schnellerer Folge in den Bauschfalten unter dem
Gürtel, wie auch die Querteilungen, der Saum über
den Knien und der Umriss des Bausches einander
entsprechen, hier in scharf betonter, hart abgesetzter
Zickzacklinie, dort in sanftem Schwung von Hüfte
zu Hüfte leitend.
Welche Menge von Problemen! Nachahmung
der Natur und der Stofflichkeit des Kleides; Nach-
ahmung idealer, durch die Malerei gefundener Stili-
sierungen; Schonung des Materials und Ausnutzung
seiner besonderen Fähigkeiten; Kampf zwischen dem
Körper und dem Gewand, Verhüllung des Körpers
von schweren Massen, Betonung von festen Punkten
und Linien, die den Körper unter dem Tuch an-
deuten; ideale Verflüchtigung des Stoffs zu feinen
Linien, die den Leib durchscheinen lassen und sich
so eng an ihn schmiegen, dass etwas wie Identität von
Körper und Kleid erreicht wird; ehrbare Mantel-
tracht der Matrone, derber Peplos der Jungfrau, der
feine ionische Chiton der Liebesgöttin, das sport-
gemässe Reitkleid der Amazone! dann die Ruhe der
Körper und unbewegtes Gewand, daneben eilende
Gestalten, deren Kleider in geschwungenen Falten
mitgerissen werden; endlich der Wechsel der Auf-
fassung, ob die Oberfläche oder die Faltentiefe das
wesentliche sein soll — welche Kühnheit, welche
Sicherheit in der Lösung all dieser Aufgaben! Und
dabei bleibt neben dieser verwirrenden Menge von
Erscheinungen hier noch manches ungezeigt, was
in unserer Sammlung nicht vertreten ist und die
angeführten Möglichkeiten nur abwandelt oder
weiterführt. Was ist in diesem Durch- und Neben-
einander das Gemeinsame, das Verbindende?
IL
Die angeknüpften Fäden spinnen sich im vierten
Jahrhundert fort. Die Mädchenfigur (Abb. 16)
hätte wohl auch in der Fachlitteratur mehr Be-
achtung finden sollen, als ihr bisher gewidmet
worden ist. Denn das Standbild ist ein echt grie-
chisches Original, dergleichen wir nicht allzuviele
in unseren Sammlungen beherbergen. Freilich, eine
philologische Interpretation findet nichts an dem
Mädchen zu erklären, und weil sie bis auf eine
Stückung am Hals so wohl erhalten ist, giebt sie zu
der interessanten Frage nach der Ergänzung keinen
Anlass; auch kann man das Werk keinem berühm-
ten, nicht einmal einem recht obskuren Meister „zu-
erteilen", denn Mädchenfiguren hat es viele gegeben
und im Stil ist unsere Statue so einfach schön und
natürlich, dass es scheinen könnte, als sei hier auch
von Kunst nicht viel die Rede. Wer kümmert sich
aber um die reine, ungeschminkte und bescheidene
Schönheit? Der Gelehrte?—Ganz schlicht, ein wenig
lässig steht das Mädchen da, mit Linnenleibrock
und Mantel angethan; das Haupt ist unbedeckt, die
Augen blicken ruhig geradeaus. Die von Luft und
Regen leicht gerauhte Oberfläche mag dazu bei-
tragen, dass wir das Gefühl haben, gewebten Stoff
vor uns zu haben. Wir kommen damit der Ab-
sicht des Künstlers entgegen. Ein reiches Spiel von
flachen und dünneren Fältchen geht zwischen den
546