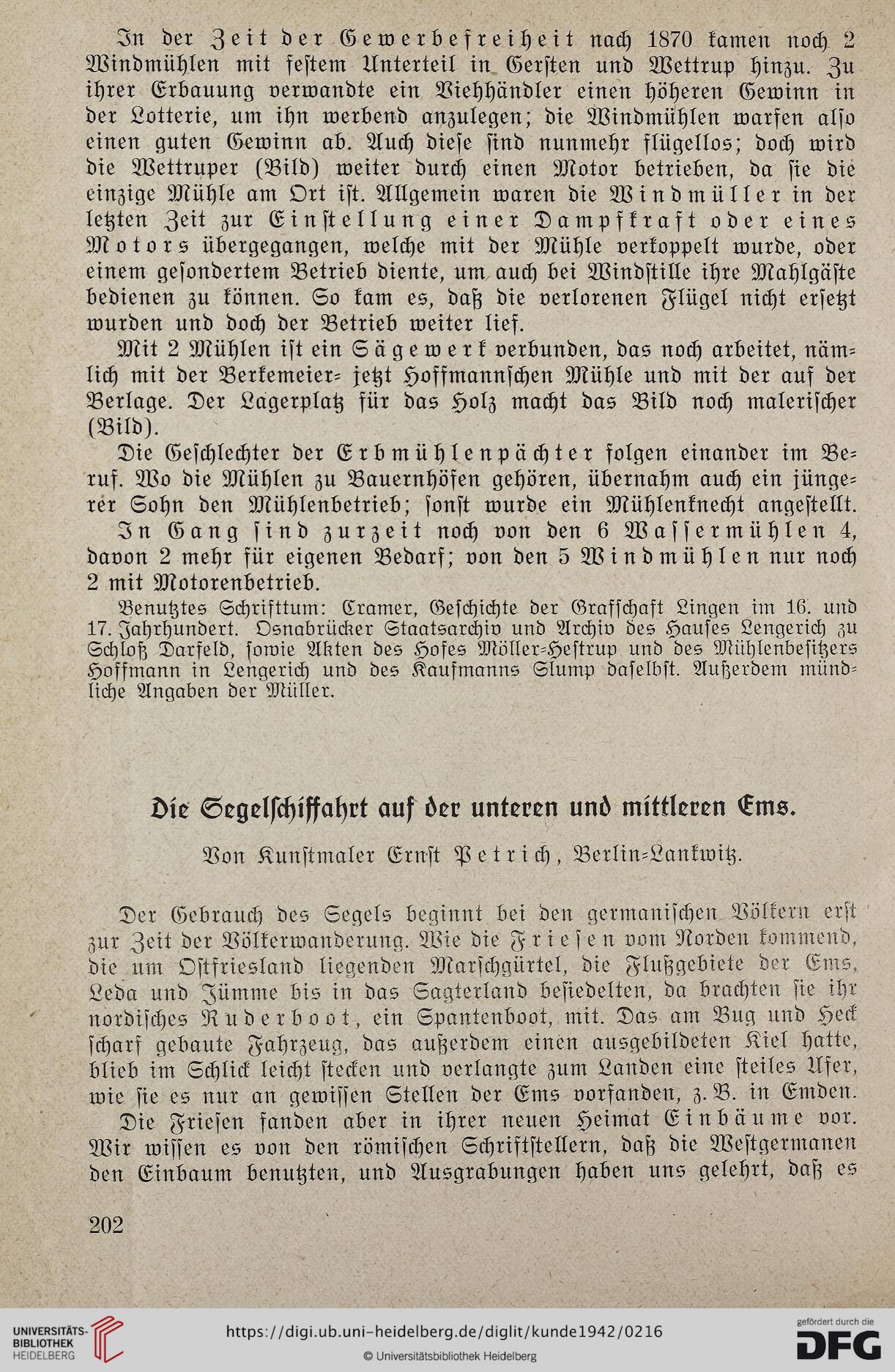In der Zeit der Gewerbefreiheit nach 1870 kamen noch 2
Windmühlen mit festem Unterteil in Gersten und Wettrup hinzu. Zu
ihrer Erbauung verwandte ein Viehhändler einen höheren Gewinn in
der Lotterie, um ihn werbend anzulegen; die Windmühlen warfen also
einen guten Gewinn ab. Auch diese sind nunmehr flügellos; doch wird
die Wettruper (Bild) weiter durch einen Motor betrieben, da sie die
einzige Mühle am Ort ist. Allgemein waren die Wind müller in der
letzten Zeit zur Einstellung einer Dampfkraft oder eines
Motors übergegangen, welche mit der Mühle verkoppelt wurde, oder
einem gesondertem Betrieb diente, um auch bei Windstille ihre Mahlgäste
bedienen zu können. So kam es, daß die verlorenen Flügel nicht ersetzt
wurden und doch der Betrieb weiter lief.
Mit 2 Mühlen ist ein Sägewerk verbunden, das noch arbeitet, näm-
lich mit der Verkemeier- jetzt Hoffmannschen Mühle und mit der auf der
Berlage. Der Lagerplatz für das Holz macht das Bild noch malerischer
(Bild).
Die Geschlechter der Erbmühlenpächter folgen einander im Be-
ruf. Wo die Mühlen zu Bauernhöfen gehören, übernahm auch ein jünge-
rer Sohn den Mühlenbetrieb; sonst wurde ein Mühlenknecht angestellt.
In Gang sind zurzeit noch von den 6 Wassermühlen 4,
davon 2 mehr für eigenen Bedarf; von den 5 Windmühlen nur noch
2 mit Motorenbetrieb.
Benutztes Schrifttum: Cramer, Geschichte der Grafschaft Lingen im 16. und
17. Jahrhundert. Osnabrücker Staatsarchiv und Archiv des Haufes Lengerich zu
Schloß Darfeld, fowie Akten des Hofes Möller-Hestrup und des Mühlenbefitzers
Hoffmann in Lengerich und des Kaufmanns Slump daselbst. Außerdem münd-
liche Angaben der Müller.
Die Segelschiffahrt auf öer unteren unö mittleren Ems.
Von Kunstmaler Ernst Petrich, Berlin-Lankwitz.
Der Gebrauch des Segels beginnt bei den germanischen Völkern erst
zur Zeit der Völkerwanderung. Wie die Friesen vom Norden kommend,
die um Ostfriesland liegenden Marschgürtel, die Flußgebiete der Ems,
Leda und Jümme bis in das Sagterland besiedelten, da brachten sie ihr
nordisches Ruderboot, ein Spantenboot, mit. Das am Bug und Heck
scharf gebaute Fahrzeug, das außerdem einen ausgebildeten Kiel hatte,
blieb im Schlick leicht stecken und verlangte zum Landen eine steiles Ufer,
wie sie es nur an gewissen Stellen der Ems vorfanden, z. B. in Emden.
Die Friesen fanden aber in ihrer neuen Heimat Einbäume vor.
Wir wissen es von den römischen Schriftstellern, daß die Westgermanen
den Einbaum benutzten, und Ausgrabungen haben uns gelehrt, daß es
202
Windmühlen mit festem Unterteil in Gersten und Wettrup hinzu. Zu
ihrer Erbauung verwandte ein Viehhändler einen höheren Gewinn in
der Lotterie, um ihn werbend anzulegen; die Windmühlen warfen also
einen guten Gewinn ab. Auch diese sind nunmehr flügellos; doch wird
die Wettruper (Bild) weiter durch einen Motor betrieben, da sie die
einzige Mühle am Ort ist. Allgemein waren die Wind müller in der
letzten Zeit zur Einstellung einer Dampfkraft oder eines
Motors übergegangen, welche mit der Mühle verkoppelt wurde, oder
einem gesondertem Betrieb diente, um auch bei Windstille ihre Mahlgäste
bedienen zu können. So kam es, daß die verlorenen Flügel nicht ersetzt
wurden und doch der Betrieb weiter lief.
Mit 2 Mühlen ist ein Sägewerk verbunden, das noch arbeitet, näm-
lich mit der Verkemeier- jetzt Hoffmannschen Mühle und mit der auf der
Berlage. Der Lagerplatz für das Holz macht das Bild noch malerischer
(Bild).
Die Geschlechter der Erbmühlenpächter folgen einander im Be-
ruf. Wo die Mühlen zu Bauernhöfen gehören, übernahm auch ein jünge-
rer Sohn den Mühlenbetrieb; sonst wurde ein Mühlenknecht angestellt.
In Gang sind zurzeit noch von den 6 Wassermühlen 4,
davon 2 mehr für eigenen Bedarf; von den 5 Windmühlen nur noch
2 mit Motorenbetrieb.
Benutztes Schrifttum: Cramer, Geschichte der Grafschaft Lingen im 16. und
17. Jahrhundert. Osnabrücker Staatsarchiv und Archiv des Haufes Lengerich zu
Schloß Darfeld, fowie Akten des Hofes Möller-Hestrup und des Mühlenbefitzers
Hoffmann in Lengerich und des Kaufmanns Slump daselbst. Außerdem münd-
liche Angaben der Müller.
Die Segelschiffahrt auf öer unteren unö mittleren Ems.
Von Kunstmaler Ernst Petrich, Berlin-Lankwitz.
Der Gebrauch des Segels beginnt bei den germanischen Völkern erst
zur Zeit der Völkerwanderung. Wie die Friesen vom Norden kommend,
die um Ostfriesland liegenden Marschgürtel, die Flußgebiete der Ems,
Leda und Jümme bis in das Sagterland besiedelten, da brachten sie ihr
nordisches Ruderboot, ein Spantenboot, mit. Das am Bug und Heck
scharf gebaute Fahrzeug, das außerdem einen ausgebildeten Kiel hatte,
blieb im Schlick leicht stecken und verlangte zum Landen eine steiles Ufer,
wie sie es nur an gewissen Stellen der Ems vorfanden, z. B. in Emden.
Die Friesen fanden aber in ihrer neuen Heimat Einbäume vor.
Wir wissen es von den römischen Schriftstellern, daß die Westgermanen
den Einbaum benutzten, und Ausgrabungen haben uns gelehrt, daß es
202