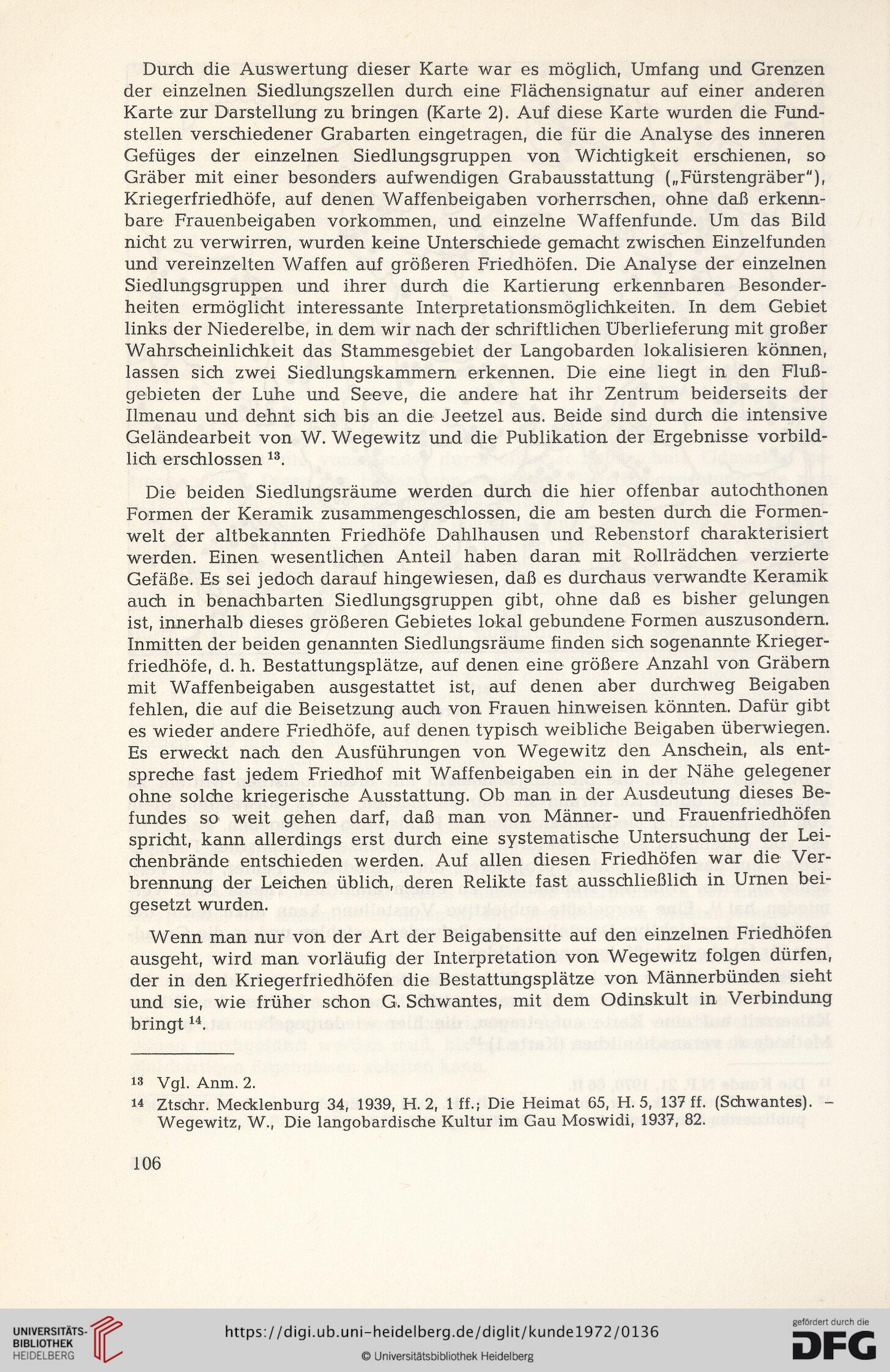Durch die Auswertung dieser Karte war es möglich, Umfang und Grenzen
der einzelnen Siedlungszellen durch eine Flächensignatur auf einer anderen
Karte zur Darstellung zu bringen (Karte 2). Auf diese Karte wurden die Fund-
stellen verschiedener Grabarten eingetragen, die für die Analyse des inneren
Gefüges der einzelnen Siedlungsgruppen von Wichtigkeit erschienen, so
Gräber mit einer besonders aufwendigen Grabausstattung („Fürstengräber"),
Kriegerfriedhöfe, auf denen Waffenbeigaben vorherrschen, ohne daß erkenn-
bare Frauenbeigaben vorkommen, und einzelne Waffenfunde. Um das Bild
nicht zu verwirren, wurden keine Unterschiede gemacht zwischen Einzelfunden
und vereinzelten Waffen auf größeren Friedhöfen. Die Analyse der einzelnen
Siedlungsgruppen und ihrer durch die Kartierung erkennbaren Besonder-
heiten ermöglicht interessante Interpretationsmöglichkeiten. In dem Gebiet
links der Niederelbe, in dem wir nach der schriftlichen Überlieferung mit großer
Wahrscheinlichkeit das Stammesgebiet der Langobarden lokalisieren können,
lassen sich zwei Siedlungskammem erkennen. Die eine liegt in den Fluß-
gebieten der Luhe und Seeve, die andere hat ihr Zentrum beiderseits der
Ilmenau und dehnt sich bis an die Jeetzel aus. Beide sind durch die intensive
Geländearbeit von W. Wegewitz und die Publikation der Ergebnisse vorbild-
lich erschlossen ".
Die beiden Siedlungsräume werden durch die hier offenbar autochthonen
Formen der Keramik zusammengeschlossen, die am besten durch die Formen-
welt der altbekannten Friedhöfe Dahlhausen und Rebenstorf charakterisiert
werden. Einen wesentlichen Anteil haben daran mit Rollrädchen verzierte
Gefäße. Es sei jedoch darauf hingewiesen, daß es durchaus verwandte Keramik
auch in benachbarten Siedlungsgruppen gibt, ohne daß es bisher gelungen
ist, innerhalb dieses größeren Gebietes lokal gebundene Formen auszusondern.
Inmitten der beiden genannten Siedlungsräume finden sich sogenannte Krieger-
friedhöfe, d. h. Bestattungsplätze, auf denen eine größere Anzahl von Gräbern
mit Waffenbeigaben ausgestattet ist, auf denen aber durchweg Beigaben
fehlen, die auf die Beisetzung auch von Frauen hinweisen könnten. Dafür gibt
es wieder andere Friedhöfe, auf denen typisch weibliche Beigaben überwiegen.
Es erweckt nach den Ausführungen von Wegewitz den Anschein, als ent-
spreche fast jedem Friedhof mit Waffenbeigaben ein in der Nähe gelegener
ohne solche kriegerische Ausstattung. Ob man in der Ausdeutung dieses Be-
fundes so weit gehen darf, daß man von Männer- und Frauenfriedhöfen
spricht, kann allerdings erst durch eine systematische Untersuchung der Lei-
chenbrände entschieden werden. Auf allen diesen Friedhöfen war die Ver-
brennung der Leichen üblich, deren Relikte fast ausschließlich in Urnen bei-
gesetzt wurden.
Wenn man nur von der Art der Beigabensitte auf den einzelnen Friedhöfen
ausgeht, wird man vorläufig der Interpretation von Wegewitz folgen dürfen,
der in den Kriegerfriedhöfen die Bestattungsplätze von Männerbünden sieht
und sie, wie früher schon G. Schwantes, mit dem Odinskult in Verbindung
bringt 14.
13 Vgl. Anm. 2.
14 Ztschr. Mecklenburg 34, 1939, H. 2, 1 ff.; Die Heimat 65, H. 5, 137 ff. (Schwantes). -
Wegewitz, W., Die langobardische Kultur im Gau Moswidi, 1937, 82.
106
der einzelnen Siedlungszellen durch eine Flächensignatur auf einer anderen
Karte zur Darstellung zu bringen (Karte 2). Auf diese Karte wurden die Fund-
stellen verschiedener Grabarten eingetragen, die für die Analyse des inneren
Gefüges der einzelnen Siedlungsgruppen von Wichtigkeit erschienen, so
Gräber mit einer besonders aufwendigen Grabausstattung („Fürstengräber"),
Kriegerfriedhöfe, auf denen Waffenbeigaben vorherrschen, ohne daß erkenn-
bare Frauenbeigaben vorkommen, und einzelne Waffenfunde. Um das Bild
nicht zu verwirren, wurden keine Unterschiede gemacht zwischen Einzelfunden
und vereinzelten Waffen auf größeren Friedhöfen. Die Analyse der einzelnen
Siedlungsgruppen und ihrer durch die Kartierung erkennbaren Besonder-
heiten ermöglicht interessante Interpretationsmöglichkeiten. In dem Gebiet
links der Niederelbe, in dem wir nach der schriftlichen Überlieferung mit großer
Wahrscheinlichkeit das Stammesgebiet der Langobarden lokalisieren können,
lassen sich zwei Siedlungskammem erkennen. Die eine liegt in den Fluß-
gebieten der Luhe und Seeve, die andere hat ihr Zentrum beiderseits der
Ilmenau und dehnt sich bis an die Jeetzel aus. Beide sind durch die intensive
Geländearbeit von W. Wegewitz und die Publikation der Ergebnisse vorbild-
lich erschlossen ".
Die beiden Siedlungsräume werden durch die hier offenbar autochthonen
Formen der Keramik zusammengeschlossen, die am besten durch die Formen-
welt der altbekannten Friedhöfe Dahlhausen und Rebenstorf charakterisiert
werden. Einen wesentlichen Anteil haben daran mit Rollrädchen verzierte
Gefäße. Es sei jedoch darauf hingewiesen, daß es durchaus verwandte Keramik
auch in benachbarten Siedlungsgruppen gibt, ohne daß es bisher gelungen
ist, innerhalb dieses größeren Gebietes lokal gebundene Formen auszusondern.
Inmitten der beiden genannten Siedlungsräume finden sich sogenannte Krieger-
friedhöfe, d. h. Bestattungsplätze, auf denen eine größere Anzahl von Gräbern
mit Waffenbeigaben ausgestattet ist, auf denen aber durchweg Beigaben
fehlen, die auf die Beisetzung auch von Frauen hinweisen könnten. Dafür gibt
es wieder andere Friedhöfe, auf denen typisch weibliche Beigaben überwiegen.
Es erweckt nach den Ausführungen von Wegewitz den Anschein, als ent-
spreche fast jedem Friedhof mit Waffenbeigaben ein in der Nähe gelegener
ohne solche kriegerische Ausstattung. Ob man in der Ausdeutung dieses Be-
fundes so weit gehen darf, daß man von Männer- und Frauenfriedhöfen
spricht, kann allerdings erst durch eine systematische Untersuchung der Lei-
chenbrände entschieden werden. Auf allen diesen Friedhöfen war die Ver-
brennung der Leichen üblich, deren Relikte fast ausschließlich in Urnen bei-
gesetzt wurden.
Wenn man nur von der Art der Beigabensitte auf den einzelnen Friedhöfen
ausgeht, wird man vorläufig der Interpretation von Wegewitz folgen dürfen,
der in den Kriegerfriedhöfen die Bestattungsplätze von Männerbünden sieht
und sie, wie früher schon G. Schwantes, mit dem Odinskult in Verbindung
bringt 14.
13 Vgl. Anm. 2.
14 Ztschr. Mecklenburg 34, 1939, H. 2, 1 ff.; Die Heimat 65, H. 5, 137 ff. (Schwantes). -
Wegewitz, W., Die langobardische Kultur im Gau Moswidi, 1937, 82.
106