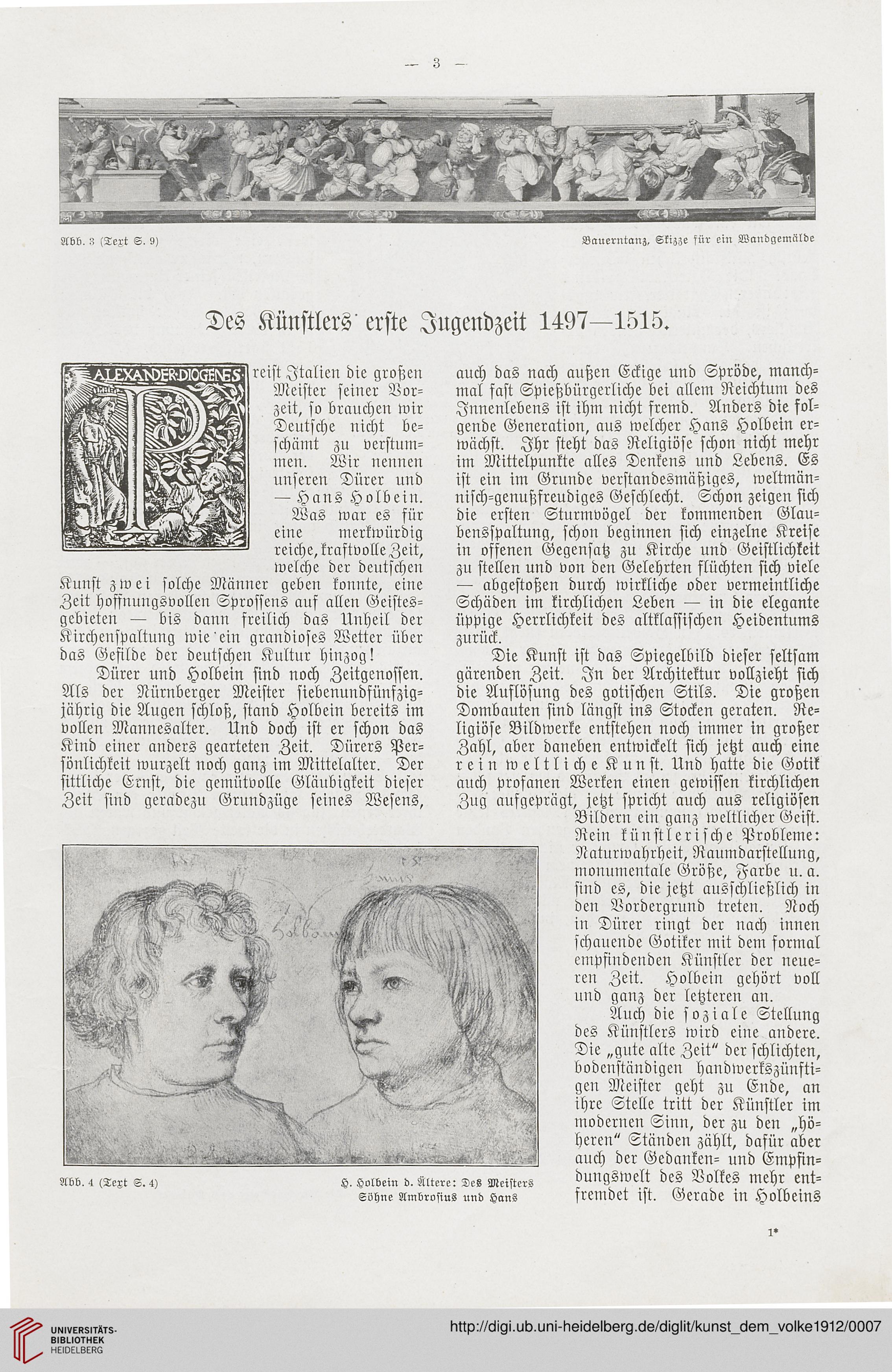s
Abb, » lText S, S)
Bauerntanz, Skizze für ein Wandgemälde
Des Künstlers erste Jugendzeit 1497—1515
reist Jtalien die großen
Meister seiner Vor-
zeit, so brauchen wir
Deutsche nicht be-
schämt zu verstum-
men. Wir nennen
unseren Dürer und
— Hans Holbein.
Was war es für
eine merkwürdig
reiche,kraftvolleZeit,
welche der deutschen
Kunst zwei solche Männer geben konnte, eine
Zeit hoffnungsvollen Sprossens auf allen Geistes-
gebieten — bis dann freilich das Unheil der
Kirchenspaltung wie ein grandioses Wetter über
das Gefilde der deutschen Kultur hinzog!
Dürer und Holbein sind noch Zeitgenossen.
Als der Nürnberger Meister siebenundfünfzig-
jährig die Augen schloß, stand Holbein bereits im
vollen Mannesalter. Und doch ist er schon das
Kind einer anders gearteten Zeit. Dürers Per-
sönlichkeit wurzelt noch ganz im Mittelalter. Der
stttliche Ernst, die gemütvolle Gläubigkeit dieser
Zeit sind geradezu Grundzüge seines Wesens,
auch das nach außen Eckige und Spröde, manch-
mal fast Spießbürgerliche bei allem Reichtum des
Jnnenlebens ist ihm nicht fremd. Anders die fol-
gende Generation, aus welcher Hans Holbein er-
wächst. Jhr steht das Religiöse schon nicht mehr
im Mittelpunkte alles Denkens und Lebens. Es
ist ein im Grunde verstandesmäßiges, weltmän-
nisch-genußfreudiges Geschlecht. Schon zeigen sich
die ersten Sturmvögel der kommenden Glau-
bensspaltung, schon beginnen fich einzelne Kreise
in offenen Gegensatz zu Kirche und Geistlichkeit
zu stellen und von den Gelehrten flüchten fich viele
— abgestoßen durch wirkliche oder vermeintliche
Schäden im kirchlichen Leben — in die elegante
üppige Herrlichkeit des altklassischen Heidentums
zurück.
Die Kunst ist das Spiegelbild dieser seltsam
gärenden Zeit. Jn der Architektur vollzieht fich
die Auflösung des gotischen Stils. Die großen
Dombauten sind längst ins Stocken geraten. Re-
ligiöse Bildwerke entstehen noch immer in großer
Zahl, aber daneben entwickelt sich jetzt auch eine
rein weltliche Kunst. Und hatte die Gotik
auch profanen Werken einen gewissen kirchlichen
Zug aufgeprügt, jetzt spricht auch aus religiösen
Bildern ein ganz weltlicher Geist.
Rein künstlerische Probleme:
Naturwahrheit, Raumdarstellung,
monumentale Größe, Farbe u. a.
sind es, die jeht ausschließlich in
den Vordergrund treten. Noch
iir Dürer ringt der nach innen
schauende Gotiker mit dem formal
empfindenden Künstler der neue-
ren Zeit. Holbein gehört voll
und ganz der letzteren an.
Auch die soziale Stellung
des Künstlers wird eine andere.
Die „gute alte Zeit" der schlichten,
bodenständigen handwerkszünfti-
gen Meister geht zu Ende, an
ihre Stelle tritt der Künstler im
modernen Sinn, der zu den „hö-
heren" Ständen zählt, dafür aber
auch der Gedanken- und Empfin-
dungswelt des Volkes mehr ent-
fremdet ist. Gerade in Holbeins
i»
Abb, » lText S, S)
Bauerntanz, Skizze für ein Wandgemälde
Des Künstlers erste Jugendzeit 1497—1515
reist Jtalien die großen
Meister seiner Vor-
zeit, so brauchen wir
Deutsche nicht be-
schämt zu verstum-
men. Wir nennen
unseren Dürer und
— Hans Holbein.
Was war es für
eine merkwürdig
reiche,kraftvolleZeit,
welche der deutschen
Kunst zwei solche Männer geben konnte, eine
Zeit hoffnungsvollen Sprossens auf allen Geistes-
gebieten — bis dann freilich das Unheil der
Kirchenspaltung wie ein grandioses Wetter über
das Gefilde der deutschen Kultur hinzog!
Dürer und Holbein sind noch Zeitgenossen.
Als der Nürnberger Meister siebenundfünfzig-
jährig die Augen schloß, stand Holbein bereits im
vollen Mannesalter. Und doch ist er schon das
Kind einer anders gearteten Zeit. Dürers Per-
sönlichkeit wurzelt noch ganz im Mittelalter. Der
stttliche Ernst, die gemütvolle Gläubigkeit dieser
Zeit sind geradezu Grundzüge seines Wesens,
auch das nach außen Eckige und Spröde, manch-
mal fast Spießbürgerliche bei allem Reichtum des
Jnnenlebens ist ihm nicht fremd. Anders die fol-
gende Generation, aus welcher Hans Holbein er-
wächst. Jhr steht das Religiöse schon nicht mehr
im Mittelpunkte alles Denkens und Lebens. Es
ist ein im Grunde verstandesmäßiges, weltmän-
nisch-genußfreudiges Geschlecht. Schon zeigen sich
die ersten Sturmvögel der kommenden Glau-
bensspaltung, schon beginnen fich einzelne Kreise
in offenen Gegensatz zu Kirche und Geistlichkeit
zu stellen und von den Gelehrten flüchten fich viele
— abgestoßen durch wirkliche oder vermeintliche
Schäden im kirchlichen Leben — in die elegante
üppige Herrlichkeit des altklassischen Heidentums
zurück.
Die Kunst ist das Spiegelbild dieser seltsam
gärenden Zeit. Jn der Architektur vollzieht fich
die Auflösung des gotischen Stils. Die großen
Dombauten sind längst ins Stocken geraten. Re-
ligiöse Bildwerke entstehen noch immer in großer
Zahl, aber daneben entwickelt sich jetzt auch eine
rein weltliche Kunst. Und hatte die Gotik
auch profanen Werken einen gewissen kirchlichen
Zug aufgeprügt, jetzt spricht auch aus religiösen
Bildern ein ganz weltlicher Geist.
Rein künstlerische Probleme:
Naturwahrheit, Raumdarstellung,
monumentale Größe, Farbe u. a.
sind es, die jeht ausschließlich in
den Vordergrund treten. Noch
iir Dürer ringt der nach innen
schauende Gotiker mit dem formal
empfindenden Künstler der neue-
ren Zeit. Holbein gehört voll
und ganz der letzteren an.
Auch die soziale Stellung
des Künstlers wird eine andere.
Die „gute alte Zeit" der schlichten,
bodenständigen handwerkszünfti-
gen Meister geht zu Ende, an
ihre Stelle tritt der Künstler im
modernen Sinn, der zu den „hö-
heren" Ständen zählt, dafür aber
auch der Gedanken- und Empfin-
dungswelt des Volkes mehr ent-
fremdet ist. Gerade in Holbeins
i»