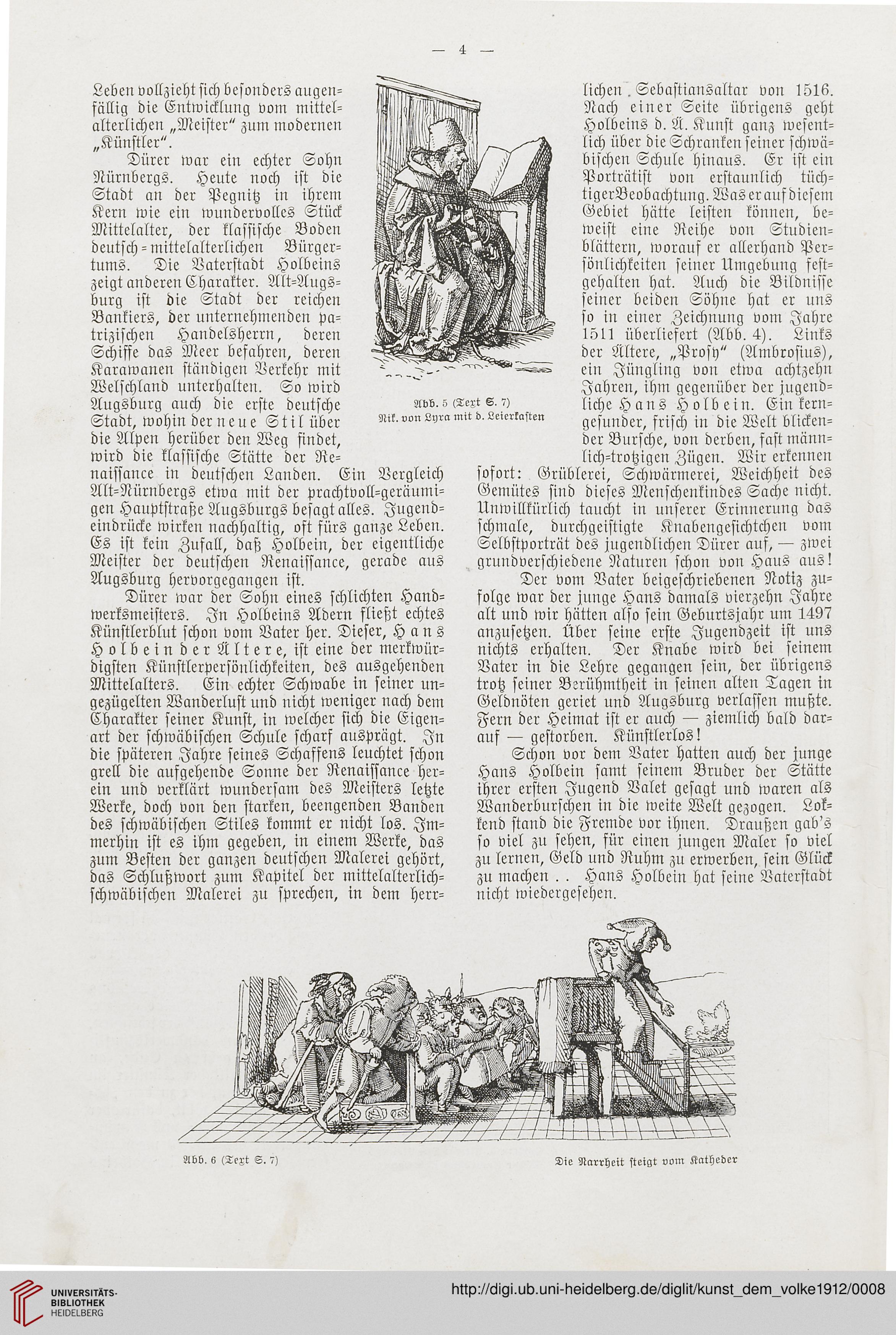Leben vollziehtsich besonders augen-
fällig die Entwicklung vom mittel-
alterlichen „Meister" zum modernen
„Künstler".
Dürer war ein echter Sohn
Nürnbergs. Heute noch ist die
Stadt an der Pegnitz in ihrem
Kern wie ein wundervolles Stück
Mittelalter, der klassische Boden
deutsch - mittelalterlichen Bürger-
tums. Die Vaterstadt Holbeins
zeigt anderen Charakter. Alt-Augs-
burg ist die Stadt der reichen
Bankiers, der unternehmenden pa-
trizischen Handelsherrn, deren
Schiffe das Meer befahren, deren
Karawanen ständigen Verkehr mit
Welschland unterhalten. So wird
Augsburg auch die erste deutsche
Stadt, wohin derneue Stil über
die Alpen herüber den Weg findet,
wird die klassische Stätte der Re-
naissance in deutschen Landen. Ein Vergleich
Alt-Nürnbergs etwa mit der prachtvoll-geräumi-
gen Hauptstraße Augsburgs besagt alles. Jugend-
eindrücke wirken nachhaltig, oft fürs ganze Leben.
Es ist kein Zufall, daß Holbein, der eigentliche
Meister der deutschen Renaissance, gerade aus
Augsburg hervorgegangen ist.
Dürer war der Sohn eines schlichten Hand-
werksmeisters. Jn Holbeins Adern fließt echtes
Künstlerblut schon vom Vater her. Dieser, Hans
Holbein der Altere, ist eine der merkwür-
digsten Künstlerpersönlichkeiten, des ausgehenden
Mittelalters. Ein echter Schwabe in seiner un-
gezügelten Wanderlust und nicht weniger nach dem
Charakter seiner Kunst, in welcher sich die Eigen-
art der schwäbischen Schule scharf ausprägt. Jn
die späteren Jahre seines Schaffens leuchtet schon
grell die aufgehende Sonne der Renaissance her-
ein und verklärt wundersam des Meisters letzte
Werke, doch von den starken, beengenden Banden
des schwäbischen Stiles kommt er nicht los. Jm-
merhin ist es ihm gegeben, in einem Werke, das
zum Besten der ganzen deutschen Malerei gehört,
das Schlußwort zum Kapitel der mittelalterlich-
schwäbischen Malerei zu sprechen, in dem herr-
lichen . Sebastiansaltar von 1516.
Nach einer Seite übrigens geht
Holbeins d. Ä. Kunst ganz wesent-
lich über die Schranken seiner schwä-
bischen Schule hinaus. Er ist ein
Porträtist von erstaunlich tüch-
tigerBeobachtung. Waseraufdiesem
Gebiet hätte leisten können, be-
weist eine Reihe von Studien-
blättern, woraus er allerhand Per-
sönlichkeiten seiner llmgebung fest-
gehalten hat. Auch die Bildnisse
seiner beiden Söhne hat er uns
so in einer Zeichnung vom Jahre
15ll überliefert (Abb. 4). Links
der Ältere, „Prosy" (Ambrosius),
ein Jüngling von etwa achtzehn
Jahren, ihm gegenüber der jugend-
liche H ans Holbein. Ein kern-
gesunder, srisch in die Welt blicken-
der Bursche, von derben, fast männ-
lich-trotzigen Zügen. Wir erkennen
sofort: Grüblerei, Schwärmerei, Weichheit des
Gemütes sind dieses Menschenkindes Sache nicht.
Unwillkürlich taucht in unserer Erinnerung das
schmale, durchgeistigte Knabengesichtchen vom
Selbstporträt des jugendlichen Dürer auf, — zwei
grundverschiedene Naturen schon von Haus aus!
Der vom Vater beigeschriebenen Notiz zu-
folge war der junge Hans damals vierzehn Jahre
alt und wir hätten also sein Geburtsjahr um 1497
anzusetzen. Über seine erste Jugendzeit ist uns
nichts erhalten. Der Knabe wird bei seinem
Vater in die Lehre gegangen sein, der übrigens
trotz seiner Berühmtheit in seinen alten Tagen in
Geldnöten geriet und Augsburg verlassen mußte.
Fern der Heimat ist er auch — ziemlich bald dar-
auf — gestorben. Künstlerlos!
Schon vor dem Vater hatten auch der junge
Hans Holbein samt seinem Bruder der Stätte
ihrer ersten Jugend Valet gesagt und waren als
Wanderburschen in die weite Welt gezogen. Lok-
kend stand die Fremde vor ihnen. Draußen gab's
so viel zu sehen, für einen jungen Maler so viel
zu lernen, Geld und Ruhm zu erwerben, sein Glück
zu machen . . Hans Holbein hat seine Vaterstadt
nicht wiedergesehen.
Abb. s (Text S, 7)
Nik. von Lyra mit d. Leierkasten
Abb, 6 (Text S. 7)
Die Narrheit steigt vom Katheder
fällig die Entwicklung vom mittel-
alterlichen „Meister" zum modernen
„Künstler".
Dürer war ein echter Sohn
Nürnbergs. Heute noch ist die
Stadt an der Pegnitz in ihrem
Kern wie ein wundervolles Stück
Mittelalter, der klassische Boden
deutsch - mittelalterlichen Bürger-
tums. Die Vaterstadt Holbeins
zeigt anderen Charakter. Alt-Augs-
burg ist die Stadt der reichen
Bankiers, der unternehmenden pa-
trizischen Handelsherrn, deren
Schiffe das Meer befahren, deren
Karawanen ständigen Verkehr mit
Welschland unterhalten. So wird
Augsburg auch die erste deutsche
Stadt, wohin derneue Stil über
die Alpen herüber den Weg findet,
wird die klassische Stätte der Re-
naissance in deutschen Landen. Ein Vergleich
Alt-Nürnbergs etwa mit der prachtvoll-geräumi-
gen Hauptstraße Augsburgs besagt alles. Jugend-
eindrücke wirken nachhaltig, oft fürs ganze Leben.
Es ist kein Zufall, daß Holbein, der eigentliche
Meister der deutschen Renaissance, gerade aus
Augsburg hervorgegangen ist.
Dürer war der Sohn eines schlichten Hand-
werksmeisters. Jn Holbeins Adern fließt echtes
Künstlerblut schon vom Vater her. Dieser, Hans
Holbein der Altere, ist eine der merkwür-
digsten Künstlerpersönlichkeiten, des ausgehenden
Mittelalters. Ein echter Schwabe in seiner un-
gezügelten Wanderlust und nicht weniger nach dem
Charakter seiner Kunst, in welcher sich die Eigen-
art der schwäbischen Schule scharf ausprägt. Jn
die späteren Jahre seines Schaffens leuchtet schon
grell die aufgehende Sonne der Renaissance her-
ein und verklärt wundersam des Meisters letzte
Werke, doch von den starken, beengenden Banden
des schwäbischen Stiles kommt er nicht los. Jm-
merhin ist es ihm gegeben, in einem Werke, das
zum Besten der ganzen deutschen Malerei gehört,
das Schlußwort zum Kapitel der mittelalterlich-
schwäbischen Malerei zu sprechen, in dem herr-
lichen . Sebastiansaltar von 1516.
Nach einer Seite übrigens geht
Holbeins d. Ä. Kunst ganz wesent-
lich über die Schranken seiner schwä-
bischen Schule hinaus. Er ist ein
Porträtist von erstaunlich tüch-
tigerBeobachtung. Waseraufdiesem
Gebiet hätte leisten können, be-
weist eine Reihe von Studien-
blättern, woraus er allerhand Per-
sönlichkeiten seiner llmgebung fest-
gehalten hat. Auch die Bildnisse
seiner beiden Söhne hat er uns
so in einer Zeichnung vom Jahre
15ll überliefert (Abb. 4). Links
der Ältere, „Prosy" (Ambrosius),
ein Jüngling von etwa achtzehn
Jahren, ihm gegenüber der jugend-
liche H ans Holbein. Ein kern-
gesunder, srisch in die Welt blicken-
der Bursche, von derben, fast männ-
lich-trotzigen Zügen. Wir erkennen
sofort: Grüblerei, Schwärmerei, Weichheit des
Gemütes sind dieses Menschenkindes Sache nicht.
Unwillkürlich taucht in unserer Erinnerung das
schmale, durchgeistigte Knabengesichtchen vom
Selbstporträt des jugendlichen Dürer auf, — zwei
grundverschiedene Naturen schon von Haus aus!
Der vom Vater beigeschriebenen Notiz zu-
folge war der junge Hans damals vierzehn Jahre
alt und wir hätten also sein Geburtsjahr um 1497
anzusetzen. Über seine erste Jugendzeit ist uns
nichts erhalten. Der Knabe wird bei seinem
Vater in die Lehre gegangen sein, der übrigens
trotz seiner Berühmtheit in seinen alten Tagen in
Geldnöten geriet und Augsburg verlassen mußte.
Fern der Heimat ist er auch — ziemlich bald dar-
auf — gestorben. Künstlerlos!
Schon vor dem Vater hatten auch der junge
Hans Holbein samt seinem Bruder der Stätte
ihrer ersten Jugend Valet gesagt und waren als
Wanderburschen in die weite Welt gezogen. Lok-
kend stand die Fremde vor ihnen. Draußen gab's
so viel zu sehen, für einen jungen Maler so viel
zu lernen, Geld und Ruhm zu erwerben, sein Glück
zu machen . . Hans Holbein hat seine Vaterstadt
nicht wiedergesehen.
Abb. s (Text S, 7)
Nik. von Lyra mit d. Leierkasten
Abb, 6 (Text S. 7)
Die Narrheit steigt vom Katheder