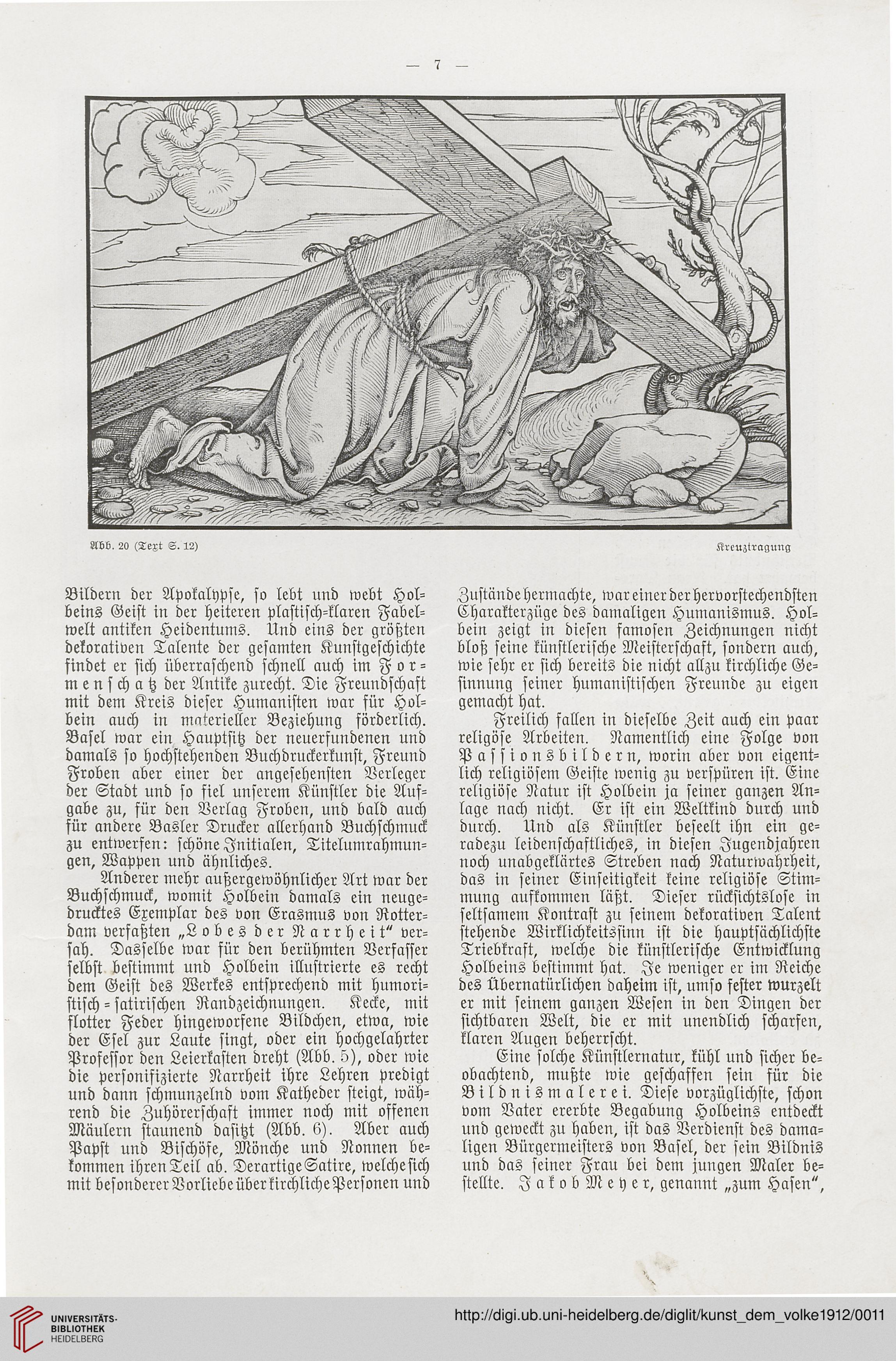7
Abb, 20 (Text S. 12)
Kreuztragung
Bildern der Apokalhpse, so lebt und webt Hol-
beins Geist in der heiteren plastisch-klaren Fabel-
welt antiken Heidentums. Und eins der größten
dekorativen Talente der gesamten Kunstgeschichte
findet er sich überraschend schnell auch im For -
menschatz der Antike zurecht. Die Freundschaft
mit dem Kreis dieser Humanisten war für Hol-
bein auch in materieller Beziehung förderlich.
Basel war ein Hauptsitz der neuerfundenen und
damals so hochstehendeu Buchdruckerkunst, Freund
Froben aber einer der angesehensten Verleger
der Stadt und so fiel unserem Künstler die Auf-
gabe zu, für den Verlag Froben, und bald auch
für andere Basler Drucker allerhand Buchschmuck
zu entwersen: schöne Jnitialen, Titelumrahmun-
gen, Wappen und ähnliches.
Anderer mehr außergewöhnlicher Art war der
Buchschmuck, womit Holbein damals ein neuge-
drucktes Exemplar des von Erasmus von Rotter-
dam verfaßten „Lobes der Narrheit" ver-
sah. Dasselbe war für den berühmten Verfasser
selbst bestimmt und Holbein illustrierte es recht
dem Geist des Werkes entsprechend mit humori-
stisch - satirischen Randzeichnungen. Kecke, mit
flotter Feder hingeworfene Bildchen, etwa, wie
der Esel zur Laute singt, oder ein hochgelahrter
Professor den Leierkasten dreht (Abb. 5), oder wie
die personifizierte Narrheit ihre Lehren predigt
und dann schmunzelnd vom Katheder steigt, wäh-
rend die Zuhörerschaft immer noch mit offenen
Mäulern staunend dasitzt (Abb. 6). Aber auch
Papst und Bischöfe, Mönche und Nonnen be-
kommen ihren Teil ab. DerartigeSatire, welchesich
mit besondererVorliebeüberkirchlichePersonen und
Zuständehermachte, wareinerderhervorstechendsten
Charakterzüge des damaligen Humanismus. Hol-
bein zeigt in diesen samosen Zeichnungen nicht
bloß seine künstlerische Meisterschaft, sondern auch,
wie sehr er sich bereits die nicht allzu kirchliche Ge-
sinnung seiner humanistischen Freunde zu eigen
gemacht hat.
Freilich fallen in dieselbe Zeit auch ein paar
religöse Arbeiten. Namentlich eine Folge von
Passionsbildern, worin aber von eigent-
lich religiösem Geiste wenig zu verspüren ist. Eine
religiöse Natur ist Holbein ja seiner ganzen An-
lage nach nicht. Er ist ein Weltkind durch und
durch. Und als Künstler beseelt ihn ein ge-
radezu leidenschaftliches, in diesen Jugendjahren
noch unabgeklärtes Streben nach Naturwahrheit,
das in seiner Einseitigkeit keine religiöse Stim-
mung aufkommen läßt. Dieser rücksichtslose in
seltsamem Kontrast zu seinem dekorativen Talent
stehende Wirklichkeitssinn ist die hauptsächlichste
Triebkraft, welche die künstlerische Entwicklung
Holbeins bestimmt hat. Je weniger er im Reiche
des übernatürlichen daheim ist, umso fester wurzelt
er mit seinem ganzen Wesen in den Dingen der
sichtbaren Welt, die er mit unendlich scharfen,
klaren Augen beherrscht.
Eine solche Künstlernatur, kühl und sicher be-
obachtend, mußte wie geschaffen sein für die
Bildnismalerei. Diese vorzüglichste, schon
vom Vater ererbte Begabung Holbeins entdeckt
und geweckt zu haben, ist das Verdienst des dama-
ligen Bürgermeisters von Basel, der sein Bildnis
und das seiner Frau bei dem jungen Maler be-
stellte. JakobMeyer, genannt „zum Hasen",
Abb, 20 (Text S. 12)
Kreuztragung
Bildern der Apokalhpse, so lebt und webt Hol-
beins Geist in der heiteren plastisch-klaren Fabel-
welt antiken Heidentums. Und eins der größten
dekorativen Talente der gesamten Kunstgeschichte
findet er sich überraschend schnell auch im For -
menschatz der Antike zurecht. Die Freundschaft
mit dem Kreis dieser Humanisten war für Hol-
bein auch in materieller Beziehung förderlich.
Basel war ein Hauptsitz der neuerfundenen und
damals so hochstehendeu Buchdruckerkunst, Freund
Froben aber einer der angesehensten Verleger
der Stadt und so fiel unserem Künstler die Auf-
gabe zu, für den Verlag Froben, und bald auch
für andere Basler Drucker allerhand Buchschmuck
zu entwersen: schöne Jnitialen, Titelumrahmun-
gen, Wappen und ähnliches.
Anderer mehr außergewöhnlicher Art war der
Buchschmuck, womit Holbein damals ein neuge-
drucktes Exemplar des von Erasmus von Rotter-
dam verfaßten „Lobes der Narrheit" ver-
sah. Dasselbe war für den berühmten Verfasser
selbst bestimmt und Holbein illustrierte es recht
dem Geist des Werkes entsprechend mit humori-
stisch - satirischen Randzeichnungen. Kecke, mit
flotter Feder hingeworfene Bildchen, etwa, wie
der Esel zur Laute singt, oder ein hochgelahrter
Professor den Leierkasten dreht (Abb. 5), oder wie
die personifizierte Narrheit ihre Lehren predigt
und dann schmunzelnd vom Katheder steigt, wäh-
rend die Zuhörerschaft immer noch mit offenen
Mäulern staunend dasitzt (Abb. 6). Aber auch
Papst und Bischöfe, Mönche und Nonnen be-
kommen ihren Teil ab. DerartigeSatire, welchesich
mit besondererVorliebeüberkirchlichePersonen und
Zuständehermachte, wareinerderhervorstechendsten
Charakterzüge des damaligen Humanismus. Hol-
bein zeigt in diesen samosen Zeichnungen nicht
bloß seine künstlerische Meisterschaft, sondern auch,
wie sehr er sich bereits die nicht allzu kirchliche Ge-
sinnung seiner humanistischen Freunde zu eigen
gemacht hat.
Freilich fallen in dieselbe Zeit auch ein paar
religöse Arbeiten. Namentlich eine Folge von
Passionsbildern, worin aber von eigent-
lich religiösem Geiste wenig zu verspüren ist. Eine
religiöse Natur ist Holbein ja seiner ganzen An-
lage nach nicht. Er ist ein Weltkind durch und
durch. Und als Künstler beseelt ihn ein ge-
radezu leidenschaftliches, in diesen Jugendjahren
noch unabgeklärtes Streben nach Naturwahrheit,
das in seiner Einseitigkeit keine religiöse Stim-
mung aufkommen läßt. Dieser rücksichtslose in
seltsamem Kontrast zu seinem dekorativen Talent
stehende Wirklichkeitssinn ist die hauptsächlichste
Triebkraft, welche die künstlerische Entwicklung
Holbeins bestimmt hat. Je weniger er im Reiche
des übernatürlichen daheim ist, umso fester wurzelt
er mit seinem ganzen Wesen in den Dingen der
sichtbaren Welt, die er mit unendlich scharfen,
klaren Augen beherrscht.
Eine solche Künstlernatur, kühl und sicher be-
obachtend, mußte wie geschaffen sein für die
Bildnismalerei. Diese vorzüglichste, schon
vom Vater ererbte Begabung Holbeins entdeckt
und geweckt zu haben, ist das Verdienst des dama-
ligen Bürgermeisters von Basel, der sein Bildnis
und das seiner Frau bei dem jungen Maler be-
stellte. JakobMeyer, genannt „zum Hasen",