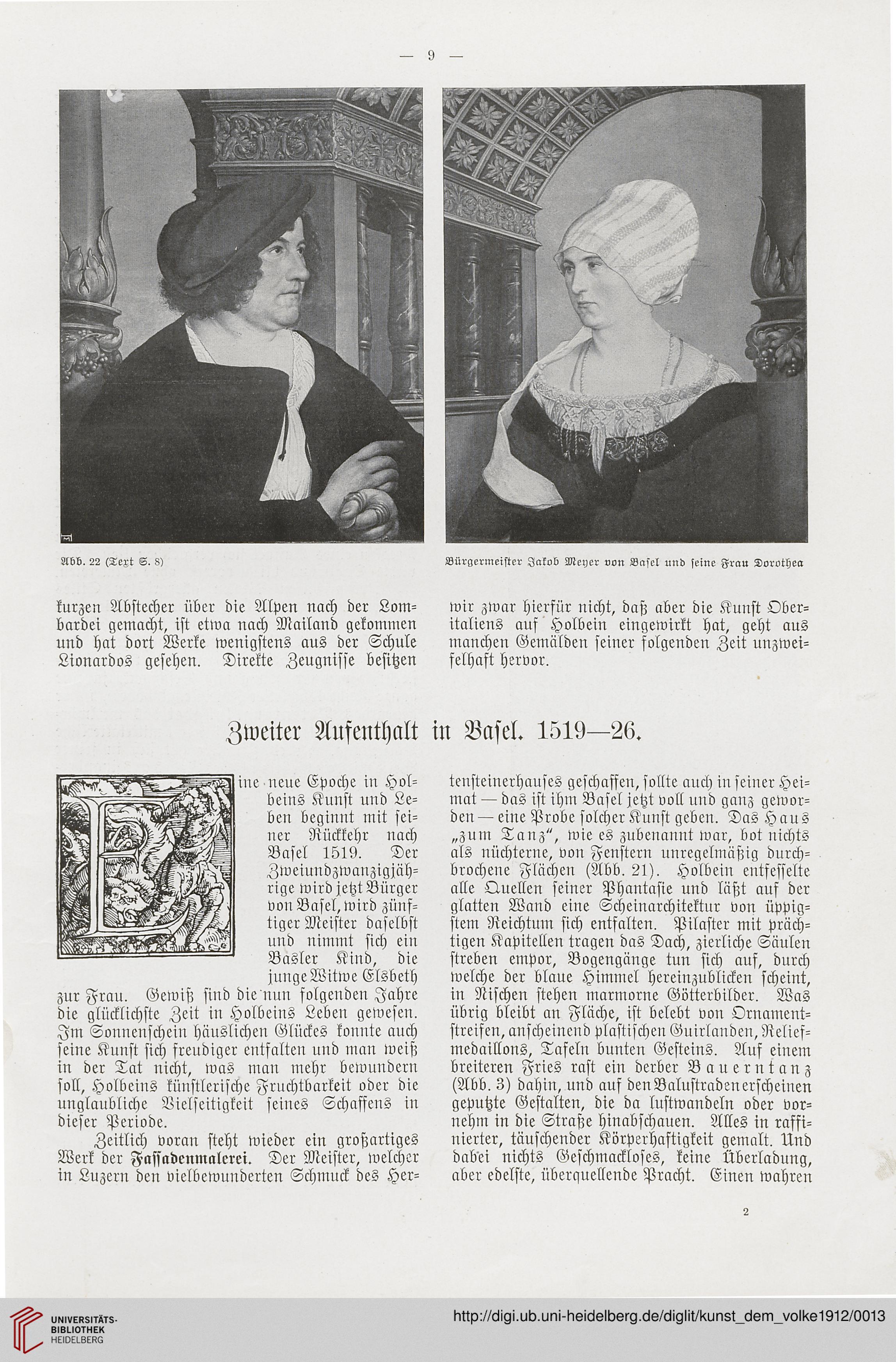9
Abb. 22 (Text S. 8) Bürgermeister Jakob Meyer von Basel und seine Frau Dorothea
kurzen Abstecher über die Alpen nach der Lom-
bardei gemacht, ist etwa nach Mailand gekommen
und hat dort Werke wenigstens aus der Schule
Lionardos gesehen. Direkte Zeugnisse besitzen
wir zwar hierfür nicht, daß aber die Kunst Ober-
italiens auf Holbein eingewirkt hat, geht aus
manchen Gemälden seiner folgenden Zeit unzwei-
felhaft hervor.
Zweiter Aufenthalt
ine neue Epoche in Hol-
beins Kunst und Le-
ben beginnt mit sei-
ner Rückkehr nach
Basel 1519. Der
Zweiundzwanzigjäh-
rige wird jetzt Bürger
von Basel,wird zünf-
tiger Meister daselbst
und nimmt sich ein
Basler Kind, die
jungeWitwe Elsbeth
zur Frau. Gewiß sind die nun folgenden Jahre
die glücklichste Zeit in Holbeins Leben gewesen.
Jm Sonnenschein häuslichen Glückes konnte auch
seine Kunst sich freudiger entfalten und man weiß
in der Tat nicht, was man mehr bewundern
soll, Holbeins künstlerische Fruchtbarkeit oder die
unglaubliche Vielseitigkeit seines Schaffens in
dieser Periode.
Zeitlich voran steht wieder ein großartiges
Werk der Fassadenmalerei. Der Meister, welcher
in Luzern den vielbewunderten Schmuck des Her-
m Basel. 1519-26.
tensteinerhauses geschaffen, sollte auch in seiner Hei-
mat — das ist ihm Basel jetzt voll und ganz gewor-
den —eine Probe solcher Kunst geben. Das Haus
„zum Tanz", wie es zubenannt war, bot nichts
als nüchterne, von Fenstern unregelmäßig durch-
brochene Flächen (Abb. 21). Holbein entfesselte
alle Quellen seiner Phantasie und läßt auf der
glatten Wand eine Scheinarchitektur von üppig-
stem Reichtum sich entsalten. Pilaster mit präch-
tigen Kapitellen tragen das Dach, zierliche Säulen
streben empor, Bogengänge tun sich auf, durch
welche der blaue Himmel hereinzublicken scheint,
in Nischen stehen marmorne Götterbilder. Was
übrig bleibt an Fläche, ist belebt von Ornament-
streifen, anscheinend plastischen Guirlanden, Relief-
medaillons, Tafeln bunten Gesteins. Auf einem
breiteren Fries rast ein derber Bauerntanz
(Abb. 3) dahin, und auf denBalustradenerscheinen
geputzte Gestalten, die da lustwandeln oder vor-
nehm in die Straße hinabschauen. Alles in raffi-
nierter, täuschender Körperhaftigkeit gemalt. Und
dabei nichts Geschmackloses, keine llberladung,
aber edelste, überquellende Pracht. Einen wahren
2
Abb. 22 (Text S. 8) Bürgermeister Jakob Meyer von Basel und seine Frau Dorothea
kurzen Abstecher über die Alpen nach der Lom-
bardei gemacht, ist etwa nach Mailand gekommen
und hat dort Werke wenigstens aus der Schule
Lionardos gesehen. Direkte Zeugnisse besitzen
wir zwar hierfür nicht, daß aber die Kunst Ober-
italiens auf Holbein eingewirkt hat, geht aus
manchen Gemälden seiner folgenden Zeit unzwei-
felhaft hervor.
Zweiter Aufenthalt
ine neue Epoche in Hol-
beins Kunst und Le-
ben beginnt mit sei-
ner Rückkehr nach
Basel 1519. Der
Zweiundzwanzigjäh-
rige wird jetzt Bürger
von Basel,wird zünf-
tiger Meister daselbst
und nimmt sich ein
Basler Kind, die
jungeWitwe Elsbeth
zur Frau. Gewiß sind die nun folgenden Jahre
die glücklichste Zeit in Holbeins Leben gewesen.
Jm Sonnenschein häuslichen Glückes konnte auch
seine Kunst sich freudiger entfalten und man weiß
in der Tat nicht, was man mehr bewundern
soll, Holbeins künstlerische Fruchtbarkeit oder die
unglaubliche Vielseitigkeit seines Schaffens in
dieser Periode.
Zeitlich voran steht wieder ein großartiges
Werk der Fassadenmalerei. Der Meister, welcher
in Luzern den vielbewunderten Schmuck des Her-
m Basel. 1519-26.
tensteinerhauses geschaffen, sollte auch in seiner Hei-
mat — das ist ihm Basel jetzt voll und ganz gewor-
den —eine Probe solcher Kunst geben. Das Haus
„zum Tanz", wie es zubenannt war, bot nichts
als nüchterne, von Fenstern unregelmäßig durch-
brochene Flächen (Abb. 21). Holbein entfesselte
alle Quellen seiner Phantasie und läßt auf der
glatten Wand eine Scheinarchitektur von üppig-
stem Reichtum sich entsalten. Pilaster mit präch-
tigen Kapitellen tragen das Dach, zierliche Säulen
streben empor, Bogengänge tun sich auf, durch
welche der blaue Himmel hereinzublicken scheint,
in Nischen stehen marmorne Götterbilder. Was
übrig bleibt an Fläche, ist belebt von Ornament-
streifen, anscheinend plastischen Guirlanden, Relief-
medaillons, Tafeln bunten Gesteins. Auf einem
breiteren Fries rast ein derber Bauerntanz
(Abb. 3) dahin, und auf denBalustradenerscheinen
geputzte Gestalten, die da lustwandeln oder vor-
nehm in die Straße hinabschauen. Alles in raffi-
nierter, täuschender Körperhaftigkeit gemalt. Und
dabei nichts Geschmackloses, keine llberladung,
aber edelste, überquellende Pracht. Einen wahren
2