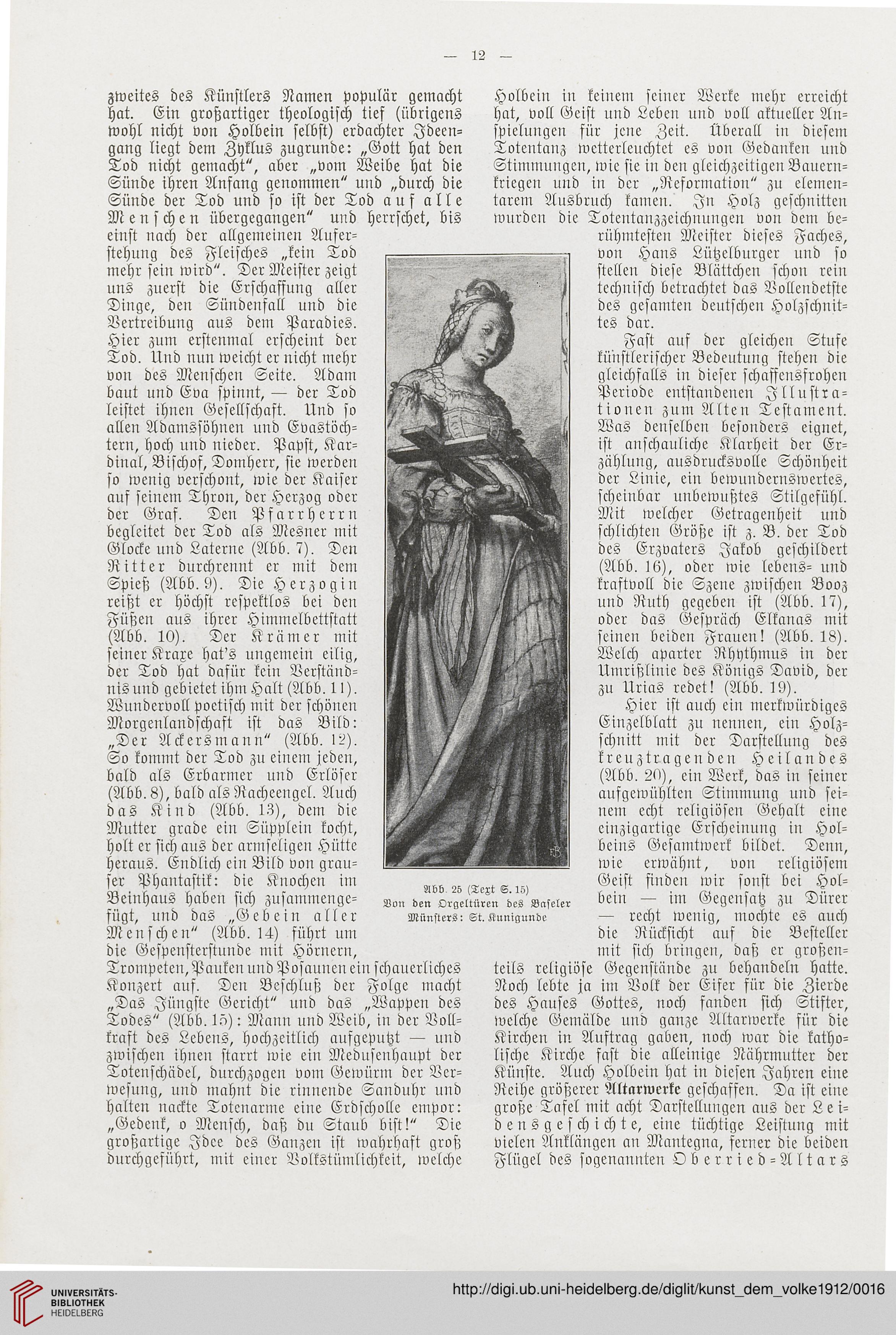12
zweites des Künstlers Namen populär gemacht
hat. Ein großartiger theologisch tief (übrigens
wohl nicht von Holbein selbst) erdachter Jdeen-
gang liegt dem Zyklus zugrunde: „Gott hat den
Tod nicht gemacht", aber „vom Weibe hat die
Sünde ihren Anfang genommen" und „durch die
Sünde der Tod und so ist der Tod auf alle
Menschen übergegangen" und herrschet, bis
einst nach der allgemeinen Aufer-
stehung des Fleisches „kein Tod
mehr sein wird". Der Meister zeigt
uns zuerst die Erschaffung aller
Dinge, den Sündenfall und die
Vertreibung aus dem Paradies.
Hier zum erstenmal erscheint der
Tod. Und nun weicht er nicht mehr
von des Menschen Seite. Adam
baut und Eva spinnt, — der Tod
leistet ihnen Gesellschaft. Und so
allen Adamssöhnen und Evastöch-
tern, hoch und nieder. Papst, Kar-
dinal, Bischof, Domherr, sie werden
so wenig verschont, wie der Kaiser
auf seinem Thron, der Herzog oder
der Graf. Den Pfarrherrn
begleitet der Tod als Mesner mit
Glocke und Laterne (Abb. 7). Den
Ritter durchrennt er mit dem
Spieß (Abb. 9). Die Herzogin
reißt er höchst respektlos bei den
Füßen aus ihrer Himmelbettstatt
(Abb. 10). Der Krämer mit
seiner Kraxe hat's ungemein eilig,
der Tod hat dafür kein Verständ-
nis und gebietet ihm Halt (Abb. II).
Wundervoll poetisch mit der schönen
Morgenlandschaft ist das Bild:
„Der Ackersmann" (Abb. U').
So kommt der Tod zu einem jeden,
bald als Erbarmer und Erlöser
(Abb. 8), bald als Racheengel. Auch
das Kind (Abb. 13), dem die
Mutter grade ein Süpplein kocht,
holt er sich aus der armseligen Hütte
heraus. Endlich ein Bild von grau-
ser Phantastik: die Knochen im
Beinhaus haben sich zusammenge-
fügt, und das „Gebein aller
Menschen" (Abb. 14) führt um
die Gespensterstunde mit Hörnern,
Trompeten, Pauken und Posaunen ein schauerliches
Konzert auf. Den Beschluß der Folge macht
„Das Jüngste Gericht" und das „Wappen des
Todes" (Abb. 15): Mann und Weib, in der Voll-
kraft des Lebens, hochzeitlich aufgeputzt — und
zwischen ihnen starrt wie ein Medusenhaupt der
Totenschädel, durchzogen vom Gewürm der Vcr-
wesung, und mahnt die rinnende Sanduhr und
Halten nackte Totenarme eine Erdscholle empor:
„Gedenk, o Mensch, daß du Staub bist!" Die
großartige Jdce des Ganzen ist wahrhaft groß
durchgeführt, mit einer Volkstümlichkeit, welche
Holbein in keinem seiner Werke mehr erreicht
hat, voll Geist und Leben und voll aktueller An-
spielungen für jene Zeit. llberall in diesem
Totentanz wetterleuchtet es von Gedanken und
Stimmungen, wie sie in den gleichzeitigen Bauern-
kriegen und in der „Reformation" zu elemen-
tarem Ausbruch kamen. Jn Holz geschnitten
wurden die Totentanzzeichnungen von dem be-
rühmtesten Meister dieses Faches,
von Hans Lützelburger und so
stellen diese Blättchen schon rein
technisch betrachtet das Vollendetste
des gesamten deutschen Holzschnit-
tes dar.
Fast auf der gleichen Stufe
künstlerischer Bedeutung stehen die
gleichfalls in dieser schaffensfrohen
Periode entstandenen Jllustra-
tionen zum Alten Testament.
Was denselben besonders eignet,
ist anschauliche Klarheit der Er-
zählung, ausdrucksvolle Schönheit
der Linie, ein bewundernswertes,
scheinbar unbewußtes Stilgesühl.
Mit welcher Getragenheit und
schlichten Größe ist z. B. der Tod
des Erzvaters Jakob geschildert
(Abb. 16), oder wie lebens- und
kraftvoll die Szene zwischen Booz
und Ruth gegeben ist (Abb. 17),
oder das Gespräch Elkanas mit
seinen beiden Frauen! (Abb. 18).
Welch aparter Rhythmus in der
Ilmrißlinie des Königs David, der
zu Urias redet! (Abb. 19).
Hier ist auch ein merkwürdiges
Einzelblatt zu nennen, ein Holz-
schnitt mit der Darstellung des
kreuztragen den Heilandes
(Abb. 20), ein Werk, das in seiner
aufgewühlten Stimmung und sei-
nem echt religiösen Gehalt eine
einzigartige Erscheinung in Hol-
beins Gesamtwerk bildet. Denn,
wie erwähnt, von religiösem
Geist finden wir sonst bei Hol-
bein — im Gegensatz zu Dürer
— recht wenig, mochte es auch
die Rücksicht auf die Besteller
mit sich bringen, daß er großen-
teils religiöse Gegenstände zu behandeln hatte.
Noch lebte ja im Volk der Eifer für die ^Zierde
des Hauses Gottes, noch fanden sich Stister,
welche Gemälde und ganze Altarwerke für die
Kirchen in Auftrag gaben, noch war die katho-
lische Kirche fast die alleinige Nährmutter der
Künste. Auch Holbein hat in diesen Jahren eine
Reihe größerer Altarwerke geschaffen. Da ist eine
große Tafel mit acht Darstellungen aus der Lei-
d e n s g e s ch i ch t e, eine tüchtige Leistung mit
vielen Anklängen an Mantegna, ferner die beiden
Flügel des sogenannten Oberried-Altars
Abb 25 <Text S. IS)
Von den Orgeltüren des Bnseler
Münsters i St. Kunignndc
zweites des Künstlers Namen populär gemacht
hat. Ein großartiger theologisch tief (übrigens
wohl nicht von Holbein selbst) erdachter Jdeen-
gang liegt dem Zyklus zugrunde: „Gott hat den
Tod nicht gemacht", aber „vom Weibe hat die
Sünde ihren Anfang genommen" und „durch die
Sünde der Tod und so ist der Tod auf alle
Menschen übergegangen" und herrschet, bis
einst nach der allgemeinen Aufer-
stehung des Fleisches „kein Tod
mehr sein wird". Der Meister zeigt
uns zuerst die Erschaffung aller
Dinge, den Sündenfall und die
Vertreibung aus dem Paradies.
Hier zum erstenmal erscheint der
Tod. Und nun weicht er nicht mehr
von des Menschen Seite. Adam
baut und Eva spinnt, — der Tod
leistet ihnen Gesellschaft. Und so
allen Adamssöhnen und Evastöch-
tern, hoch und nieder. Papst, Kar-
dinal, Bischof, Domherr, sie werden
so wenig verschont, wie der Kaiser
auf seinem Thron, der Herzog oder
der Graf. Den Pfarrherrn
begleitet der Tod als Mesner mit
Glocke und Laterne (Abb. 7). Den
Ritter durchrennt er mit dem
Spieß (Abb. 9). Die Herzogin
reißt er höchst respektlos bei den
Füßen aus ihrer Himmelbettstatt
(Abb. 10). Der Krämer mit
seiner Kraxe hat's ungemein eilig,
der Tod hat dafür kein Verständ-
nis und gebietet ihm Halt (Abb. II).
Wundervoll poetisch mit der schönen
Morgenlandschaft ist das Bild:
„Der Ackersmann" (Abb. U').
So kommt der Tod zu einem jeden,
bald als Erbarmer und Erlöser
(Abb. 8), bald als Racheengel. Auch
das Kind (Abb. 13), dem die
Mutter grade ein Süpplein kocht,
holt er sich aus der armseligen Hütte
heraus. Endlich ein Bild von grau-
ser Phantastik: die Knochen im
Beinhaus haben sich zusammenge-
fügt, und das „Gebein aller
Menschen" (Abb. 14) führt um
die Gespensterstunde mit Hörnern,
Trompeten, Pauken und Posaunen ein schauerliches
Konzert auf. Den Beschluß der Folge macht
„Das Jüngste Gericht" und das „Wappen des
Todes" (Abb. 15): Mann und Weib, in der Voll-
kraft des Lebens, hochzeitlich aufgeputzt — und
zwischen ihnen starrt wie ein Medusenhaupt der
Totenschädel, durchzogen vom Gewürm der Vcr-
wesung, und mahnt die rinnende Sanduhr und
Halten nackte Totenarme eine Erdscholle empor:
„Gedenk, o Mensch, daß du Staub bist!" Die
großartige Jdce des Ganzen ist wahrhaft groß
durchgeführt, mit einer Volkstümlichkeit, welche
Holbein in keinem seiner Werke mehr erreicht
hat, voll Geist und Leben und voll aktueller An-
spielungen für jene Zeit. llberall in diesem
Totentanz wetterleuchtet es von Gedanken und
Stimmungen, wie sie in den gleichzeitigen Bauern-
kriegen und in der „Reformation" zu elemen-
tarem Ausbruch kamen. Jn Holz geschnitten
wurden die Totentanzzeichnungen von dem be-
rühmtesten Meister dieses Faches,
von Hans Lützelburger und so
stellen diese Blättchen schon rein
technisch betrachtet das Vollendetste
des gesamten deutschen Holzschnit-
tes dar.
Fast auf der gleichen Stufe
künstlerischer Bedeutung stehen die
gleichfalls in dieser schaffensfrohen
Periode entstandenen Jllustra-
tionen zum Alten Testament.
Was denselben besonders eignet,
ist anschauliche Klarheit der Er-
zählung, ausdrucksvolle Schönheit
der Linie, ein bewundernswertes,
scheinbar unbewußtes Stilgesühl.
Mit welcher Getragenheit und
schlichten Größe ist z. B. der Tod
des Erzvaters Jakob geschildert
(Abb. 16), oder wie lebens- und
kraftvoll die Szene zwischen Booz
und Ruth gegeben ist (Abb. 17),
oder das Gespräch Elkanas mit
seinen beiden Frauen! (Abb. 18).
Welch aparter Rhythmus in der
Ilmrißlinie des Königs David, der
zu Urias redet! (Abb. 19).
Hier ist auch ein merkwürdiges
Einzelblatt zu nennen, ein Holz-
schnitt mit der Darstellung des
kreuztragen den Heilandes
(Abb. 20), ein Werk, das in seiner
aufgewühlten Stimmung und sei-
nem echt religiösen Gehalt eine
einzigartige Erscheinung in Hol-
beins Gesamtwerk bildet. Denn,
wie erwähnt, von religiösem
Geist finden wir sonst bei Hol-
bein — im Gegensatz zu Dürer
— recht wenig, mochte es auch
die Rücksicht auf die Besteller
mit sich bringen, daß er großen-
teils religiöse Gegenstände zu behandeln hatte.
Noch lebte ja im Volk der Eifer für die ^Zierde
des Hauses Gottes, noch fanden sich Stister,
welche Gemälde und ganze Altarwerke für die
Kirchen in Auftrag gaben, noch war die katho-
lische Kirche fast die alleinige Nährmutter der
Künste. Auch Holbein hat in diesen Jahren eine
Reihe größerer Altarwerke geschaffen. Da ist eine
große Tafel mit acht Darstellungen aus der Lei-
d e n s g e s ch i ch t e, eine tüchtige Leistung mit
vielen Anklängen an Mantegna, ferner die beiden
Flügel des sogenannten Oberried-Altars
Abb 25 <Text S. IS)
Von den Orgeltüren des Bnseler
Münsters i St. Kunignndc