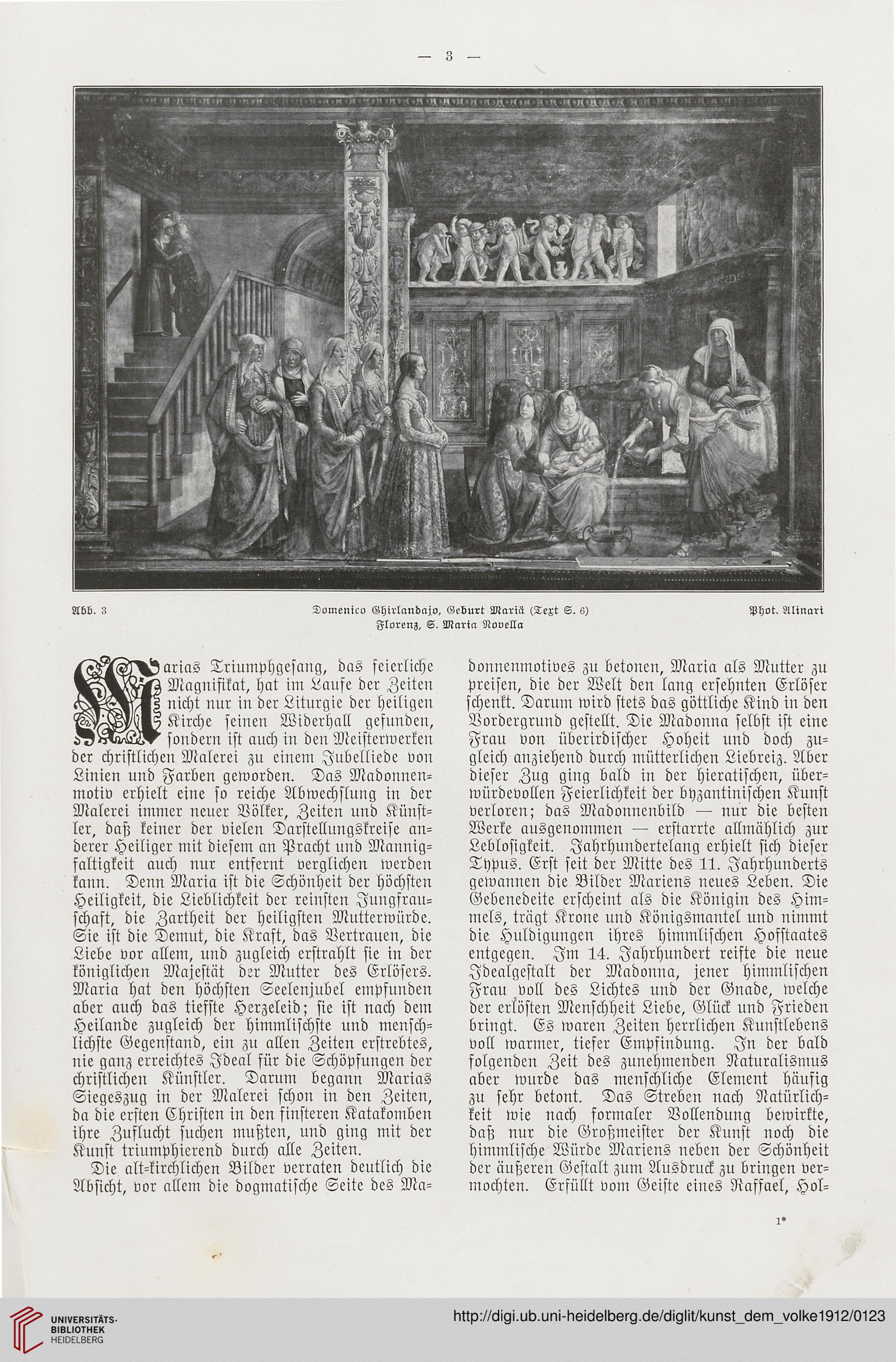3
Abb. S
Domenico Ghirlandajo, Geburt Mariä (Text S. s) Phot. Alinart
Florenz, S. Maria Novella
arias Triumphgesang, das feierliche
Magnifikat, hat im Laufe der Zeiten
nicht nur in der Liturgie der heiligen
Kirche seinen Widerhall gefunden,
sondern ist auch in den Meisterwerken
der christlichen Malerei zu einem Jubelliede von
Linien und Farben geworden. Das Madonnen-
motiv erhielt eine so reiche Abwechslung in der
Malerei immer neuer Völker, Zeiten und Künst-
ler, daß keiner der vielen Darstellnngskreise an-
derer Heiliger mit diesem an Pracht und Mannig-
faltigkeit auch nur entfernt verglichen werden
kann. Denn Maria ist die Schönheit der höchsten
Heiligkeit, die Lieblichkeit der reinsten Jungfrau-
schaft, die Zartheit der heiligsten Mutterwürde.
Sie ist die Demut, die Kraft, das Vertrauen, die
Liebe vor allem, und zugleich erstrahlt fie in der
königlichen Majestät der Mutter des Erlösers.
Maria hat den höchsten Seelenjubel empfunden
aber auch das tiefste Herzeleid; fie ist nach dem
Heilande zugleich der himmlischste und mensch-
lichste Gegenstand, ein zu allen Zeiten erstrebtes,
nie ganz erreichtes Jdeal für die Schöpfungen der
christlichen Künstler. Darum begann Marias
Siegeszug in der Malerei schon in den Zeiten,
da die ersten Christen in den finsteren Katakomben
ihre Zuflucht suchen mußten, und ging mit der
Kunst triumphierend durch alle Zeiten.
Die alt-kirchlichen Bilder verraten deutlich die
Absicht, vor allem die dogmatische Seite des Ma-
donnenmotives zu betonen, Maria als Mutter zu
preisen, die der Welt den lang ersehnten Erlöser
schenkt. Darum wird stets das göttliche Kind in den
Vordergrund gestellt. Die Madonna selbst ist eine
Frau von überirdischer Hoheit und doch zu-
gleich anziehend durch mütterlichen Liebreiz. Aber
dieser Zug ging bald in der hieratischen, über-
würdevollen Feierlichkeit der byzantinischen Kunst
verloren; das Madonnenbild — nur die besten
Werke ausgenommen — erstarrte allmählich zur
Leblofigkeit. Jahrhundertelang erhielt fich dieser
Typus. Erst seit der Mitte des 11. Jahrhunderts
gewannen die Bilder Mariens neues Leben. Die
Gebenedeite erscheint als die Königin des Him-
mels, trägt Krone und Königsmantel und nimmt
die Huldigungen ihres himmlischen Hofstaates
entgegen. Jm 14. Jahrhundert reifte die neue
Jdealgestalt der Madonna, jener Himmlischen
Frau voll des Lichtes und der Gnade, welche
der erlösten Menschheit Liebe, Glück und Frieden
bringt. Es waren Zeiten herrlichen Kunstlebens
voll warmer, tiefer Empfindung. Jn der bald
folgenden Zeit des zunehmenden Naturalismus
aber wurde das menschliche Element häufig
zu sehr betont. Das Strebsn nach Natürlich-
keit wie nach formaler Vollendung bewirkte,
daß nur die Großmeister der Kunst noch die
himmlische Würde Mariens neben der Schönheit
der äußeren Gestalt zum Ausdruck zu bringen ver-
mochten. Erfüllt vom Geiste eines Raffael, Hol-
1*
Abb. S
Domenico Ghirlandajo, Geburt Mariä (Text S. s) Phot. Alinart
Florenz, S. Maria Novella
arias Triumphgesang, das feierliche
Magnifikat, hat im Laufe der Zeiten
nicht nur in der Liturgie der heiligen
Kirche seinen Widerhall gefunden,
sondern ist auch in den Meisterwerken
der christlichen Malerei zu einem Jubelliede von
Linien und Farben geworden. Das Madonnen-
motiv erhielt eine so reiche Abwechslung in der
Malerei immer neuer Völker, Zeiten und Künst-
ler, daß keiner der vielen Darstellnngskreise an-
derer Heiliger mit diesem an Pracht und Mannig-
faltigkeit auch nur entfernt verglichen werden
kann. Denn Maria ist die Schönheit der höchsten
Heiligkeit, die Lieblichkeit der reinsten Jungfrau-
schaft, die Zartheit der heiligsten Mutterwürde.
Sie ist die Demut, die Kraft, das Vertrauen, die
Liebe vor allem, und zugleich erstrahlt fie in der
königlichen Majestät der Mutter des Erlösers.
Maria hat den höchsten Seelenjubel empfunden
aber auch das tiefste Herzeleid; fie ist nach dem
Heilande zugleich der himmlischste und mensch-
lichste Gegenstand, ein zu allen Zeiten erstrebtes,
nie ganz erreichtes Jdeal für die Schöpfungen der
christlichen Künstler. Darum begann Marias
Siegeszug in der Malerei schon in den Zeiten,
da die ersten Christen in den finsteren Katakomben
ihre Zuflucht suchen mußten, und ging mit der
Kunst triumphierend durch alle Zeiten.
Die alt-kirchlichen Bilder verraten deutlich die
Absicht, vor allem die dogmatische Seite des Ma-
donnenmotives zu betonen, Maria als Mutter zu
preisen, die der Welt den lang ersehnten Erlöser
schenkt. Darum wird stets das göttliche Kind in den
Vordergrund gestellt. Die Madonna selbst ist eine
Frau von überirdischer Hoheit und doch zu-
gleich anziehend durch mütterlichen Liebreiz. Aber
dieser Zug ging bald in der hieratischen, über-
würdevollen Feierlichkeit der byzantinischen Kunst
verloren; das Madonnenbild — nur die besten
Werke ausgenommen — erstarrte allmählich zur
Leblofigkeit. Jahrhundertelang erhielt fich dieser
Typus. Erst seit der Mitte des 11. Jahrhunderts
gewannen die Bilder Mariens neues Leben. Die
Gebenedeite erscheint als die Königin des Him-
mels, trägt Krone und Königsmantel und nimmt
die Huldigungen ihres himmlischen Hofstaates
entgegen. Jm 14. Jahrhundert reifte die neue
Jdealgestalt der Madonna, jener Himmlischen
Frau voll des Lichtes und der Gnade, welche
der erlösten Menschheit Liebe, Glück und Frieden
bringt. Es waren Zeiten herrlichen Kunstlebens
voll warmer, tiefer Empfindung. Jn der bald
folgenden Zeit des zunehmenden Naturalismus
aber wurde das menschliche Element häufig
zu sehr betont. Das Strebsn nach Natürlich-
keit wie nach formaler Vollendung bewirkte,
daß nur die Großmeister der Kunst noch die
himmlische Würde Mariens neben der Schönheit
der äußeren Gestalt zum Ausdruck zu bringen ver-
mochten. Erfüllt vom Geiste eines Raffael, Hol-
1*