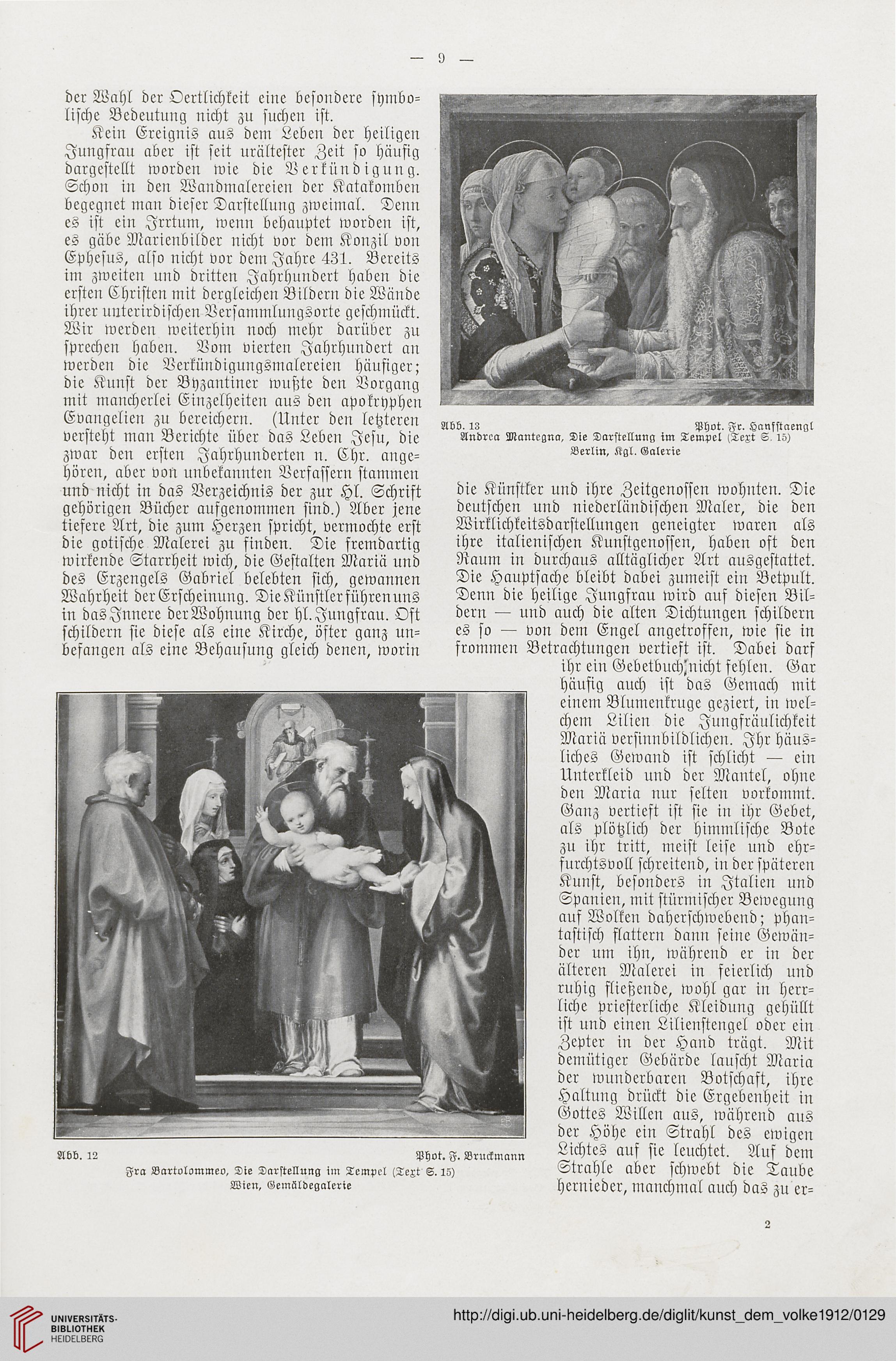9
der Wahl der Oertlichkeit eine besondere symbo-
lische Bedeutung nicht zu suchen ist.
Kein Ereignis aus dem Leben der heiligen
Jungsrau aber ist seit nraltester Zeit so häufig
dargestellt worden wie die Verkündigung.
Schon in den Wandmalereien der Katakomben
begegnet man dieser Darstellung zweimal. Denn
es ist ein Jrrtum, wenn behauptet worden ist,
es gäbe Marienbilder nicht vor dem Konzil von
Ephesus, also nicht vor dem Jahre 431. Bereits
im zweiten und dritten Jahrhundert haben die
ersten Christen mit dergleichen Bildern die Wände
ihrer unterirdischen Versammlungsorte geschmückt.
Wir werden weiterhin noch mehr darüber zu
sprechen haben. Vom vierten Jahrhundert an
werden die Verkündigungsmalereien häufiger;
die Kunst der Byzantiner wuszte den Vorgang
mit mancherlei Einzelheiten aus den apokryphen
Evangelien zu bereichern. (Unter den letzteren
versteht man Berichte über das Leben Jesu, die
zwar den ersten Jahrhunderten n. Chr. ange-
hören, aber von unbekannten Verfassern stammen
und nicht in das Verzeichnis der zur Hl. Schrift
gehörigen Bücher aufgenommen sind.) Aber jene
tiefere Art, die zum Herzen spricht, vermochte erst
die gotische Malerei zu finden. Die fremdartig
wirkende Starrheit wich, die Gestalten Mariä und
des Erzengels Gabriel belebten sich, gewannen
Wahrheit derErscheinung. DieKünstlerführenuns
in dasJnnere derWohnung der hl.Jungfrau. Oft
schildern fie diese als eine Kirche, öfter ganz un-
befangen als eine Behausung gleich denen, worin
Abb. 1S Phot. Fr. Hansstaengt
Andrra Mantcgna, Die Darstellung im Tempel sText S. 1S)
Berlin, Kgl. Galerie
die Künstler und ihre Zeitgenossen wohuten. Die
deutschen und niederländischen Maler, die den
Wirklichkeitsdarstellungen geneigter waren als
ihre italienischen Kunstgenossen, haben oft den
Raum in durchaus alltäglicher Art ausgestattet.
Die Hauptsache bleibt dabei zumeist ein Betpult.
Denn die heilige Jungfrau wird auf diesen Bil-
derir — und auch die alten Dichtungen schildern
es so — von dem Engel angetroffen, wie sie in
frommen Betrachtungen vertiest ist. Dabei darf
ihr ein Gebetbuchsnicht fehlen. Gar
häufig auch ist das Gemach mit
einem Blumenkruge geziert, in wel-
chem Lilien die Jungfräulichkeit
Mariä versinnbildlichen. Jhr häus-
liches Gewand ist schlicht — ein
Unterkleid und der Mantel, ohne
den Maria nur selten vorkommt.
Ganz vertieft ist sie in ihr Gebet,
als plötzlich der himmlische Bote
zu ihr tritt, meist leise und ehr-
surchtsvoll schreitend, in der späteren
Kunst, besonders in Jtalien und
Spanien, mit stürmischer Bewegung
aus Wolken daherschwebend; phan-
tastisch flattern dann seine Gewän-
der um ihn, während er in der
älteren Malerei in feierlich und
ruhig fließende, wohl gar in herr-
liche priesterliche Kleidung gehüllt
ist und einen Lilienstengel oder ein
Zepter in der Hand trägt. Mit
demütiger Gebärde lauscht Maria
der wunderbaren Botschaft, ihre
Haltung drückt die Ergebenheit in
Gottes Willen aus, während aus
der Höhe ein Strahl des ewigen
Lichtes auf sie leuchtet. Auf dem
Strahle aber schwebt die Taube
heruieder, manchmal auch das zu er-
Abb. 12 Phol. F. Bruckmann
Fra Bartolommeo, Dte Darstellung im Tempel IText S. IS)
Wien, GemSldegalerie
der Wahl der Oertlichkeit eine besondere symbo-
lische Bedeutung nicht zu suchen ist.
Kein Ereignis aus dem Leben der heiligen
Jungsrau aber ist seit nraltester Zeit so häufig
dargestellt worden wie die Verkündigung.
Schon in den Wandmalereien der Katakomben
begegnet man dieser Darstellung zweimal. Denn
es ist ein Jrrtum, wenn behauptet worden ist,
es gäbe Marienbilder nicht vor dem Konzil von
Ephesus, also nicht vor dem Jahre 431. Bereits
im zweiten und dritten Jahrhundert haben die
ersten Christen mit dergleichen Bildern die Wände
ihrer unterirdischen Versammlungsorte geschmückt.
Wir werden weiterhin noch mehr darüber zu
sprechen haben. Vom vierten Jahrhundert an
werden die Verkündigungsmalereien häufiger;
die Kunst der Byzantiner wuszte den Vorgang
mit mancherlei Einzelheiten aus den apokryphen
Evangelien zu bereichern. (Unter den letzteren
versteht man Berichte über das Leben Jesu, die
zwar den ersten Jahrhunderten n. Chr. ange-
hören, aber von unbekannten Verfassern stammen
und nicht in das Verzeichnis der zur Hl. Schrift
gehörigen Bücher aufgenommen sind.) Aber jene
tiefere Art, die zum Herzen spricht, vermochte erst
die gotische Malerei zu finden. Die fremdartig
wirkende Starrheit wich, die Gestalten Mariä und
des Erzengels Gabriel belebten sich, gewannen
Wahrheit derErscheinung. DieKünstlerführenuns
in dasJnnere derWohnung der hl.Jungfrau. Oft
schildern fie diese als eine Kirche, öfter ganz un-
befangen als eine Behausung gleich denen, worin
Abb. 1S Phot. Fr. Hansstaengt
Andrra Mantcgna, Die Darstellung im Tempel sText S. 1S)
Berlin, Kgl. Galerie
die Künstler und ihre Zeitgenossen wohuten. Die
deutschen und niederländischen Maler, die den
Wirklichkeitsdarstellungen geneigter waren als
ihre italienischen Kunstgenossen, haben oft den
Raum in durchaus alltäglicher Art ausgestattet.
Die Hauptsache bleibt dabei zumeist ein Betpult.
Denn die heilige Jungfrau wird auf diesen Bil-
derir — und auch die alten Dichtungen schildern
es so — von dem Engel angetroffen, wie sie in
frommen Betrachtungen vertiest ist. Dabei darf
ihr ein Gebetbuchsnicht fehlen. Gar
häufig auch ist das Gemach mit
einem Blumenkruge geziert, in wel-
chem Lilien die Jungfräulichkeit
Mariä versinnbildlichen. Jhr häus-
liches Gewand ist schlicht — ein
Unterkleid und der Mantel, ohne
den Maria nur selten vorkommt.
Ganz vertieft ist sie in ihr Gebet,
als plötzlich der himmlische Bote
zu ihr tritt, meist leise und ehr-
surchtsvoll schreitend, in der späteren
Kunst, besonders in Jtalien und
Spanien, mit stürmischer Bewegung
aus Wolken daherschwebend; phan-
tastisch flattern dann seine Gewän-
der um ihn, während er in der
älteren Malerei in feierlich und
ruhig fließende, wohl gar in herr-
liche priesterliche Kleidung gehüllt
ist und einen Lilienstengel oder ein
Zepter in der Hand trägt. Mit
demütiger Gebärde lauscht Maria
der wunderbaren Botschaft, ihre
Haltung drückt die Ergebenheit in
Gottes Willen aus, während aus
der Höhe ein Strahl des ewigen
Lichtes auf sie leuchtet. Auf dem
Strahle aber schwebt die Taube
heruieder, manchmal auch das zu er-
Abb. 12 Phol. F. Bruckmann
Fra Bartolommeo, Dte Darstellung im Tempel IText S. IS)
Wien, GemSldegalerie