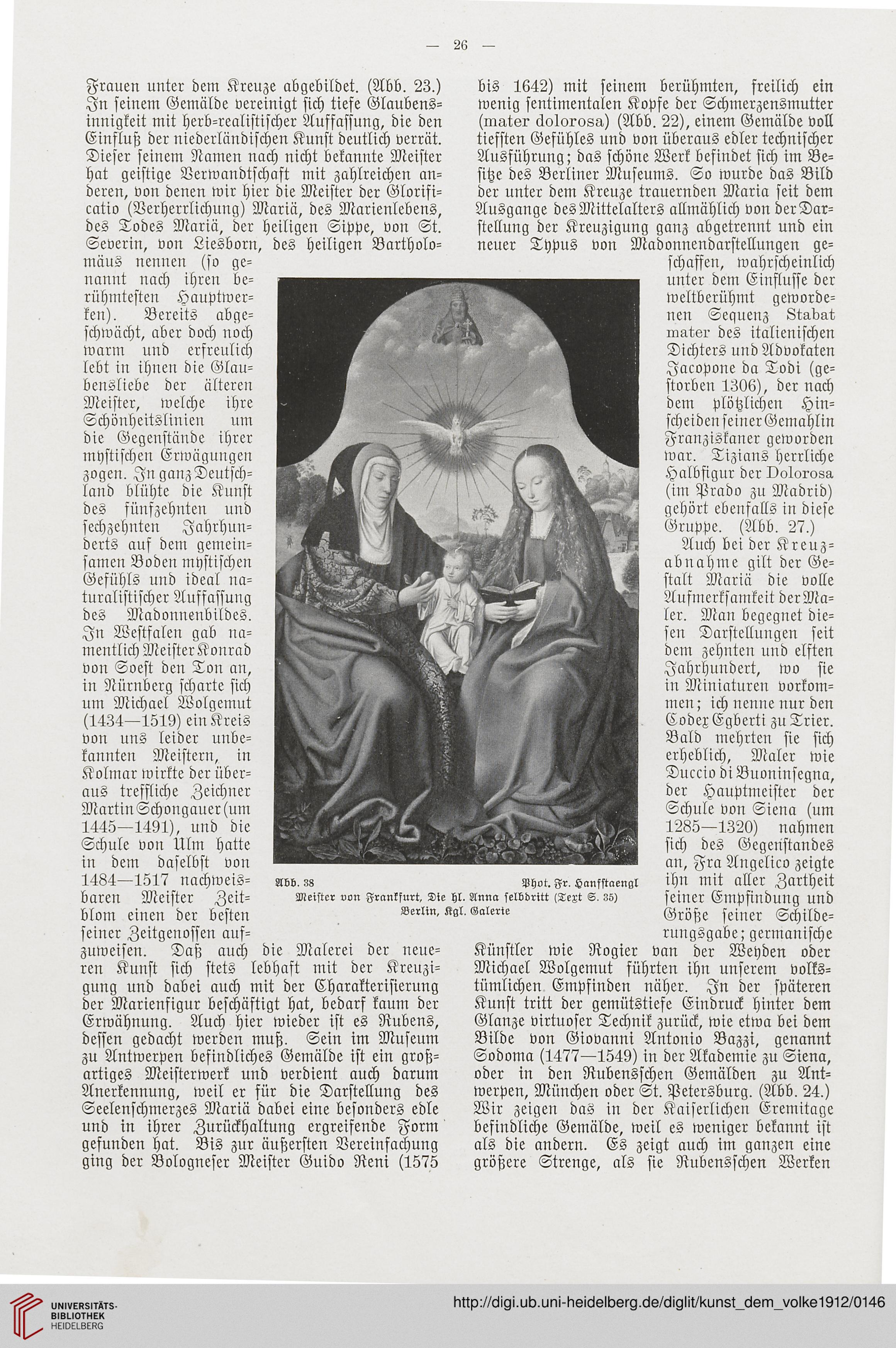26
Frauen unter dem Kreuze abgebildet. (Abb. 23.)
Jn seinem Gemälde vereinigt sich tiefe Glaubens-
innigkeit mit herb-realistischer Auffassung, die den
Einfluß der niederländischen Kunst deutlich verrät.
Dieser seinem Namen nach nicht bekannte Meister
hat geistige Verwandtschaft mit zahlreichen an-
deren, von denen wir hier die Meister der Glorifi-
catio (Verherrlichung) Mariä, des Marienlebens,
des Todes Mariä, der heiligen Sippe, von St.
Severin, von Liesborn, des heiligen Bartholo-
mäus nennen (so ge-
nannt nach ihren be-
rühmtesten Hauptwer-
ken). Bereits abge-
schwächt, aber doch noch
warm und erfreulich
lebt in ihnen die Glau-
bensliebe der alteren
Meister, welche ihre
Schönheitslinien um
die Gegenstände ihrer
mystischen Erwägungen
zogen. Jn ganzDeutsch-
land blühte die Kunst
des fünfzehnten und
sechzehnten Jahrhun-
derts auf dem gemein-
samen Boden mhstischen
Gefühls und ideal na-
turalistischer Auffassung
des Madonnenbildes.
Jn Westfalen gab na-
mentlich MeisterKonrad
von Soest den Ton an,
in Nürnberg scharte sich
um Michael Wolgemut
(1434—1519) ein Kreis
von uns leider unbe-
kannten Meistern, in
Kolmar wirkte der über-
aus treffliche Zeichner
MartinSchongauer(um
1445—1491), und die
Schule von Ulm hatte
in dem daselbst von
1484—1517 nachweis-
baren Meister Zeit-
blom einen der besten
seiner Zeitgenossen auf-
zuweisen. Daß auch die Malerei der neue-
ren Kunst sich stets lebhaft mit der Kreuzi-
gung und dabei auch mit der Charakterisierung
der Marienfigur beschäftigt hat, bedars kaum der
Erwähnung. Auch hier wieder ist es Rubens,
dessen gedacht werden muß. Sein im Museum
zu Antwerpen befindliches Gemälde ist ein groß-
artiges Meisterwerk und verdient auch darum
Anerkennung, weil er für die Darstellung des
Seelenschmerzes Mariä dabei eine besonders edle
und in ihrer Zurückhaltung ergreifende Form
gefunden hat. Bis zur äußersten Vereinsachung
ging der Bologneser Meister Guido Reni (1575
bis 1642) mit seinem berühmten, freilich ein
wenig sentimentalen Kopfe der Schmerzensmutter
(inutsr äolorosu) (Abb. 22), einem Gemälde voll
tiefsten Gefühles und von überaus edler technischer
Ausführung; das schöne Werk befindet sich im Be-
sitze des Berliner Museums. So wurde das Bild
der unter dem Kreuze trauernden Maria seit dem
Ausgange desMittelalters allmählich von derDar-
stellung der Kreuzigung ganz abgetrennt und ein
neuer Typus von Madonnendarstellungen ge-
schaffen, wahrscheinlich
unter dem Einflusse der
weltberühmt geworde-
nen Sequenz Ltabat
inatsr des italienischen
Dichters und Advokaten
Jacopone da Todi (ge-
storben 1306), der nach
dem plötzlichen Hin-
scheidenseinerGemahlin
Franziskaner geworden
war. Tizians herrliche
Halbsigur der Dolorosa
(im Prado zu Madrid)
gehört ebenfalls in diese
Gruppe. (Abb. 27.)
Auch bei der Kreuz-
abnahme gilt der Ge-
stalt Mariä die volle
Aufmerksamkeit derMa-
ler. Man begegnet die-
sen Darstellungen seit
dem zehnten und elften
Jahrhundert, wo sie
in Miniaturen vorkom-
men; ich nenne nur den
Codex Egberti zu Trier.
Bald mehrten sie sich
erheblich, Maler wie
Duccio di Buoninsegna,
der Hauptmeister der
Schule von Siena (um
1285—1320) nahmen
sich des Gegenstandes
an, Fra Angelico zeigte
ihn mit aller Zartheit
seiner Empfindung und
Größe seiner Schilde-
rungsgabe; germanische
Künstler wie Rogier van der Weyden oder
Michael Wolgemut führten ihn unserem volks-
tümlichen Empfinden näher. Jn der späteren
Kunst tritt der gemütstiefe Eindruck hinter dem
Glanze virtuoser Technik zurück, wie etwa bei dem
Bilde von Giovanni Antonio Bazzi, genannt
Sodoma (1477—1549) in der Akademie zu Siena,
oder in den Rubensschen Gemälden zu Ant-
werpen, München oder St. Petersburg. (Abb. 24.)
Wir zeigen das in der Kaiserlichen Eremitage
befindliche Gemälde, weil es weniger bekannt ist
als die andern. Es zeigt auch im ganzen eine
größere Strenge, als sie Rubensschen Werken
Abb. 88 Phot. Fr. Hansstaengl
Meister von Frankfurt, Die hl. Anna selbdritt <Text S. 88)
Berlin, Kgl. Galerie
Frauen unter dem Kreuze abgebildet. (Abb. 23.)
Jn seinem Gemälde vereinigt sich tiefe Glaubens-
innigkeit mit herb-realistischer Auffassung, die den
Einfluß der niederländischen Kunst deutlich verrät.
Dieser seinem Namen nach nicht bekannte Meister
hat geistige Verwandtschaft mit zahlreichen an-
deren, von denen wir hier die Meister der Glorifi-
catio (Verherrlichung) Mariä, des Marienlebens,
des Todes Mariä, der heiligen Sippe, von St.
Severin, von Liesborn, des heiligen Bartholo-
mäus nennen (so ge-
nannt nach ihren be-
rühmtesten Hauptwer-
ken). Bereits abge-
schwächt, aber doch noch
warm und erfreulich
lebt in ihnen die Glau-
bensliebe der alteren
Meister, welche ihre
Schönheitslinien um
die Gegenstände ihrer
mystischen Erwägungen
zogen. Jn ganzDeutsch-
land blühte die Kunst
des fünfzehnten und
sechzehnten Jahrhun-
derts auf dem gemein-
samen Boden mhstischen
Gefühls und ideal na-
turalistischer Auffassung
des Madonnenbildes.
Jn Westfalen gab na-
mentlich MeisterKonrad
von Soest den Ton an,
in Nürnberg scharte sich
um Michael Wolgemut
(1434—1519) ein Kreis
von uns leider unbe-
kannten Meistern, in
Kolmar wirkte der über-
aus treffliche Zeichner
MartinSchongauer(um
1445—1491), und die
Schule von Ulm hatte
in dem daselbst von
1484—1517 nachweis-
baren Meister Zeit-
blom einen der besten
seiner Zeitgenossen auf-
zuweisen. Daß auch die Malerei der neue-
ren Kunst sich stets lebhaft mit der Kreuzi-
gung und dabei auch mit der Charakterisierung
der Marienfigur beschäftigt hat, bedars kaum der
Erwähnung. Auch hier wieder ist es Rubens,
dessen gedacht werden muß. Sein im Museum
zu Antwerpen befindliches Gemälde ist ein groß-
artiges Meisterwerk und verdient auch darum
Anerkennung, weil er für die Darstellung des
Seelenschmerzes Mariä dabei eine besonders edle
und in ihrer Zurückhaltung ergreifende Form
gefunden hat. Bis zur äußersten Vereinsachung
ging der Bologneser Meister Guido Reni (1575
bis 1642) mit seinem berühmten, freilich ein
wenig sentimentalen Kopfe der Schmerzensmutter
(inutsr äolorosu) (Abb. 22), einem Gemälde voll
tiefsten Gefühles und von überaus edler technischer
Ausführung; das schöne Werk befindet sich im Be-
sitze des Berliner Museums. So wurde das Bild
der unter dem Kreuze trauernden Maria seit dem
Ausgange desMittelalters allmählich von derDar-
stellung der Kreuzigung ganz abgetrennt und ein
neuer Typus von Madonnendarstellungen ge-
schaffen, wahrscheinlich
unter dem Einflusse der
weltberühmt geworde-
nen Sequenz Ltabat
inatsr des italienischen
Dichters und Advokaten
Jacopone da Todi (ge-
storben 1306), der nach
dem plötzlichen Hin-
scheidenseinerGemahlin
Franziskaner geworden
war. Tizians herrliche
Halbsigur der Dolorosa
(im Prado zu Madrid)
gehört ebenfalls in diese
Gruppe. (Abb. 27.)
Auch bei der Kreuz-
abnahme gilt der Ge-
stalt Mariä die volle
Aufmerksamkeit derMa-
ler. Man begegnet die-
sen Darstellungen seit
dem zehnten und elften
Jahrhundert, wo sie
in Miniaturen vorkom-
men; ich nenne nur den
Codex Egberti zu Trier.
Bald mehrten sie sich
erheblich, Maler wie
Duccio di Buoninsegna,
der Hauptmeister der
Schule von Siena (um
1285—1320) nahmen
sich des Gegenstandes
an, Fra Angelico zeigte
ihn mit aller Zartheit
seiner Empfindung und
Größe seiner Schilde-
rungsgabe; germanische
Künstler wie Rogier van der Weyden oder
Michael Wolgemut führten ihn unserem volks-
tümlichen Empfinden näher. Jn der späteren
Kunst tritt der gemütstiefe Eindruck hinter dem
Glanze virtuoser Technik zurück, wie etwa bei dem
Bilde von Giovanni Antonio Bazzi, genannt
Sodoma (1477—1549) in der Akademie zu Siena,
oder in den Rubensschen Gemälden zu Ant-
werpen, München oder St. Petersburg. (Abb. 24.)
Wir zeigen das in der Kaiserlichen Eremitage
befindliche Gemälde, weil es weniger bekannt ist
als die andern. Es zeigt auch im ganzen eine
größere Strenge, als sie Rubensschen Werken
Abb. 88 Phot. Fr. Hansstaengl
Meister von Frankfurt, Die hl. Anna selbdritt <Text S. 88)
Berlin, Kgl. Galerie