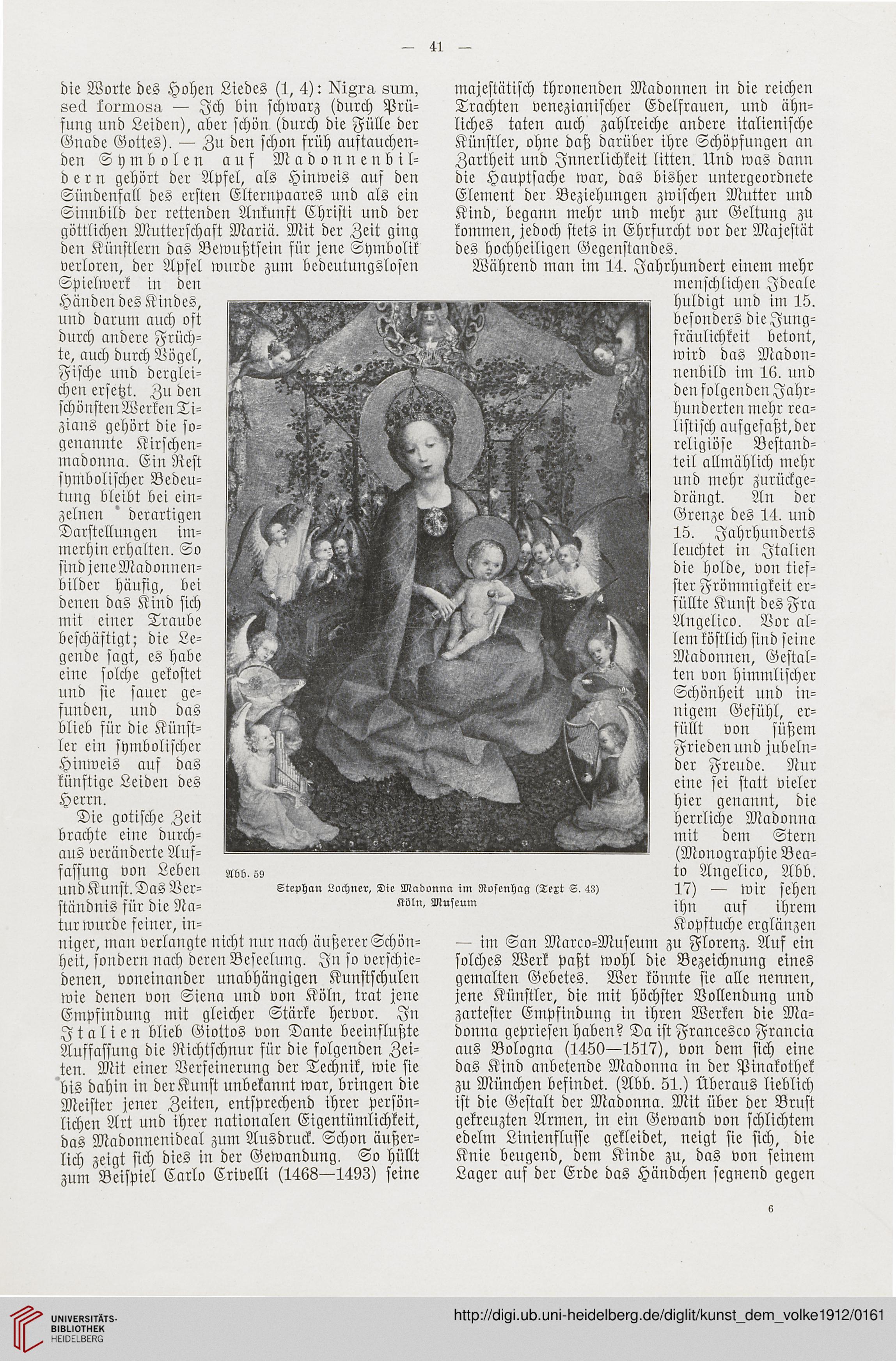41
die Worte des Hohen Liedes (1, 4): MZrn snni,
8sci Loi'iiiosn — Jch bin schwarz (durch Prü-
sung und Leiden), aber schön (durch die Fülle der
Gnade Gottes). — Zu den schon früh auftauchen-
den Symbolen auf Madonnenbil-
dern gehört der Apfel, als Hinweis auf den
Sündenfall des ersten Elternpaares und als ein
Sinnbild der rettenden Ankunft Chrifti und der
göttlichen Mutterschast Mariä. Mit der Zeit ging
den Künstlern das Bewußtsein für jene Symbolik
verloren, der Apfel wurde zum bedeutungslosen
Spielwerk in den
HändendesKindes,
und darum auch oft
durch andere Früch-
te, auch durch Vögel,
Fische und derglei-
chen ersetzt. Zu den
schönstenWerkenTi-
zians gehört die so-
genannte Kirschen-
madonna. Ein Rest
symbolischer Bedeu-
tung bleibt bei ein-
zelnen derartigen
Darstellungen im-
merhin erhalten. So
sindjeneMadonnen-
bilder häufig, bei
denen das Kind sich
mit einer Traube
beschäftigt; die Le-
gende sagt, es habe
eine solche gekostet
und sie sauer ge-
funden, und das
blieb für die Künst-
ler ein symbolischer
Hinweis auf das
künftige Leiden des
Herrn.
Die gotische Zeit
brachte eine durch-
aus veränderte Auf-
fassung von Leben
undKunst.DasVer-
ständnis für die Na-
tur wurde feiner, in-
niger, man verlangte nicht nur nach äußerer Schön-
heit, sondern nach deren Beseelung. Jn so verschie-
denen, voneinander unabhängigen Kunstschulen
wie denen von Siena und von Köln, trat jene
Empfindung mit gleicher Stärke hervor. Jn
Italien blieb Giottos von Dante beeinflußte
Auffassung die Richtschnur für die folgenden Zei-
ten. Mit einer Verfeinerung der Technik, wie sie
bis dahin in derKunst unbekannt war, bringen die
Meister jener Zeiten, entsprechend ihrer persön-
lichen Art und ihrer nationalen Eigentümlichkeit,
das Madonnenideal zum Ausdruck. Schon äußer-
lich zeigt sich dies in der Gewandung. So hüllt
zum Beispiel Carlo Crivelli (1468—1493) seine
Abb. öS
Stephan Lochner, Die Madonna im Rosenhag (Text S. 4S)
Köln, Museum
majestätisch thronenden Madonnen in die reichen
Trachten venezianischer Edelfrauen, und ähn-
liches taten auch zahlreiche andere italienische
Künstler, ohne daß darüber ihre Schöpfungen an
Zartheit und Jnnerlichkeit litten. Und was dann
die Hauptsache war, das bisher untergeordnete
Element der Beziehungen zwischen Mutter und
Kind, begann mehr und mehr zur Geltung zu
kommen, jedoch stets in Ehrfurcht vor der Majestät
des hochheiligen Gegenstandes.
Während man im 14. Jahrhundert einem mehr
menschlichen Jdeate
huldigt und im 15.
besonders die Jung-
fräulichkeit betont,
wird das Madon-
nenbild im 16. und
den folgendenJahr-
hunderten mehr rea-
listisch aufgefaßt,der
religiöse Bestand-
teil allmählich mehr
und mehr zurückge-
drängt. An der
Grenze des 14. und
15. Jahrhunderts
leuchtet in Jtalien
die holde, von tief-
ster Frömmigkeit er-
füllte Kunst des Fra
Angelico. Vor al-
lem köstlich sind seine
Madonnen, Gestal-
ten von himmlischer
Schönheit und in-
nigem Gefühl, er-
füllt von süßem
Frieden und jubeln-
der Freude. Nur
eine sei statt vieler
hier genannt, die
herrliche Madonna
mit dem Stern
(MonographieBea-
to Angelico, Abb.
17) — wir sehen
ihn auf ihrem
Kopftuche erglänzen
— im San Marco-Museum zu Florenz. Aus ein
solches Werk paßt wohl die Bezeichnung eines
gemalten Gebetes. Wer könnte sie alle nennen,
jene Künstler, die mit höchster Vollendung und
zartester Empfindung in ihren Werken die Ma-
donna gepriesen haben? Da ist Francesco Francia
aus Bologna (1450—1517), von dem sich eine
das Kind anbetende Madonna in der Pinakothek
zu München befindet. (Abb. 51.) Überaus lieblich
ist die Gestalt der Madonna. Mit über der Brust
gekreuzten Armen, in ein Gewand von schlichtem
edelm Linienflusse gekleidet, neigt sie sich, die
Knie beugend, dem Kinde zu, das von seinem
Lager auf der Erde das Händchen segnend gegen
6
die Worte des Hohen Liedes (1, 4): MZrn snni,
8sci Loi'iiiosn — Jch bin schwarz (durch Prü-
sung und Leiden), aber schön (durch die Fülle der
Gnade Gottes). — Zu den schon früh auftauchen-
den Symbolen auf Madonnenbil-
dern gehört der Apfel, als Hinweis auf den
Sündenfall des ersten Elternpaares und als ein
Sinnbild der rettenden Ankunft Chrifti und der
göttlichen Mutterschast Mariä. Mit der Zeit ging
den Künstlern das Bewußtsein für jene Symbolik
verloren, der Apfel wurde zum bedeutungslosen
Spielwerk in den
HändendesKindes,
und darum auch oft
durch andere Früch-
te, auch durch Vögel,
Fische und derglei-
chen ersetzt. Zu den
schönstenWerkenTi-
zians gehört die so-
genannte Kirschen-
madonna. Ein Rest
symbolischer Bedeu-
tung bleibt bei ein-
zelnen derartigen
Darstellungen im-
merhin erhalten. So
sindjeneMadonnen-
bilder häufig, bei
denen das Kind sich
mit einer Traube
beschäftigt; die Le-
gende sagt, es habe
eine solche gekostet
und sie sauer ge-
funden, und das
blieb für die Künst-
ler ein symbolischer
Hinweis auf das
künftige Leiden des
Herrn.
Die gotische Zeit
brachte eine durch-
aus veränderte Auf-
fassung von Leben
undKunst.DasVer-
ständnis für die Na-
tur wurde feiner, in-
niger, man verlangte nicht nur nach äußerer Schön-
heit, sondern nach deren Beseelung. Jn so verschie-
denen, voneinander unabhängigen Kunstschulen
wie denen von Siena und von Köln, trat jene
Empfindung mit gleicher Stärke hervor. Jn
Italien blieb Giottos von Dante beeinflußte
Auffassung die Richtschnur für die folgenden Zei-
ten. Mit einer Verfeinerung der Technik, wie sie
bis dahin in derKunst unbekannt war, bringen die
Meister jener Zeiten, entsprechend ihrer persön-
lichen Art und ihrer nationalen Eigentümlichkeit,
das Madonnenideal zum Ausdruck. Schon äußer-
lich zeigt sich dies in der Gewandung. So hüllt
zum Beispiel Carlo Crivelli (1468—1493) seine
Abb. öS
Stephan Lochner, Die Madonna im Rosenhag (Text S. 4S)
Köln, Museum
majestätisch thronenden Madonnen in die reichen
Trachten venezianischer Edelfrauen, und ähn-
liches taten auch zahlreiche andere italienische
Künstler, ohne daß darüber ihre Schöpfungen an
Zartheit und Jnnerlichkeit litten. Und was dann
die Hauptsache war, das bisher untergeordnete
Element der Beziehungen zwischen Mutter und
Kind, begann mehr und mehr zur Geltung zu
kommen, jedoch stets in Ehrfurcht vor der Majestät
des hochheiligen Gegenstandes.
Während man im 14. Jahrhundert einem mehr
menschlichen Jdeate
huldigt und im 15.
besonders die Jung-
fräulichkeit betont,
wird das Madon-
nenbild im 16. und
den folgendenJahr-
hunderten mehr rea-
listisch aufgefaßt,der
religiöse Bestand-
teil allmählich mehr
und mehr zurückge-
drängt. An der
Grenze des 14. und
15. Jahrhunderts
leuchtet in Jtalien
die holde, von tief-
ster Frömmigkeit er-
füllte Kunst des Fra
Angelico. Vor al-
lem köstlich sind seine
Madonnen, Gestal-
ten von himmlischer
Schönheit und in-
nigem Gefühl, er-
füllt von süßem
Frieden und jubeln-
der Freude. Nur
eine sei statt vieler
hier genannt, die
herrliche Madonna
mit dem Stern
(MonographieBea-
to Angelico, Abb.
17) — wir sehen
ihn auf ihrem
Kopftuche erglänzen
— im San Marco-Museum zu Florenz. Aus ein
solches Werk paßt wohl die Bezeichnung eines
gemalten Gebetes. Wer könnte sie alle nennen,
jene Künstler, die mit höchster Vollendung und
zartester Empfindung in ihren Werken die Ma-
donna gepriesen haben? Da ist Francesco Francia
aus Bologna (1450—1517), von dem sich eine
das Kind anbetende Madonna in der Pinakothek
zu München befindet. (Abb. 51.) Überaus lieblich
ist die Gestalt der Madonna. Mit über der Brust
gekreuzten Armen, in ein Gewand von schlichtem
edelm Linienflusse gekleidet, neigt sie sich, die
Knie beugend, dem Kinde zu, das von seinem
Lager auf der Erde das Händchen segnend gegen
6