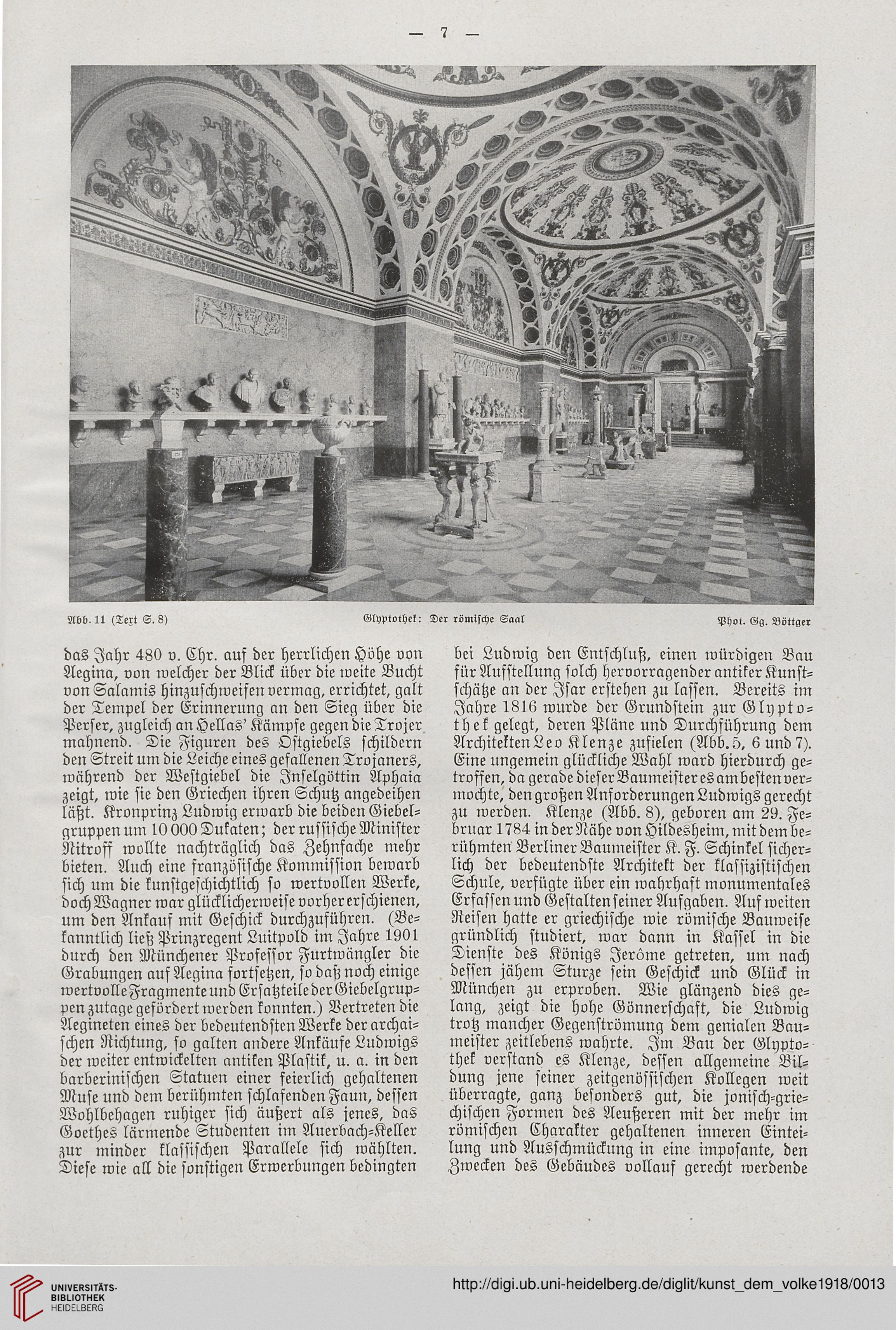7
Abb. 11 (Tert S. 8) Glyptothek: Der römische Saal Pho«. Gg. Böttger
das Jahr 480 v. Chr. auf der herrlichen Höhe von
Aegina, von welcher der Blick über die iveite Bucht
von Salamis hinzuschweifen vermag, errichtet, galt
der Tempel der Erinnerung an den Sieg über die
Perser, zugleich an Hellas' Kämpfe gegen dieTrojer
mahnend. Die Figuren des Ostgiebels schildern
den Streit um die Leiche eines gefallenen Trojaners,
während der Westgiebel die Jnselgöttin Aphaia
zeigt, wie sie den Griechen ihren Schutz angedeihen
läßt. Kronprinz Ludwig erwarb die beiden Giebel-
gruppenum lOOOODukaten; derrussischeMinister
Nitroff wollte nachträglich das Zehnfache mehr
bieten. Auch eine französische Kommission bewarb
sich um die kunstgeschichtlich so wertvollen Werke,
doch Wagner war glücklicherweise vorher erschienen,
um den Ankauf mit Geschick durchzuführen. (Be-
kanntlich ließ Prinzregent Luitpold im Jahre 1901
durch den Münchener Professor Furtwängler die
Grabungen auf Aegina fortsetzen, so daß noch einige
wertvolleFragmenteund ErsatzteilederGiebelgrup-
penzutage gefördertwerden konnten.) Vertreten die
Aegineten eines der bedeutendstenWerke der archai-
schen Richtung, so galten andere Ankäufe Ludwigs
der weiter entwickelten antiken Plastik, u. a. in den
barberinischen Statuen einer feierlich gehaltenen
Muse und dem berühmten schlafenden Faun, dessen
Wohlbehagen ruhiger sich äußert als jenes, das
Goethes lärmende Studenten im Auerbach-Keller
zur minder klassischen Parallele sich wählten.
Diese wie all die sonstigen Erwerbungen bedingten
bei Ludwig den Entschluß, einen würdigen Bau
für Aufstellung solch hervorragender antiker Kunst-
schätze an der Jsar erstehen zu lassen. Bereits im
Jahre 1816 wurde der Grundstein zur Glypto-
thek gelegt, deren Pläne und Durchführung dem
ArchitektenLeo Klenze zufielen (Abb.5, 6und7).
Eine ungemein glückliche Wahl ward hierdurch ge-
troffen, da gerade dies erBaumeister es ambesten ver-
mochte, den großen AnforderungenLudwigs gerecht
zu werden. Klenze (Abb. 8), geboren am 29. Fe-
bruar 1784 inderNähe vonHildesheim,mitdembe-
rühmten BerlinerBaumeister K. F. Schivkel sicher-
lich der bedeutendste Architekt der klassizistischen
Schule, verfügte über ein wahrhaft monumentales
Erfassen und Gestaltenseiner Aufgaben. Auf weiten
Reisen hatte er griechische wie römische Bauweise
gründlich studiert, war dann in Kassel in die
Dienste des Königs Jerome getreten, um nach
dessen jähem Sturze sein Geschick und Glück in
München zu erproben. Wie glänzend dies ge-
lang, zeigt die hohe Gönnerschaft, die Ludwig
trotz mancher Gegenströmung dem genialen Bau-
meister zeitlebens wahrte. Jm Bau der Glypto-
thek verstand es Klenze, dessen allgemeine Bil-
dung jene seiner zeitgenössischen Kollegen weit
überragte, ganz besonders gut, die jonisch-grie-
chischen Formen des Aeußeren mit der mehr im
römischen Charakter gehaltenen inneren Eintei-
lung und Ausschmückung in eine imposante, den
Zwecken des Gebäudes vollauf gerecht werdende
Abb. 11 (Tert S. 8) Glyptothek: Der römische Saal Pho«. Gg. Böttger
das Jahr 480 v. Chr. auf der herrlichen Höhe von
Aegina, von welcher der Blick über die iveite Bucht
von Salamis hinzuschweifen vermag, errichtet, galt
der Tempel der Erinnerung an den Sieg über die
Perser, zugleich an Hellas' Kämpfe gegen dieTrojer
mahnend. Die Figuren des Ostgiebels schildern
den Streit um die Leiche eines gefallenen Trojaners,
während der Westgiebel die Jnselgöttin Aphaia
zeigt, wie sie den Griechen ihren Schutz angedeihen
läßt. Kronprinz Ludwig erwarb die beiden Giebel-
gruppenum lOOOODukaten; derrussischeMinister
Nitroff wollte nachträglich das Zehnfache mehr
bieten. Auch eine französische Kommission bewarb
sich um die kunstgeschichtlich so wertvollen Werke,
doch Wagner war glücklicherweise vorher erschienen,
um den Ankauf mit Geschick durchzuführen. (Be-
kanntlich ließ Prinzregent Luitpold im Jahre 1901
durch den Münchener Professor Furtwängler die
Grabungen auf Aegina fortsetzen, so daß noch einige
wertvolleFragmenteund ErsatzteilederGiebelgrup-
penzutage gefördertwerden konnten.) Vertreten die
Aegineten eines der bedeutendstenWerke der archai-
schen Richtung, so galten andere Ankäufe Ludwigs
der weiter entwickelten antiken Plastik, u. a. in den
barberinischen Statuen einer feierlich gehaltenen
Muse und dem berühmten schlafenden Faun, dessen
Wohlbehagen ruhiger sich äußert als jenes, das
Goethes lärmende Studenten im Auerbach-Keller
zur minder klassischen Parallele sich wählten.
Diese wie all die sonstigen Erwerbungen bedingten
bei Ludwig den Entschluß, einen würdigen Bau
für Aufstellung solch hervorragender antiker Kunst-
schätze an der Jsar erstehen zu lassen. Bereits im
Jahre 1816 wurde der Grundstein zur Glypto-
thek gelegt, deren Pläne und Durchführung dem
ArchitektenLeo Klenze zufielen (Abb.5, 6und7).
Eine ungemein glückliche Wahl ward hierdurch ge-
troffen, da gerade dies erBaumeister es ambesten ver-
mochte, den großen AnforderungenLudwigs gerecht
zu werden. Klenze (Abb. 8), geboren am 29. Fe-
bruar 1784 inderNähe vonHildesheim,mitdembe-
rühmten BerlinerBaumeister K. F. Schivkel sicher-
lich der bedeutendste Architekt der klassizistischen
Schule, verfügte über ein wahrhaft monumentales
Erfassen und Gestaltenseiner Aufgaben. Auf weiten
Reisen hatte er griechische wie römische Bauweise
gründlich studiert, war dann in Kassel in die
Dienste des Königs Jerome getreten, um nach
dessen jähem Sturze sein Geschick und Glück in
München zu erproben. Wie glänzend dies ge-
lang, zeigt die hohe Gönnerschaft, die Ludwig
trotz mancher Gegenströmung dem genialen Bau-
meister zeitlebens wahrte. Jm Bau der Glypto-
thek verstand es Klenze, dessen allgemeine Bil-
dung jene seiner zeitgenössischen Kollegen weit
überragte, ganz besonders gut, die jonisch-grie-
chischen Formen des Aeußeren mit der mehr im
römischen Charakter gehaltenen inneren Eintei-
lung und Ausschmückung in eine imposante, den
Zwecken des Gebäudes vollauf gerecht werdende