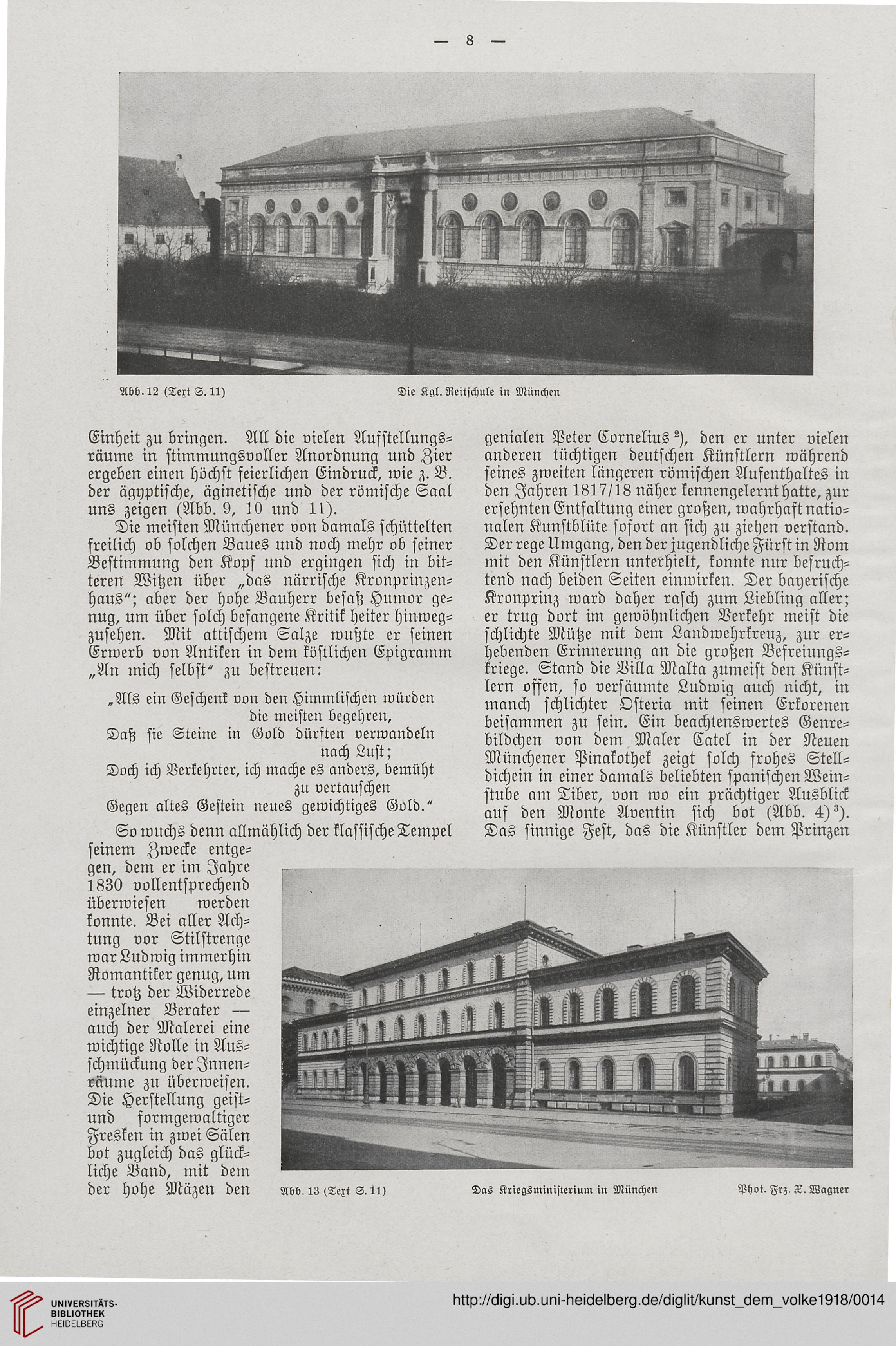8
Abb.12 (Text S. 11)
Die Kgl. Reitschule in Müuchen
Einheit zu bringen. All die vielen Ausstellungs-
räume in stimmungsvoller Anordnung und Zier
ergeben einen höchst feierlichen Eindruck, wie z. B.
der ägyptische, äginetische und der römische Saal
uns zeigen (Abb. 9, 10 und 1l).
Die meisten Münchener von damals schüttelten
freilich ob solchen Baues und noch mehr ob seiner
Bestimmung den Kopf und ergingen sich in bit-
teren Witzen über „das närrische Kronprinzen-
haus"; aber der hohe Bauherr besaß Humor ge-
nug, um über solch befangene Kritik heiter hinweg-
zusehen. Mit attischem Salze wußte er seinen
Erwerb von Antiken in dem köstlichen Epigramm
„An mich selbst" zu bestreuen:
„Als ein Geschenk von den Himmlischen würden
die meisten begehren,
Daß sie Steine in Gold dürften verwandeln
nach Lust;
Doch ich Verkehrter, ich mache es anders, bemüht
zu vertauschen
Gegen altes Gestein neues gewichtiges Gold."
So wuchs denn allmählich der klassische Tempel
seinem Zwecke entge-
gen, dem er im Jahre
1830 vollentsprechend
überwiesen werden
konnte. Bei aller Ach-
tung vor Stilstrenge
warLudwig immerhin
Romantiker genug, um
— trotz der Widerrede
einzelner Berater —
auch der Malerei eine
wichtige Rolle in Aus-
schmückung der Jnnen-
räume zu überweisen.
Die Herstellung geist-
und sormgewaltiger
Fresken in zwei Sälen
bot zugleich das glück-
liche Band, mit dem
der hohe Mäzen den
genialen Peter Cornelius ^), den er unter vielen
anderen tüchtigen deutschen Künstlern während
seines zweiten längeren römischen Aufenthaltes in
den Jahren 1817/18 näher kennengelernthatte, zur
ersehnten Entfaltung einer großen, wahrhaftnatio-
nalen Kunstblüte sofort an sich zu ziehen verstand.
Derrege llmgang, den derjugendliche Fürstin Rom
mit den Künstlern unterhielt, konnte nur befruch-
tend nach beiden Seiten einwirken. Der baperische
Kronprinz ward daher rasch zum Liebling aller;
er trug dort im gewöhnlichen Verkehr meist die
schlichte Mütze mit dem Landwehrkreuz, zur er-
hebenden Erinnerung an die großen Befreiungs-
kriege. Stand die Villa Malta zumeist den Künst-
lern offen, so versäumte Ludwig auch nicht, in
manch schlichter Osteria mit seinen Erkorenen
beisammen zu sein. Ein beachtenswertes Genre-
bildchen von dem Maler Catel in der Neuen
Münchener Pinakothek zeigt solch frohes Stell-
dichein in einer damals beliebten spanischen Wein-
stube am Tiber, von wo ein prächtiger Ausblick
auf den Monte Aventin sich bot (Abb. 4)^).
Das sinnige Fest, das die Künstler dem Prinzen
Abb. 13 (Tcxt S. 11>
Das Kriegsministerium in Miinchen
Phot. Frz. X. Wagner
Abb.12 (Text S. 11)
Die Kgl. Reitschule in Müuchen
Einheit zu bringen. All die vielen Ausstellungs-
räume in stimmungsvoller Anordnung und Zier
ergeben einen höchst feierlichen Eindruck, wie z. B.
der ägyptische, äginetische und der römische Saal
uns zeigen (Abb. 9, 10 und 1l).
Die meisten Münchener von damals schüttelten
freilich ob solchen Baues und noch mehr ob seiner
Bestimmung den Kopf und ergingen sich in bit-
teren Witzen über „das närrische Kronprinzen-
haus"; aber der hohe Bauherr besaß Humor ge-
nug, um über solch befangene Kritik heiter hinweg-
zusehen. Mit attischem Salze wußte er seinen
Erwerb von Antiken in dem köstlichen Epigramm
„An mich selbst" zu bestreuen:
„Als ein Geschenk von den Himmlischen würden
die meisten begehren,
Daß sie Steine in Gold dürften verwandeln
nach Lust;
Doch ich Verkehrter, ich mache es anders, bemüht
zu vertauschen
Gegen altes Gestein neues gewichtiges Gold."
So wuchs denn allmählich der klassische Tempel
seinem Zwecke entge-
gen, dem er im Jahre
1830 vollentsprechend
überwiesen werden
konnte. Bei aller Ach-
tung vor Stilstrenge
warLudwig immerhin
Romantiker genug, um
— trotz der Widerrede
einzelner Berater —
auch der Malerei eine
wichtige Rolle in Aus-
schmückung der Jnnen-
räume zu überweisen.
Die Herstellung geist-
und sormgewaltiger
Fresken in zwei Sälen
bot zugleich das glück-
liche Band, mit dem
der hohe Mäzen den
genialen Peter Cornelius ^), den er unter vielen
anderen tüchtigen deutschen Künstlern während
seines zweiten längeren römischen Aufenthaltes in
den Jahren 1817/18 näher kennengelernthatte, zur
ersehnten Entfaltung einer großen, wahrhaftnatio-
nalen Kunstblüte sofort an sich zu ziehen verstand.
Derrege llmgang, den derjugendliche Fürstin Rom
mit den Künstlern unterhielt, konnte nur befruch-
tend nach beiden Seiten einwirken. Der baperische
Kronprinz ward daher rasch zum Liebling aller;
er trug dort im gewöhnlichen Verkehr meist die
schlichte Mütze mit dem Landwehrkreuz, zur er-
hebenden Erinnerung an die großen Befreiungs-
kriege. Stand die Villa Malta zumeist den Künst-
lern offen, so versäumte Ludwig auch nicht, in
manch schlichter Osteria mit seinen Erkorenen
beisammen zu sein. Ein beachtenswertes Genre-
bildchen von dem Maler Catel in der Neuen
Münchener Pinakothek zeigt solch frohes Stell-
dichein in einer damals beliebten spanischen Wein-
stube am Tiber, von wo ein prächtiger Ausblick
auf den Monte Aventin sich bot (Abb. 4)^).
Das sinnige Fest, das die Künstler dem Prinzen
Abb. 13 (Tcxt S. 11>
Das Kriegsministerium in Miinchen
Phot. Frz. X. Wagner