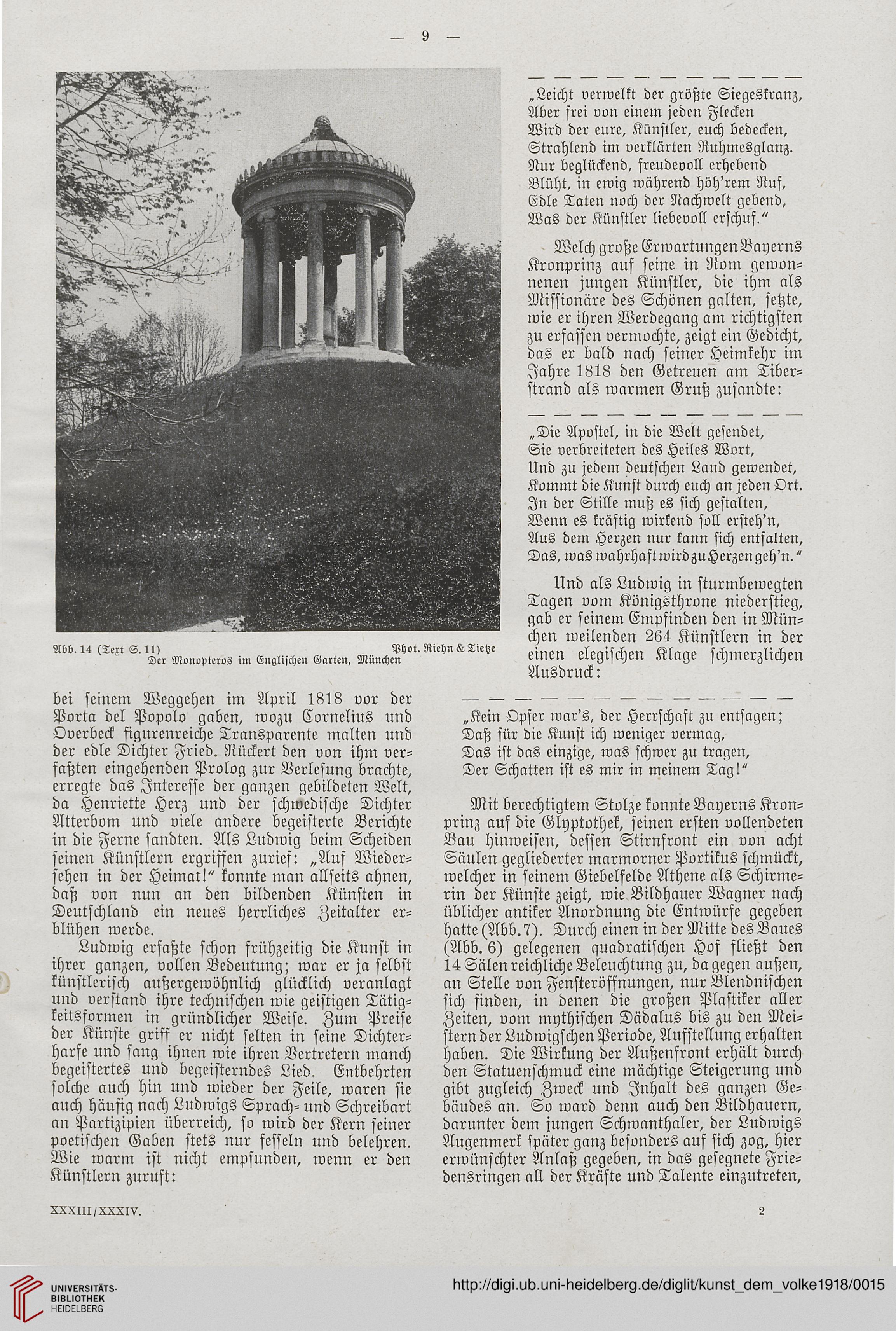9
Abb. 14 (Text S. II)
Dcr Monoptcros im Englischen Garten, München
bei seinem Weggehen im April 1818 vor der
Porta del Popolo gaben, wozu Cornelius und
Overbeck fignrenreiche Transparente malten und
der edle Dichter Fried. Rückert den von ihm ver-
faßten eingehenden Prolog zur Verlesung brachte,
erregte das Jnteresse der ganzen gebildeten Welt,
da Henriette Herz und der schwedische Dichter
Atterbom und viele andere begeisterte Berichte
in die Ferne sandten. Als Ludwig beim Scheiden
seinen Künstlern ergriffen zurief: „Auf Wieder-
sehen in der Heimat!" konnte man allseits ahnen,
daß von nun an den bildenden Künsten in
Deutschland ein neues herrliches Zeitalter er-
blühen werde.
Ludwig erfaßte schon frühzeitig die Kunst in
ihrer ganzen, vollen Bedeutung; war er ja selbst
künstlerisch außergewöhnlich glücklich veranlagt
und verstand ihre technischen wie geistigen Tätig-
keitsformen in gründlicher Weise. Zum Preise
der Künste griff er nicht selten in seine Dichter-
harfe und sang ihnen wie ihren Vertretern manch
begeistertes und begeisterndes Lied. Entbehrten
solche auch hin und wieder der Feile, waren sie
auch häufig nach Ludwigs Sprach- und Schreibart
an Partizipien überreich, so wird der Kern seiner
poetischen Gaben stets nur fesseln und belehren.
Wie warm ist nicht empfunden, wenn er den
Künstlern zuruft:
Phot. Riehn L Tietze
„Leicht verwelkt der größte Siegeskranz,
Aber frei von einem jedcn Flecken
Wird der eure, Känstler, euch bedecken,
Strahlend im verklärten Ruhmesglanz.
Nur beglückend, freudeooll erhcbend
Blüht, m ewig während höh'rem Ruf,
Edle Taten noch der Nachwelt gebend,
Was der Künstler liebevoll erschuf."
Welch große ErwartungenBayerns
Kronprinz auf seine in Rom gewon-
nenen jungen Künstler, die ihm als
Missionäre des Schönen galten, setzte,
ivie er ihren Werdegang am richtigsten
zu erfassen vermochte, zeigt ein Gedicht,
das er bald nach seiner Heimkehr im
Jahre 1818 den Getreuen am Tiber-
strand als warmen Gruß zusandte:
„Die Apostel, in die Welt gesendet,
Sie verbreiteten des Heiles Wort,
Und zu jedem deutfcheu Laud gewendet,
Kommt die Kunst durch euch an jeden Ort.
Jn der Stille muß es sich gestalten,
Wenn es kräftig wirkend soll ersteh'n,
Aus dem Herzen nur kann sich entfalten,
Das, was wahrhaft wird zuHerzen geh'n."
Und als Ludwig in sturmbewegten
Tagen vom Königsthrone niederstieg,
gab er seinem Empfinden den in Mün-
chen weilenden 264 Künstlern in der
einen elegischen Klage schmerzlichen
Ausdruck:
„Kein Opfer war's, der Herrschaft zu entsagen;
Daß für die Kunst ich weniger vermag,
Das ist das einzige, was schwer zu tragen,
Der Schatten ist es mir in meinem Tag!"
Mit berechtigtem Stolze konnte Bayerns Kron-
prinz auf die Glyptothek, seinen ersten vollendeten
Bau hinweisen, dessen Stirnsront ein von acht
Säulen gegliederter marmorner Portikus schmückt,
welcher in seinem Giebelfelde Athene als Schirme-
rin der Künste zeigt, wie Bildhauer Wagner nach
üblicher antiker Anordnung die Entwürfe gegeben
hatte(Abb.l). Durch einen in der Mitte des Baues
(Abb. 6) gelegenen quadratischen Hof fließt den
14SälenreichlicheBeleuchtung zu, da gegen außen,
an Stelle von Fensteröffnungen, nur Blendnischen
sich finden, in denen die großen Plastiker aller
Zeiten, vom mythischen Dädalus bis zu den Mei-
stern der Ludwigs chen Periode, Aufstellung erhalten
haben. Die Wirkung der Außenfront erhält durch
den Statuenschmuck eine mächtige Steigerung und
gibt zugleich Zweck und Jnhalt des ganzen Ge-
bäudes an. So ward denn auch den Bildhauern,
darunter dem jungen Schwanthaler, der Ludwigs
Augenmerk später ganz besonders auf sich zog, hier
erwünschter Anlaß gegeben, in das gesegnete Frie-
densringen all der Kräfte und Talente einzutreten.
xxxm/XXXIV.
2
Abb. 14 (Text S. II)
Dcr Monoptcros im Englischen Garten, München
bei seinem Weggehen im April 1818 vor der
Porta del Popolo gaben, wozu Cornelius und
Overbeck fignrenreiche Transparente malten und
der edle Dichter Fried. Rückert den von ihm ver-
faßten eingehenden Prolog zur Verlesung brachte,
erregte das Jnteresse der ganzen gebildeten Welt,
da Henriette Herz und der schwedische Dichter
Atterbom und viele andere begeisterte Berichte
in die Ferne sandten. Als Ludwig beim Scheiden
seinen Künstlern ergriffen zurief: „Auf Wieder-
sehen in der Heimat!" konnte man allseits ahnen,
daß von nun an den bildenden Künsten in
Deutschland ein neues herrliches Zeitalter er-
blühen werde.
Ludwig erfaßte schon frühzeitig die Kunst in
ihrer ganzen, vollen Bedeutung; war er ja selbst
künstlerisch außergewöhnlich glücklich veranlagt
und verstand ihre technischen wie geistigen Tätig-
keitsformen in gründlicher Weise. Zum Preise
der Künste griff er nicht selten in seine Dichter-
harfe und sang ihnen wie ihren Vertretern manch
begeistertes und begeisterndes Lied. Entbehrten
solche auch hin und wieder der Feile, waren sie
auch häufig nach Ludwigs Sprach- und Schreibart
an Partizipien überreich, so wird der Kern seiner
poetischen Gaben stets nur fesseln und belehren.
Wie warm ist nicht empfunden, wenn er den
Künstlern zuruft:
Phot. Riehn L Tietze
„Leicht verwelkt der größte Siegeskranz,
Aber frei von einem jedcn Flecken
Wird der eure, Känstler, euch bedecken,
Strahlend im verklärten Ruhmesglanz.
Nur beglückend, freudeooll erhcbend
Blüht, m ewig während höh'rem Ruf,
Edle Taten noch der Nachwelt gebend,
Was der Künstler liebevoll erschuf."
Welch große ErwartungenBayerns
Kronprinz auf seine in Rom gewon-
nenen jungen Künstler, die ihm als
Missionäre des Schönen galten, setzte,
ivie er ihren Werdegang am richtigsten
zu erfassen vermochte, zeigt ein Gedicht,
das er bald nach seiner Heimkehr im
Jahre 1818 den Getreuen am Tiber-
strand als warmen Gruß zusandte:
„Die Apostel, in die Welt gesendet,
Sie verbreiteten des Heiles Wort,
Und zu jedem deutfcheu Laud gewendet,
Kommt die Kunst durch euch an jeden Ort.
Jn der Stille muß es sich gestalten,
Wenn es kräftig wirkend soll ersteh'n,
Aus dem Herzen nur kann sich entfalten,
Das, was wahrhaft wird zuHerzen geh'n."
Und als Ludwig in sturmbewegten
Tagen vom Königsthrone niederstieg,
gab er seinem Empfinden den in Mün-
chen weilenden 264 Künstlern in der
einen elegischen Klage schmerzlichen
Ausdruck:
„Kein Opfer war's, der Herrschaft zu entsagen;
Daß für die Kunst ich weniger vermag,
Das ist das einzige, was schwer zu tragen,
Der Schatten ist es mir in meinem Tag!"
Mit berechtigtem Stolze konnte Bayerns Kron-
prinz auf die Glyptothek, seinen ersten vollendeten
Bau hinweisen, dessen Stirnsront ein von acht
Säulen gegliederter marmorner Portikus schmückt,
welcher in seinem Giebelfelde Athene als Schirme-
rin der Künste zeigt, wie Bildhauer Wagner nach
üblicher antiker Anordnung die Entwürfe gegeben
hatte(Abb.l). Durch einen in der Mitte des Baues
(Abb. 6) gelegenen quadratischen Hof fließt den
14SälenreichlicheBeleuchtung zu, da gegen außen,
an Stelle von Fensteröffnungen, nur Blendnischen
sich finden, in denen die großen Plastiker aller
Zeiten, vom mythischen Dädalus bis zu den Mei-
stern der Ludwigs chen Periode, Aufstellung erhalten
haben. Die Wirkung der Außenfront erhält durch
den Statuenschmuck eine mächtige Steigerung und
gibt zugleich Zweck und Jnhalt des ganzen Ge-
bäudes an. So ward denn auch den Bildhauern,
darunter dem jungen Schwanthaler, der Ludwigs
Augenmerk später ganz besonders auf sich zog, hier
erwünschter Anlaß gegeben, in das gesegnete Frie-
densringen all der Kräfte und Talente einzutreten.
xxxm/XXXIV.
2