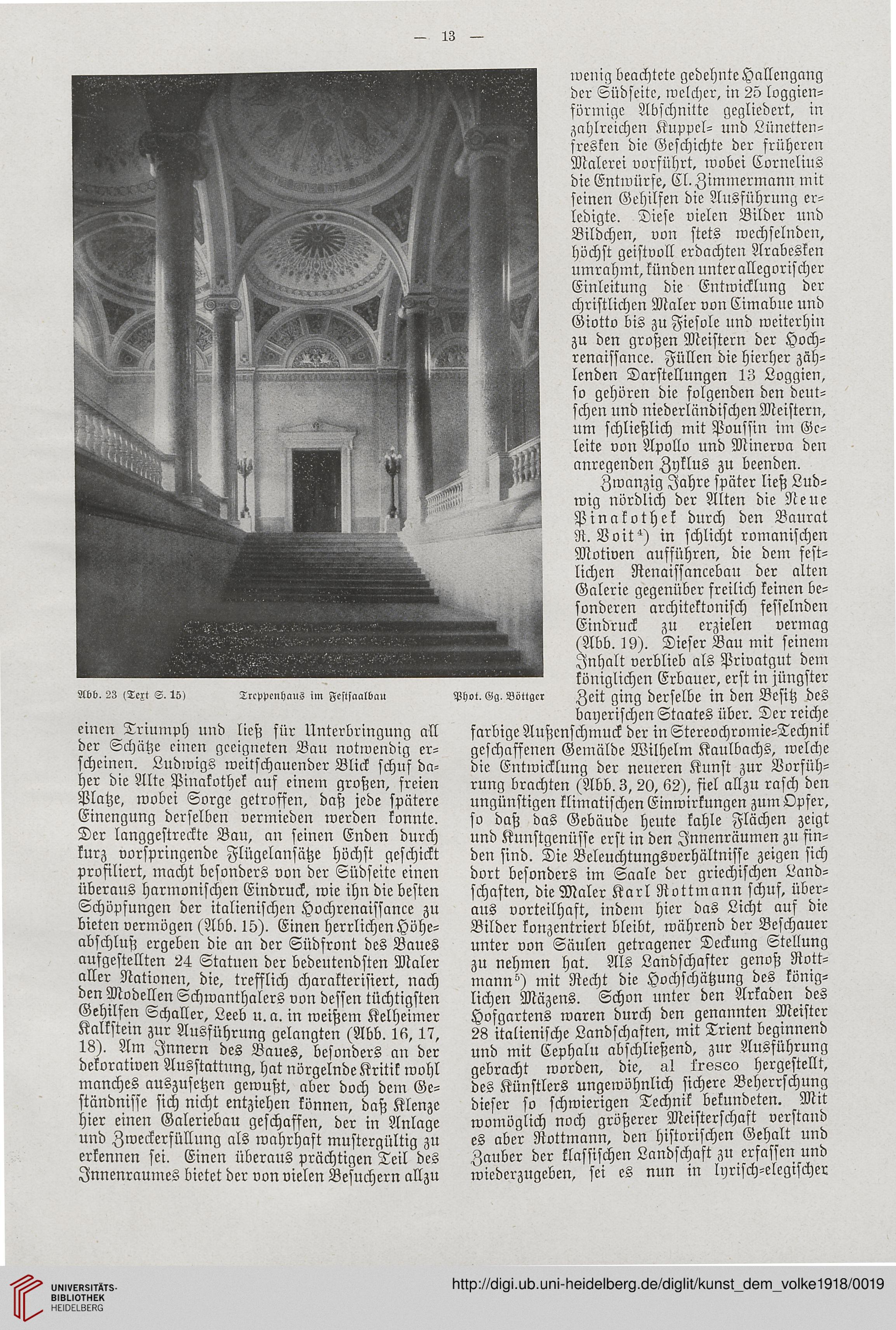13
einen Triumph und ließ sür Unterbringung all
der Schätze cinen gceigncten Bau notwendig er-
scheinen. Ludwigs weitschauender Blick schuf da-
her die Alte Pinakothek auf einem großen, freien
Platze, wobei Sorge getroffen, daß jede spätere
Einengung derselben vermieden werden konnte.
Der langgestreckte Bau, an seinen Enden durch
kurz vorspringende Flügelansätze höchst geschickt
profiliert, macht besonders von der Südseite einen
überaus harmonischen Eindruck, wie ihn die besten
Schöpfungen der italienischen Hochrenaissance zu
bieten vermögen (Abb. 15). Einen herrlichen Höhe-
abschluß ergeben die an der Südfront des Baues
aufgestellten 24 Statuen der bedeutendsten Maler
aller Nationen, die, trefflich charakterisiert, nach
den Modellen Schwanthalers von dessen tüchtigsten
Gehnfen Schaller, Leeb u. a. in weißem Kelheimer
Kalkstem zur Ausführung gelangten (Abb. 16,17,
18). Am Fnnern des Baues, besonders an der
dekorativen Ausstattung, hat nörgelndeKritik wohl
manches auszusetzen gewußt, aber doch dem Ge-
ständnisse sich nicht entziehen können, daß Klenze
hier einen Galeriebau geschaffen, der in Anlage
und Zweckerfüllung als wahrhaft mustergültig zu
erkennen sei. Einen überaus prächtigen Teil des
Jnnenraumes bietet der von vielen Besuchern allzu
wenig beachtete gedehnteHallengang
der Südseite, welcher, in 25 loggien-
förmige Abschnitte gegliedert, in
zahlreichen Kuppel- und Lünetten-
fresken die Geschichte der früheren
Malerei vorführt, wobei Cornelius
die Entwürfe, Cl.Zimmermann mit
seinen Gehilfen die Ausführung er-
ledigte. Diese vielen Bilder und
Bildchen, von stets wechselnden,
höchst geistvoll erdachten Arabesken
umrahmt, kündenunterallegorischer
Einleitung die Entwicklung der
christlichen Maler von Cimabue und
Giotto bis zu Fiesole und weiterhin
zu den großen Meistern der Hoch-
renaissance. Füllen die hierher zäh-
lenden Darstellungen 13 Loggien,
so gehören die folgenden den deut-
schen und niederländischen Meistern,
um schließlich mit Poussin im Gc-
leite von Apollo und Minerva den
anregenden Zpklus zu beenden.
Zwanzig Jahre später ließ Lud-
wig nördlich der Alten die Neue
Pinakothek durch den Baurat
R. Voitch in schlicht romanischen
Motiven aufführen, die dem fest-
lichen Renaissancebau der alten
Galerie gegenüber sreilich keinen be-
sonderen architektonisch fesselnden
Eindruck zu erzielen vermag
(Abb. 19). Dieser Bau mit seinem
Jnhalt verblieb als Privatgut dem
königlichen Erbauer, erst in jüngster
Zeit ging derselbe in den Besitz des
baperischen Staates über. Der reiche
farbige Außenschmuck der in Stereochromie-Technik
geschaffenen Gemälde Wilhelm Kaulbachs, welche
die Entwicklung der neueren Kunst zur Vorfüh-
rung brachten (Abb. 3, 20, 62), fiel allzu rasch den
ungünstigen klimatischen Einwirkungen zum Opfer,
so daß das Gebäude heute kahle Flächen zeigt
und Kunstgenüsse erst in den Jnnenräumen zu fin-
den sind. Die Beleuchtungsverhältnisse zeigen sich
dort besonders im Saale der griechischen Land-
schaften, dieMaler Karl Rottmann schuf, über-
aus vorteilhaft, indem hier das Licht auf die
Bilder konzentriert bleibt, während der Beschauer
unter von Säulen getragener Deckung Stellung
zu nehmen hat. Als Landschafter genoß Rott-
mannch mit Recht die Hochschätzung des könig-
lichen Mäzens. Schon unter den Arkaden des
Hofgartens waren durch den genannten Meister
28 italienische Landschaften, mit Trient begmnend
und mit Cephalu abschließend, zur Ausführung
gebracht worden, die, al lrssLo hergestellt,
des Künstlers ungewöhnlich sichere Beherrschung
dieser so schwierigen Technik bekundeten. Mlt
womöglich noch größerer Meisterschaft verstand
es aber Rottmann, den historischen Gehalt und
Zauber der klassischen Landschaft zu erfassen und
wiederzugeben, sei es nun in Iprisch-elegischer
einen Triumph und ließ sür Unterbringung all
der Schätze cinen gceigncten Bau notwendig er-
scheinen. Ludwigs weitschauender Blick schuf da-
her die Alte Pinakothek auf einem großen, freien
Platze, wobei Sorge getroffen, daß jede spätere
Einengung derselben vermieden werden konnte.
Der langgestreckte Bau, an seinen Enden durch
kurz vorspringende Flügelansätze höchst geschickt
profiliert, macht besonders von der Südseite einen
überaus harmonischen Eindruck, wie ihn die besten
Schöpfungen der italienischen Hochrenaissance zu
bieten vermögen (Abb. 15). Einen herrlichen Höhe-
abschluß ergeben die an der Südfront des Baues
aufgestellten 24 Statuen der bedeutendsten Maler
aller Nationen, die, trefflich charakterisiert, nach
den Modellen Schwanthalers von dessen tüchtigsten
Gehnfen Schaller, Leeb u. a. in weißem Kelheimer
Kalkstem zur Ausführung gelangten (Abb. 16,17,
18). Am Fnnern des Baues, besonders an der
dekorativen Ausstattung, hat nörgelndeKritik wohl
manches auszusetzen gewußt, aber doch dem Ge-
ständnisse sich nicht entziehen können, daß Klenze
hier einen Galeriebau geschaffen, der in Anlage
und Zweckerfüllung als wahrhaft mustergültig zu
erkennen sei. Einen überaus prächtigen Teil des
Jnnenraumes bietet der von vielen Besuchern allzu
wenig beachtete gedehnteHallengang
der Südseite, welcher, in 25 loggien-
förmige Abschnitte gegliedert, in
zahlreichen Kuppel- und Lünetten-
fresken die Geschichte der früheren
Malerei vorführt, wobei Cornelius
die Entwürfe, Cl.Zimmermann mit
seinen Gehilfen die Ausführung er-
ledigte. Diese vielen Bilder und
Bildchen, von stets wechselnden,
höchst geistvoll erdachten Arabesken
umrahmt, kündenunterallegorischer
Einleitung die Entwicklung der
christlichen Maler von Cimabue und
Giotto bis zu Fiesole und weiterhin
zu den großen Meistern der Hoch-
renaissance. Füllen die hierher zäh-
lenden Darstellungen 13 Loggien,
so gehören die folgenden den deut-
schen und niederländischen Meistern,
um schließlich mit Poussin im Gc-
leite von Apollo und Minerva den
anregenden Zpklus zu beenden.
Zwanzig Jahre später ließ Lud-
wig nördlich der Alten die Neue
Pinakothek durch den Baurat
R. Voitch in schlicht romanischen
Motiven aufführen, die dem fest-
lichen Renaissancebau der alten
Galerie gegenüber sreilich keinen be-
sonderen architektonisch fesselnden
Eindruck zu erzielen vermag
(Abb. 19). Dieser Bau mit seinem
Jnhalt verblieb als Privatgut dem
königlichen Erbauer, erst in jüngster
Zeit ging derselbe in den Besitz des
baperischen Staates über. Der reiche
farbige Außenschmuck der in Stereochromie-Technik
geschaffenen Gemälde Wilhelm Kaulbachs, welche
die Entwicklung der neueren Kunst zur Vorfüh-
rung brachten (Abb. 3, 20, 62), fiel allzu rasch den
ungünstigen klimatischen Einwirkungen zum Opfer,
so daß das Gebäude heute kahle Flächen zeigt
und Kunstgenüsse erst in den Jnnenräumen zu fin-
den sind. Die Beleuchtungsverhältnisse zeigen sich
dort besonders im Saale der griechischen Land-
schaften, dieMaler Karl Rottmann schuf, über-
aus vorteilhaft, indem hier das Licht auf die
Bilder konzentriert bleibt, während der Beschauer
unter von Säulen getragener Deckung Stellung
zu nehmen hat. Als Landschafter genoß Rott-
mannch mit Recht die Hochschätzung des könig-
lichen Mäzens. Schon unter den Arkaden des
Hofgartens waren durch den genannten Meister
28 italienische Landschaften, mit Trient begmnend
und mit Cephalu abschließend, zur Ausführung
gebracht worden, die, al lrssLo hergestellt,
des Künstlers ungewöhnlich sichere Beherrschung
dieser so schwierigen Technik bekundeten. Mlt
womöglich noch größerer Meisterschaft verstand
es aber Rottmann, den historischen Gehalt und
Zauber der klassischen Landschaft zu erfassen und
wiederzugeben, sei es nun in Iprisch-elegischer