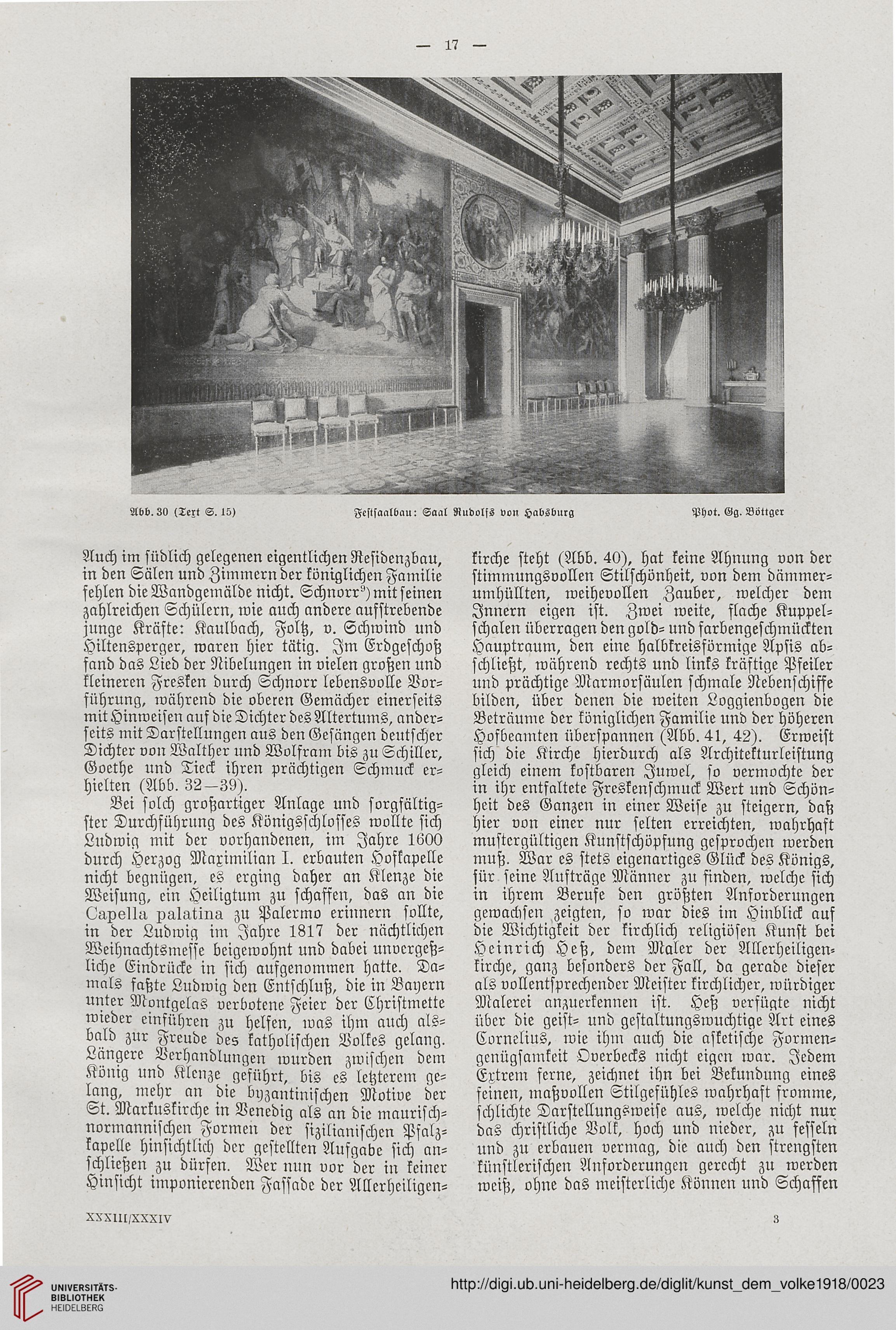17
Abb. Lü (Tert S. I5> Fcstsaalbau: Saal Rudolss von Habsburg Phot. Gg. Böttgcr
Auch im südlich gelegenen eigentlichen Residenzbau,
in den Sälen und Zimmern der königlichen Familie
fehlen die Wandgemälde nicht. Schnorr^mitseinen
zahlreichen Schülern, wie auch andere aufstrebende
junge Kräfte: Kaulbach, Foltz, v. Schwind und
Hiltensperger, waren hier tätig. Jm Erdgeschoß
fand das Lied der Nibelungen in vielen großen und
kleineren Fresken durch Schnorr lebensvolle Vor-
sührung, während die oberen Gemächer einerseits
mit Hinweisen auf die Dichter des Altertums, ander-
seits mit Darstellungen aus den Gesängen deutscher
Dichter von Walther und Wolsram bis zu Schiller,
Goethe und Tieck ihren prächtigen Schmuck er-
hielten (Abb. 32—39).
Bei solch großartiger Anlage und sorgfältig-
ster Durchführung des Königsschlosses wollte sich
Ludwig mit der vorhandenen, im Jahre 1600
durch Herzog Maximilian I. erbauten Hofkapelle
nicht begnügen, es erging daher an Klenze die
Weisung, ein Heiligtum zu schasfen, das an die
Oupkllu ^g.l9.tinu zu Palermo erinnern sollte,
in der Ludwig im Jahre 1817 der nächtlichen
Weihnachtsmesse beigewohnt und dabei unvergeß-
liche Eindrücke in sich aufgenonnnen hatte. Da-
mals faßte Ludwig den Entschluß, die in Bayern
unter Montgelas vcrbotene Feier der Christmette
wieder einführen zu helfen, was ihm auch als-
bald zur Freude des katholischen Volkes gelang.
^.ängere Verhandlungen wurden zwischen dem
König und Klenze geführt, bis es letzterem ge-
lang, mehr an die byzantinischen Motive der
St. Markuskirche in Venedig als an die maurisch-
normannischen Formen der sizilianischen Pfalz-
kapelle hmsrchtlich der gestellten Aufgabe sich an-
schließen zu dürfen. Wer nun vor der in keiner
Hinsicht imponierenden Fassade der Allerheiligen-
kirche steht (Abb. 40), hat keine Ahnung von der
stimmungsvollen Stilschönheit, von dem dämmer-
umhüllten, weihevollen Zauber, welcher dem
Jnnern eigen ist. Zwei weite, flache Kuppel-
schalen überragen den gold- und farbengeschmückten
Hauptraum, den eine halbkreisförmige Apsis ab-
schließt, während rechts und links kräftige Pfeiler
und prächtige Marmorsäulen schmale Nebenschiffe
bilden, über denen die weiten Loggienbogen die
Beträume der königlichen Familie und der höheren
Hofbeamten überspannen (Abb. 41, 42). Erweist
sich die Kirche hierdurch als Architekturleistung
gleich einem kostbaren Juwel, so vermochte der
in ihr entfaltete Freskenschmuck Wert und Schön-
heit des Ganzen in einer Weise zu steigern, daß
hier von einer nur selten erreichten, wahrhaft
mustergültigen Kunstschöpfung gesprochen werden
muß. War es stets eigenartiges Glück des Königs,
sür seine Aufträge Männer zu finden, welche sich
in ihrem Berufe den größten Anforderungen
gewachsen zeigten, so war dies im Hinblick auf
die Wichtigkeit der kirchlich religiösen Kunst bei
Heinrich Heß, dem Maler der Allerheiligen-
kirche, ganz besonders der Fall, da gerade dieser
als vollentsprechender Meister kirchlicher, würdiger
Malerei anzuerkennen ist. Heß verfügte nicht
über die geist- und gestaltungswuchtige Art eines
Cornelius, wie ihm auch die asketische Formen-
genügsamkeit Overbecks nicht eigcn war. Jedem
Extrem ferne, zeichnet ihn bei Bekundung eines
feinen, maßvollen Stilgefühles wahrhaft fromme,
schlichte Darstellungsweise aus, welche nicht nur
das christliche Volk, hoch und nieder, zu fesseln
und zu erbauen vermag, die auch den ftrengsten
künstlerischen Anforderungen gerecht zu werden
weiß, ohne das meisterliche Können und Schaffen
XXXIU/XXXIV
3
Abb. Lü (Tert S. I5> Fcstsaalbau: Saal Rudolss von Habsburg Phot. Gg. Böttgcr
Auch im südlich gelegenen eigentlichen Residenzbau,
in den Sälen und Zimmern der königlichen Familie
fehlen die Wandgemälde nicht. Schnorr^mitseinen
zahlreichen Schülern, wie auch andere aufstrebende
junge Kräfte: Kaulbach, Foltz, v. Schwind und
Hiltensperger, waren hier tätig. Jm Erdgeschoß
fand das Lied der Nibelungen in vielen großen und
kleineren Fresken durch Schnorr lebensvolle Vor-
sührung, während die oberen Gemächer einerseits
mit Hinweisen auf die Dichter des Altertums, ander-
seits mit Darstellungen aus den Gesängen deutscher
Dichter von Walther und Wolsram bis zu Schiller,
Goethe und Tieck ihren prächtigen Schmuck er-
hielten (Abb. 32—39).
Bei solch großartiger Anlage und sorgfältig-
ster Durchführung des Königsschlosses wollte sich
Ludwig mit der vorhandenen, im Jahre 1600
durch Herzog Maximilian I. erbauten Hofkapelle
nicht begnügen, es erging daher an Klenze die
Weisung, ein Heiligtum zu schasfen, das an die
Oupkllu ^g.l9.tinu zu Palermo erinnern sollte,
in der Ludwig im Jahre 1817 der nächtlichen
Weihnachtsmesse beigewohnt und dabei unvergeß-
liche Eindrücke in sich aufgenonnnen hatte. Da-
mals faßte Ludwig den Entschluß, die in Bayern
unter Montgelas vcrbotene Feier der Christmette
wieder einführen zu helfen, was ihm auch als-
bald zur Freude des katholischen Volkes gelang.
^.ängere Verhandlungen wurden zwischen dem
König und Klenze geführt, bis es letzterem ge-
lang, mehr an die byzantinischen Motive der
St. Markuskirche in Venedig als an die maurisch-
normannischen Formen der sizilianischen Pfalz-
kapelle hmsrchtlich der gestellten Aufgabe sich an-
schließen zu dürfen. Wer nun vor der in keiner
Hinsicht imponierenden Fassade der Allerheiligen-
kirche steht (Abb. 40), hat keine Ahnung von der
stimmungsvollen Stilschönheit, von dem dämmer-
umhüllten, weihevollen Zauber, welcher dem
Jnnern eigen ist. Zwei weite, flache Kuppel-
schalen überragen den gold- und farbengeschmückten
Hauptraum, den eine halbkreisförmige Apsis ab-
schließt, während rechts und links kräftige Pfeiler
und prächtige Marmorsäulen schmale Nebenschiffe
bilden, über denen die weiten Loggienbogen die
Beträume der königlichen Familie und der höheren
Hofbeamten überspannen (Abb. 41, 42). Erweist
sich die Kirche hierdurch als Architekturleistung
gleich einem kostbaren Juwel, so vermochte der
in ihr entfaltete Freskenschmuck Wert und Schön-
heit des Ganzen in einer Weise zu steigern, daß
hier von einer nur selten erreichten, wahrhaft
mustergültigen Kunstschöpfung gesprochen werden
muß. War es stets eigenartiges Glück des Königs,
sür seine Aufträge Männer zu finden, welche sich
in ihrem Berufe den größten Anforderungen
gewachsen zeigten, so war dies im Hinblick auf
die Wichtigkeit der kirchlich religiösen Kunst bei
Heinrich Heß, dem Maler der Allerheiligen-
kirche, ganz besonders der Fall, da gerade dieser
als vollentsprechender Meister kirchlicher, würdiger
Malerei anzuerkennen ist. Heß verfügte nicht
über die geist- und gestaltungswuchtige Art eines
Cornelius, wie ihm auch die asketische Formen-
genügsamkeit Overbecks nicht eigcn war. Jedem
Extrem ferne, zeichnet ihn bei Bekundung eines
feinen, maßvollen Stilgefühles wahrhaft fromme,
schlichte Darstellungsweise aus, welche nicht nur
das christliche Volk, hoch und nieder, zu fesseln
und zu erbauen vermag, die auch den ftrengsten
künstlerischen Anforderungen gerecht zu werden
weiß, ohne das meisterliche Können und Schaffen
XXXIU/XXXIV
3