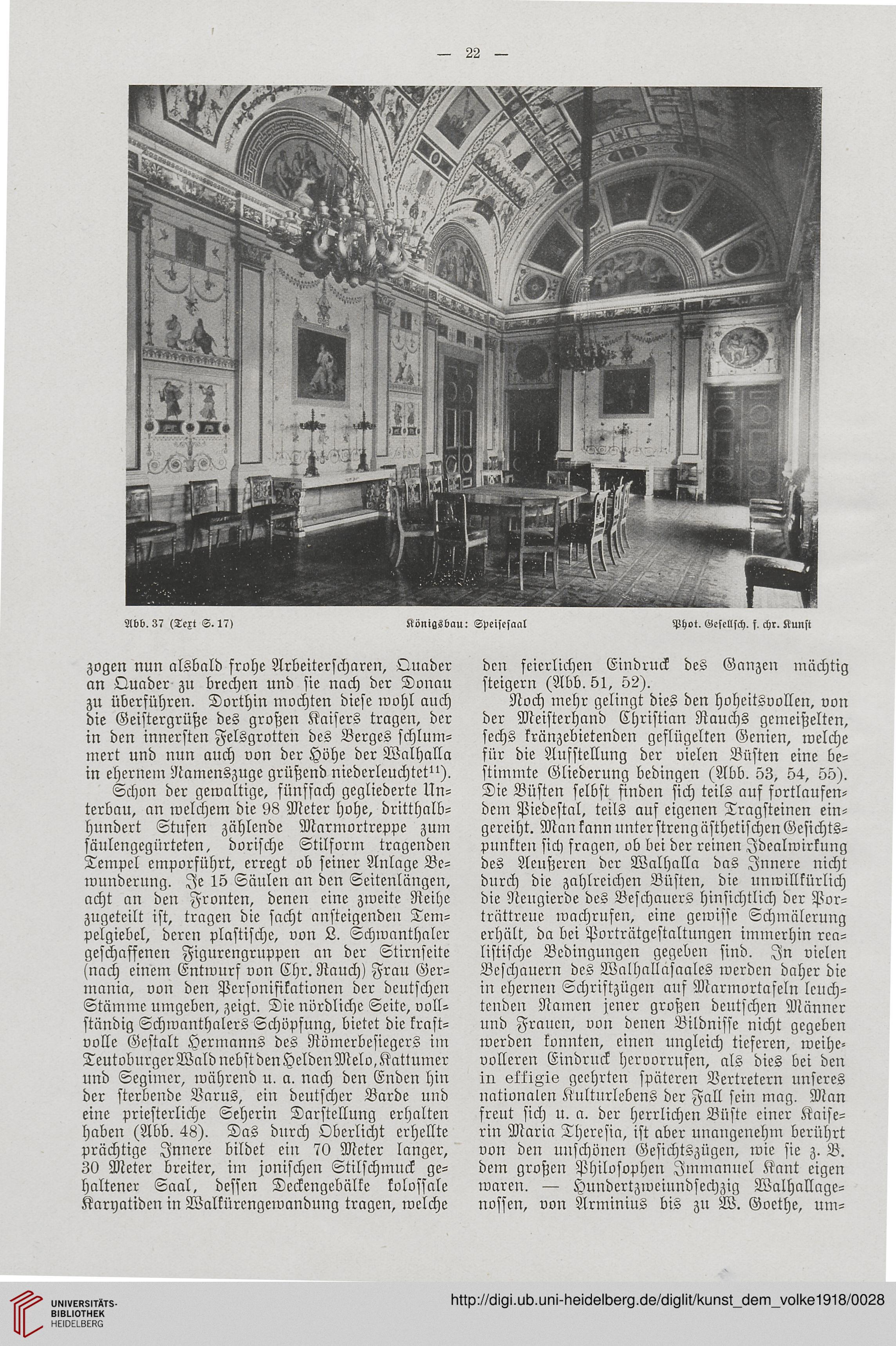22
Abb. 37 (Text S. 17>
KönigLbau: Speisesaal
Phot. Gesellsch. s. chr. Kunst
zogen nun alsbald frohe Arbeiterscharen, Quader
an Quader zu brechen und sie nach der Donau
zu überführen. Dorthin mochten diese wohl auch
die Geistergrüße des großen Kaisers tragen, der
in den innersten Felsgrotten des Berges schlum-
mert und nun auch von der Höhe der Walhalla
in ehernem Namenszuge grüßend niederleuchtet").
Schon der gewaltige, fünffach gegliederte Un-
terbau, an welchem die 98 Meter hohe, dritthalb-
hundert Stufen zählende Marmortreppe zum
säulengegürteten, dorische Stilform tragenden
Tempel emporführt, erregt ob seiner Anlage Be-
wunderung. Je 15 Säulen an den Seitenlängen,
acht an den Fronten, denen eine zweite Reihe
zugeteilt ist, tragen die sacht ansteigenden Tem-
pelgiebel, deren plastische, von L. Schwanthaler
geschaffenen Figurengruppen an der Stirnseite
(nach einem Entwurf von Chr. Rauch) Frau Ger-
mania, von den Personifikationen der deutschen
Stämme umgeben, zeigt. Die nördliche Seite, voll-
ständig Schwanthalers Schöpfung, bietet die kraft-
volle Gestalt Hermanns des Römerbesiegers im
TeutoburgerWaldnebstdenHeldenMelo,Kattumer
und Segimer, während u. a. nach den Enden hin
der sterbende Varus, ein deutscher Barde und
eine priesterliche Seherin Darstellung erhalten
haben (Abb. 48). Das durch Oberlicht erhellte
prächtige Jnnere bildet ein 70 Meter langer,
30 Meter breiter, im jonischen Stilschmuck ge-
haltener Saal, dessen Deckengebälke kolossale
Karyatiden in Walkürengewandung tragen, welche
den feierlichen Eindruck des Ganzen mächtig
steigern (Abb. 51, 52).
Noch mehr gelingt dies den hoheitsvollen, von
der Meisterhand Christian Rauchs gemeißelten,
sechs kränzebietenden geflügelten Genien, welche
für die Aufstellung der vielen Büsten eine be-
stimmte Gliederung bedingen (Abb. 53, 54, 55).
Die Büsten selbst finden sich teils auf fortlaufen-
dem Piedestal, teils auf eigenen Tragsteinen ein-
gereiht. Man kann unterstrengästhetischenGesichts-
punkten sich fragen, ob bei der reinen Jdealwirkung
des Aeußeren der Walhalla das Jnnere nicht
durch die zahlreichen Büsten, die unwillkürlich
die Neugierde des Beschauers hinsichtlich der Por-
trättreue wachrufen, eine gewisse Schmälerung
erhält, da bei Porträtgestaltungen immerhin rea-
listische Bedingungen gegeben sind. Jn vielen
Beschauern des Walhallasaales werden daher die
in ehernen Schriftzügen auf Mtarmortafeln leuch-
tenden Namen jener großen deutschen Männer
und Frauen, von denen Bildnisse nicht gegeben
werden konnten, einen ungleich tieferen, weihe-
volleren Eindruck heroorrufen, als dies bei den
in skliAis geehrten späteren Vertretern unseres
nationaten Kulturlebens der Fall sein mag. Man
freut sich u. a. der herrlichen Büste einer Kaise-
rin Maria Theresia, ist aber unangenehm berührt
von den unschönen Gesichtszügen, wie sie z. B.
dem großen Philosophen Jmmanuel Kant eigen
waren. — Hundertzweiundsechzig Walhallage-
nossen, von Arminius bis zu W. Goethe, um-
Abb. 37 (Text S. 17>
KönigLbau: Speisesaal
Phot. Gesellsch. s. chr. Kunst
zogen nun alsbald frohe Arbeiterscharen, Quader
an Quader zu brechen und sie nach der Donau
zu überführen. Dorthin mochten diese wohl auch
die Geistergrüße des großen Kaisers tragen, der
in den innersten Felsgrotten des Berges schlum-
mert und nun auch von der Höhe der Walhalla
in ehernem Namenszuge grüßend niederleuchtet").
Schon der gewaltige, fünffach gegliederte Un-
terbau, an welchem die 98 Meter hohe, dritthalb-
hundert Stufen zählende Marmortreppe zum
säulengegürteten, dorische Stilform tragenden
Tempel emporführt, erregt ob seiner Anlage Be-
wunderung. Je 15 Säulen an den Seitenlängen,
acht an den Fronten, denen eine zweite Reihe
zugeteilt ist, tragen die sacht ansteigenden Tem-
pelgiebel, deren plastische, von L. Schwanthaler
geschaffenen Figurengruppen an der Stirnseite
(nach einem Entwurf von Chr. Rauch) Frau Ger-
mania, von den Personifikationen der deutschen
Stämme umgeben, zeigt. Die nördliche Seite, voll-
ständig Schwanthalers Schöpfung, bietet die kraft-
volle Gestalt Hermanns des Römerbesiegers im
TeutoburgerWaldnebstdenHeldenMelo,Kattumer
und Segimer, während u. a. nach den Enden hin
der sterbende Varus, ein deutscher Barde und
eine priesterliche Seherin Darstellung erhalten
haben (Abb. 48). Das durch Oberlicht erhellte
prächtige Jnnere bildet ein 70 Meter langer,
30 Meter breiter, im jonischen Stilschmuck ge-
haltener Saal, dessen Deckengebälke kolossale
Karyatiden in Walkürengewandung tragen, welche
den feierlichen Eindruck des Ganzen mächtig
steigern (Abb. 51, 52).
Noch mehr gelingt dies den hoheitsvollen, von
der Meisterhand Christian Rauchs gemeißelten,
sechs kränzebietenden geflügelten Genien, welche
für die Aufstellung der vielen Büsten eine be-
stimmte Gliederung bedingen (Abb. 53, 54, 55).
Die Büsten selbst finden sich teils auf fortlaufen-
dem Piedestal, teils auf eigenen Tragsteinen ein-
gereiht. Man kann unterstrengästhetischenGesichts-
punkten sich fragen, ob bei der reinen Jdealwirkung
des Aeußeren der Walhalla das Jnnere nicht
durch die zahlreichen Büsten, die unwillkürlich
die Neugierde des Beschauers hinsichtlich der Por-
trättreue wachrufen, eine gewisse Schmälerung
erhält, da bei Porträtgestaltungen immerhin rea-
listische Bedingungen gegeben sind. Jn vielen
Beschauern des Walhallasaales werden daher die
in ehernen Schriftzügen auf Mtarmortafeln leuch-
tenden Namen jener großen deutschen Männer
und Frauen, von denen Bildnisse nicht gegeben
werden konnten, einen ungleich tieferen, weihe-
volleren Eindruck heroorrufen, als dies bei den
in skliAis geehrten späteren Vertretern unseres
nationaten Kulturlebens der Fall sein mag. Man
freut sich u. a. der herrlichen Büste einer Kaise-
rin Maria Theresia, ist aber unangenehm berührt
von den unschönen Gesichtszügen, wie sie z. B.
dem großen Philosophen Jmmanuel Kant eigen
waren. — Hundertzweiundsechzig Walhallage-
nossen, von Arminius bis zu W. Goethe, um-