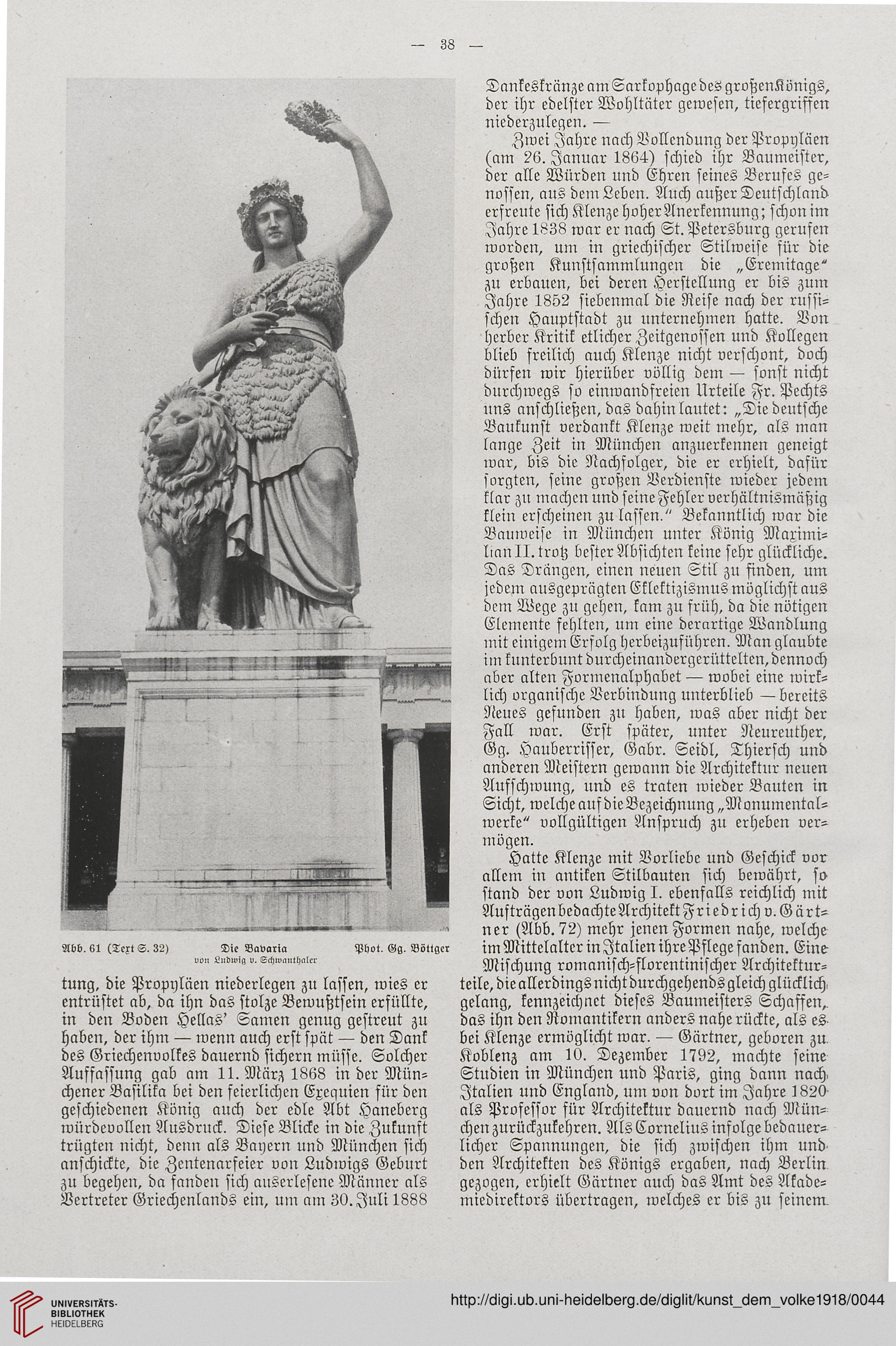38
Abb. 61 (Tcxt S. 32) Die Bavaria Phot. Gg. Böttger
tung, die Propyläen niederlegen zu lassen, wies er
entrüstet ab, da ihn das stolze Bemußtsein erfüllte,
in den Boden Hellas' Samen genug gestreut zu
haben, der ihm — wenn auch erst spät — den Dank
des Griechenvolkes dauernd sichern müsse. Solcher
Auffassung gab am 1l. März 1868 in der Mün-
chener Basilika bei den feierlichen Exequien für den
geschiedenen König auch der edle Abt Haneberg
würdevollen Ausdruck. Diese Blicke in die Zukunft
trügten nicht, denn als Bayern und München fich
anschickte, die Zentenarfeier von Ludwigs Geburt
zu begehen, da fanden sich anserlesene Männer als
Vertreter Griechenlands ein, um am ZO.Iuli 1888
Dankeskränze am Sarkophage des großenKönigs,
der ihr edelster Wohltäter gewesen, tiefergriffen
niederzulegen. —
Zwei Jahre nach Vollendung der Propyläen
(am 26. Januar 1864) fchied ihr Baumeifter,
der alle Würden und Ehren seines Berufes ge-
nossen, aus dem Leben. Auch außer Deutschland
erfreute sich Klenze hoherAnerkennung; schon im
Jahre 1838 war er nach St. Petersburg gerufen
worden, um in griechischer Stilweise für die
großen Kunstsammlungen die „Eremitage"
zn erbauen, bei deren Herstellung er bis zum
Jahre 1852 siebenmal die Reise nach der russi-
schen Hauptstadt zu unternehmen hatte. Von
herber Kritik etlicher Zeitgenossen und Kollegen
blieb freilich auch Klenze nicht verschont, doch
dürfen wir hierüber völlig dem — sonst nicht
durchwegs so einwandfreien Urteile Fr. Pechts
uns anschließen, das dahinlautet: „Diedeutsche
Baukunst verdankt Klenze weit mehr, als man
lange Zeit in München anzuerkennen geneigt
war, bis die Nachfolger, die er erhielt, dafür
sorgten, seine großen Verdienste wieder jedem
klar zu machen und seineFehlerverhältnismäßig
klein erscheinen zu lassen." Bekanntlich war die
Bauweise in München unter König Maximi-
llanll.trotz bester Absichten keine sehr glückliche.
Das Drängen, einen neuen Stil zu finden, um
jedem ansgeprägten Eklektizismus möglichst aus
dem Wege zu gehen, kam zu srüh, da die nötigen
Elemente fehlten, um eine derartige Wandlung
mit einigem Erfolg herbeizuführen. Man glaubte
im kunterbunt durcheinandergerüttelten, dennoch
aber alten Formenalphabet — wobei eine wirk-
lich organische Verbindung unterblieb — bereits
Neues gesunden zu haben, was aber nicht der
Fall war. Erst später, unter Neureuther,
Gg. Hauberrisser, Gabr. Seidl, Thiersch und
anderen Meistern gewann die Architektur neuen
Aufschwung, und es traten wieder Bauten in
Sicht, welcheaufdieBezeichnung„Monumental-
werke" vollgültigen Anspruch zu erheben ver-
mögen.
Hatte Klenze mit Vorliebe und Geschick vor
allem in antiken Stilbauten sich bewährt, so
stand der von Ludwig I. ebenfalls reichlich mit
AufträgenbedachteArchitektFriedrich v.Gärt-
ner (Abb. 72) mehr jenen Formen nahe, welche
im Mittelalter in Jtalien ihre Pflege fanden. Eine
Mischung romanisch-florentinischer Architektur-
teile,dieallerdingsnichtdurchgehendsgleichglücklich
gelang, kennzeichnet dieses Baumeisters Schaffen,.
das ihn den Romantikern anders nahe rückte, als es
bei Klenze ermöglicht war. — Gärtner, geboren zu.
Koblenz am 10. Dezember 1792, machte seine
Studien in München und Paris, ging dann nach
Jtalien und England, um von dort im Jahre 1820
als Professor für Architektur dauernd nach Mlln-
chen zurückzukehren. Als Cornelius infolge bedauer-
licher Spannungen, die sich zwischen ihm und
den Architekten des Königs ergaben, nach Berlin
gezogen, erhielt Gärtner auch das Amt des Akade-
miedirektors übertragen, welches er bis zu seincm.
Abb. 61 (Tcxt S. 32) Die Bavaria Phot. Gg. Böttger
tung, die Propyläen niederlegen zu lassen, wies er
entrüstet ab, da ihn das stolze Bemußtsein erfüllte,
in den Boden Hellas' Samen genug gestreut zu
haben, der ihm — wenn auch erst spät — den Dank
des Griechenvolkes dauernd sichern müsse. Solcher
Auffassung gab am 1l. März 1868 in der Mün-
chener Basilika bei den feierlichen Exequien für den
geschiedenen König auch der edle Abt Haneberg
würdevollen Ausdruck. Diese Blicke in die Zukunft
trügten nicht, denn als Bayern und München fich
anschickte, die Zentenarfeier von Ludwigs Geburt
zu begehen, da fanden sich anserlesene Männer als
Vertreter Griechenlands ein, um am ZO.Iuli 1888
Dankeskränze am Sarkophage des großenKönigs,
der ihr edelster Wohltäter gewesen, tiefergriffen
niederzulegen. —
Zwei Jahre nach Vollendung der Propyläen
(am 26. Januar 1864) fchied ihr Baumeifter,
der alle Würden und Ehren seines Berufes ge-
nossen, aus dem Leben. Auch außer Deutschland
erfreute sich Klenze hoherAnerkennung; schon im
Jahre 1838 war er nach St. Petersburg gerufen
worden, um in griechischer Stilweise für die
großen Kunstsammlungen die „Eremitage"
zn erbauen, bei deren Herstellung er bis zum
Jahre 1852 siebenmal die Reise nach der russi-
schen Hauptstadt zu unternehmen hatte. Von
herber Kritik etlicher Zeitgenossen und Kollegen
blieb freilich auch Klenze nicht verschont, doch
dürfen wir hierüber völlig dem — sonst nicht
durchwegs so einwandfreien Urteile Fr. Pechts
uns anschließen, das dahinlautet: „Diedeutsche
Baukunst verdankt Klenze weit mehr, als man
lange Zeit in München anzuerkennen geneigt
war, bis die Nachfolger, die er erhielt, dafür
sorgten, seine großen Verdienste wieder jedem
klar zu machen und seineFehlerverhältnismäßig
klein erscheinen zu lassen." Bekanntlich war die
Bauweise in München unter König Maximi-
llanll.trotz bester Absichten keine sehr glückliche.
Das Drängen, einen neuen Stil zu finden, um
jedem ansgeprägten Eklektizismus möglichst aus
dem Wege zu gehen, kam zu srüh, da die nötigen
Elemente fehlten, um eine derartige Wandlung
mit einigem Erfolg herbeizuführen. Man glaubte
im kunterbunt durcheinandergerüttelten, dennoch
aber alten Formenalphabet — wobei eine wirk-
lich organische Verbindung unterblieb — bereits
Neues gesunden zu haben, was aber nicht der
Fall war. Erst später, unter Neureuther,
Gg. Hauberrisser, Gabr. Seidl, Thiersch und
anderen Meistern gewann die Architektur neuen
Aufschwung, und es traten wieder Bauten in
Sicht, welcheaufdieBezeichnung„Monumental-
werke" vollgültigen Anspruch zu erheben ver-
mögen.
Hatte Klenze mit Vorliebe und Geschick vor
allem in antiken Stilbauten sich bewährt, so
stand der von Ludwig I. ebenfalls reichlich mit
AufträgenbedachteArchitektFriedrich v.Gärt-
ner (Abb. 72) mehr jenen Formen nahe, welche
im Mittelalter in Jtalien ihre Pflege fanden. Eine
Mischung romanisch-florentinischer Architektur-
teile,dieallerdingsnichtdurchgehendsgleichglücklich
gelang, kennzeichnet dieses Baumeisters Schaffen,.
das ihn den Romantikern anders nahe rückte, als es
bei Klenze ermöglicht war. — Gärtner, geboren zu.
Koblenz am 10. Dezember 1792, machte seine
Studien in München und Paris, ging dann nach
Jtalien und England, um von dort im Jahre 1820
als Professor für Architektur dauernd nach Mlln-
chen zurückzukehren. Als Cornelius infolge bedauer-
licher Spannungen, die sich zwischen ihm und
den Architekten des Königs ergaben, nach Berlin
gezogen, erhielt Gärtner auch das Amt des Akade-
miedirektors übertragen, welches er bis zu seincm.