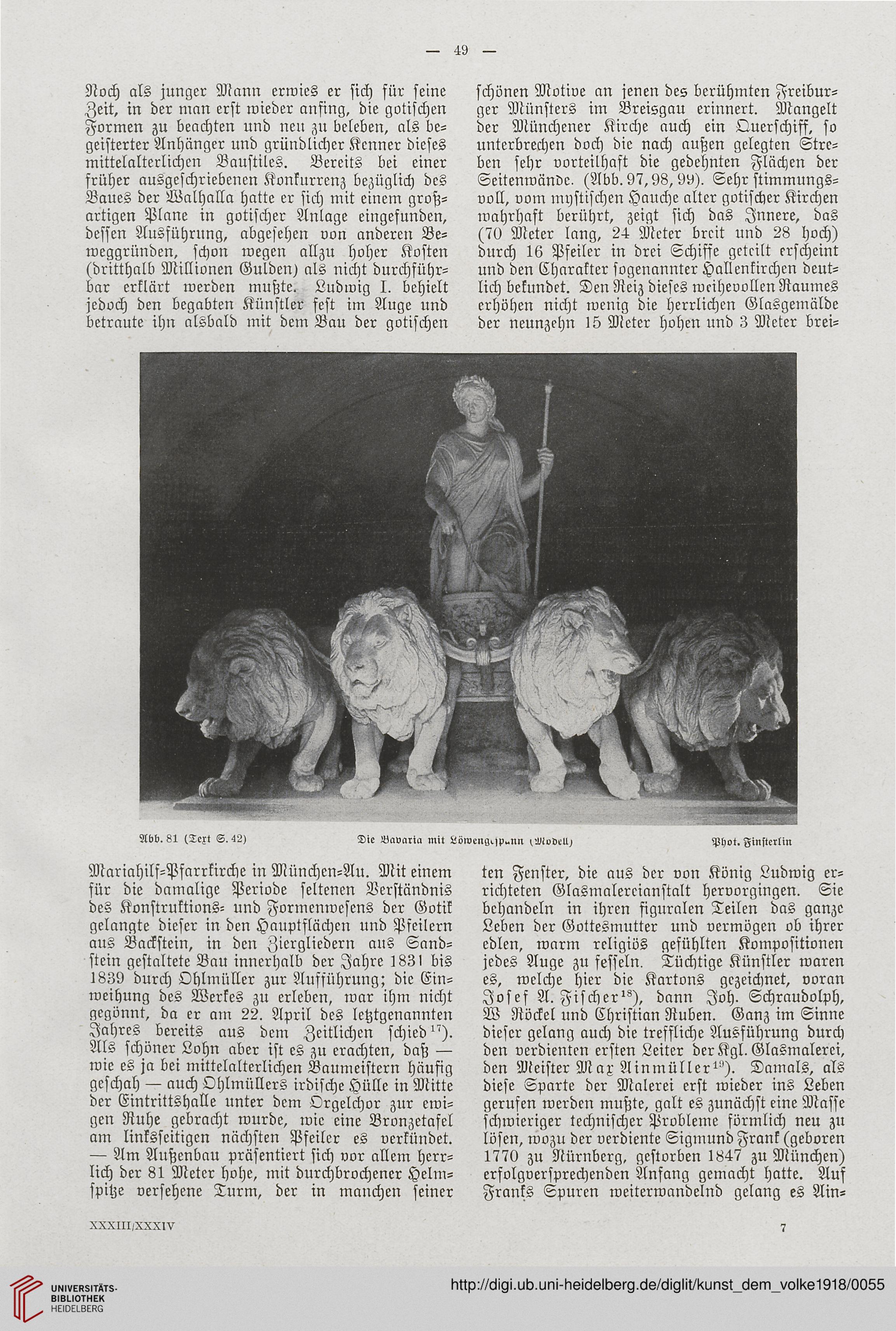49
Noch als junger Mann erwies er sich für seine
Zeit, in der man erst wieder anfing, die gotischen
Formen zu beachten und neu zu beleben, als be-
geisterter Anhänger und gründiicher Kenner dieses
mittelalterlichen Baustiles. Bereits bei einer
früher ausgeschriebenen Konkurrenz bezüglich des
Baues der Walhalla hatte er sich mit einem groß-
artigen Plane in gotischer Anlage eingefunden,
dessen Ausführung, abgesehen von anderen Be-
weggründen, schon wegen allzu hoher Kosten
(dritthalb Millionen Gulden) als nicht durchführ-
bar erklärt werden mußte. Ludwig I. behielt
sedoch den begabten Künstler fest im Auge und
betraute ihn alsbald mit dem Bau der gotischen
schönen Motive an jenen des berühmten Freibur-
ger Münsters im Breisgau erinnert. Mangelt
der Münchener Kirche auch ein Querschiff, so
unterbrechen doch die nach außen gelegten Stre-
ben sehr vorteilhaft die gedehnten Flächen der
Seitenwände. (Abb. 97,98, 99). Sehr stimmungs-
voll, vom mystischen Hauche alter gotischer Kirchen
wahrhaft berührt, zeigt sich das Jnnere, das
(70 Meter lang, 24 Meter breit und 28 hoch)
durch 16 Pfeiler in drei Schiffe gcteilt erscheint
und den Charakter sogenannter Hallenkirchen deut-
lich bekundet. Den Reiz dieses wcihevollen Raumes
erhöhen nicht wenig die herrlichen Glasgemälde
der neunzehn 15 Meter hohen und 3 Meter brei-
Abb. 81 ITcxt S. 12) Die Bavaria mir Löwe»gr,p»nn ,Modeti- Phot. Finsterlin
Mariahilf-Pfarrkirche in München-Au. Mit einem
für die damalige Periode seltenen Verständnis
des Konstruktions- und Formenwesens der Gotik
gelangte dieser in den Hauptflächen und Pseilern
aus Backstein, in den Ziergliedern aus Sand-
stein gestaltete Bau innerhalb der Jahre 1831 bis
1839 durch Ohlmüller zur Ausführung; die Ein-
weihung des Werkes zu erleben, war ihm nicht
gegönnt, da er am 22. April des letztgenannten
Jahres bereits aus dem Zeitlichen schied^ch.
Als schöner Lohn aber ist es zu erachten, daß —
wie es ja bei mittelalterlichen Baumeistern häufig
geschah — auch Ohlmüllers irdische Hülle in Mitte
der Eintrittshalle unter dem Orgelchor zur ewi-
gen Ruhe gebracht wurde, wic eine Bronzetafel
am linksseitigen nächsten Pfeiler es verkündet.
— Am Außenbau präsentiert sich vor allem herr-
lich der 81 Meter hohe, mit durchbrochener Helm-
spitze versehene Turm, der in manchen seiner
ten Fenster, die aus der von König Ludwig er-
richteten Glasmalereianstalt hervorgingen. Sie
behandeln in ihren figuralen Teilen das ganze
Leben der Gottesmutter und vermögen ob ihrer
edlen, warm religiös gefühlten Kompositionen
jedes Auge zu fesseln. Tüchtige Künstler waren
es, welche hier die Kartons gezeichnet, voran
Josef A. Fischer'ch, dann Joh. Schraudolph,
W Röckel und Christian Ruben. Ganz im Sinne
dieser gelang auch die treffliche Ausführung durch
den verdienten ersten Leiter derKgl. Glasmalerei,
den Meister Max Ainmüller^). Damals, als
diese Sparte der Malerei erst wieder ins Leben
gerufen werden mußte, galt es zunächst eine Masse
schwieriger technischer Probleme förmlich neu zu
lösen, wozu der verdiente Sigmund Frank (geboren
1770 zu Nürnberg, gestorben 1847 zu München)
erfolgversprechenden Anfang gemacht hatte. Aus
Franks Spuren weiterwandelnd gelang es Ain-
XXXIII,XXXIV
7
Noch als junger Mann erwies er sich für seine
Zeit, in der man erst wieder anfing, die gotischen
Formen zu beachten und neu zu beleben, als be-
geisterter Anhänger und gründiicher Kenner dieses
mittelalterlichen Baustiles. Bereits bei einer
früher ausgeschriebenen Konkurrenz bezüglich des
Baues der Walhalla hatte er sich mit einem groß-
artigen Plane in gotischer Anlage eingefunden,
dessen Ausführung, abgesehen von anderen Be-
weggründen, schon wegen allzu hoher Kosten
(dritthalb Millionen Gulden) als nicht durchführ-
bar erklärt werden mußte. Ludwig I. behielt
sedoch den begabten Künstler fest im Auge und
betraute ihn alsbald mit dem Bau der gotischen
schönen Motive an jenen des berühmten Freibur-
ger Münsters im Breisgau erinnert. Mangelt
der Münchener Kirche auch ein Querschiff, so
unterbrechen doch die nach außen gelegten Stre-
ben sehr vorteilhaft die gedehnten Flächen der
Seitenwände. (Abb. 97,98, 99). Sehr stimmungs-
voll, vom mystischen Hauche alter gotischer Kirchen
wahrhaft berührt, zeigt sich das Jnnere, das
(70 Meter lang, 24 Meter breit und 28 hoch)
durch 16 Pfeiler in drei Schiffe gcteilt erscheint
und den Charakter sogenannter Hallenkirchen deut-
lich bekundet. Den Reiz dieses wcihevollen Raumes
erhöhen nicht wenig die herrlichen Glasgemälde
der neunzehn 15 Meter hohen und 3 Meter brei-
Abb. 81 ITcxt S. 12) Die Bavaria mir Löwe»gr,p»nn ,Modeti- Phot. Finsterlin
Mariahilf-Pfarrkirche in München-Au. Mit einem
für die damalige Periode seltenen Verständnis
des Konstruktions- und Formenwesens der Gotik
gelangte dieser in den Hauptflächen und Pseilern
aus Backstein, in den Ziergliedern aus Sand-
stein gestaltete Bau innerhalb der Jahre 1831 bis
1839 durch Ohlmüller zur Ausführung; die Ein-
weihung des Werkes zu erleben, war ihm nicht
gegönnt, da er am 22. April des letztgenannten
Jahres bereits aus dem Zeitlichen schied^ch.
Als schöner Lohn aber ist es zu erachten, daß —
wie es ja bei mittelalterlichen Baumeistern häufig
geschah — auch Ohlmüllers irdische Hülle in Mitte
der Eintrittshalle unter dem Orgelchor zur ewi-
gen Ruhe gebracht wurde, wic eine Bronzetafel
am linksseitigen nächsten Pfeiler es verkündet.
— Am Außenbau präsentiert sich vor allem herr-
lich der 81 Meter hohe, mit durchbrochener Helm-
spitze versehene Turm, der in manchen seiner
ten Fenster, die aus der von König Ludwig er-
richteten Glasmalereianstalt hervorgingen. Sie
behandeln in ihren figuralen Teilen das ganze
Leben der Gottesmutter und vermögen ob ihrer
edlen, warm religiös gefühlten Kompositionen
jedes Auge zu fesseln. Tüchtige Künstler waren
es, welche hier die Kartons gezeichnet, voran
Josef A. Fischer'ch, dann Joh. Schraudolph,
W Röckel und Christian Ruben. Ganz im Sinne
dieser gelang auch die treffliche Ausführung durch
den verdienten ersten Leiter derKgl. Glasmalerei,
den Meister Max Ainmüller^). Damals, als
diese Sparte der Malerei erst wieder ins Leben
gerufen werden mußte, galt es zunächst eine Masse
schwieriger technischer Probleme förmlich neu zu
lösen, wozu der verdiente Sigmund Frank (geboren
1770 zu Nürnberg, gestorben 1847 zu München)
erfolgversprechenden Anfang gemacht hatte. Aus
Franks Spuren weiterwandelnd gelang es Ain-
XXXIII,XXXIV
7