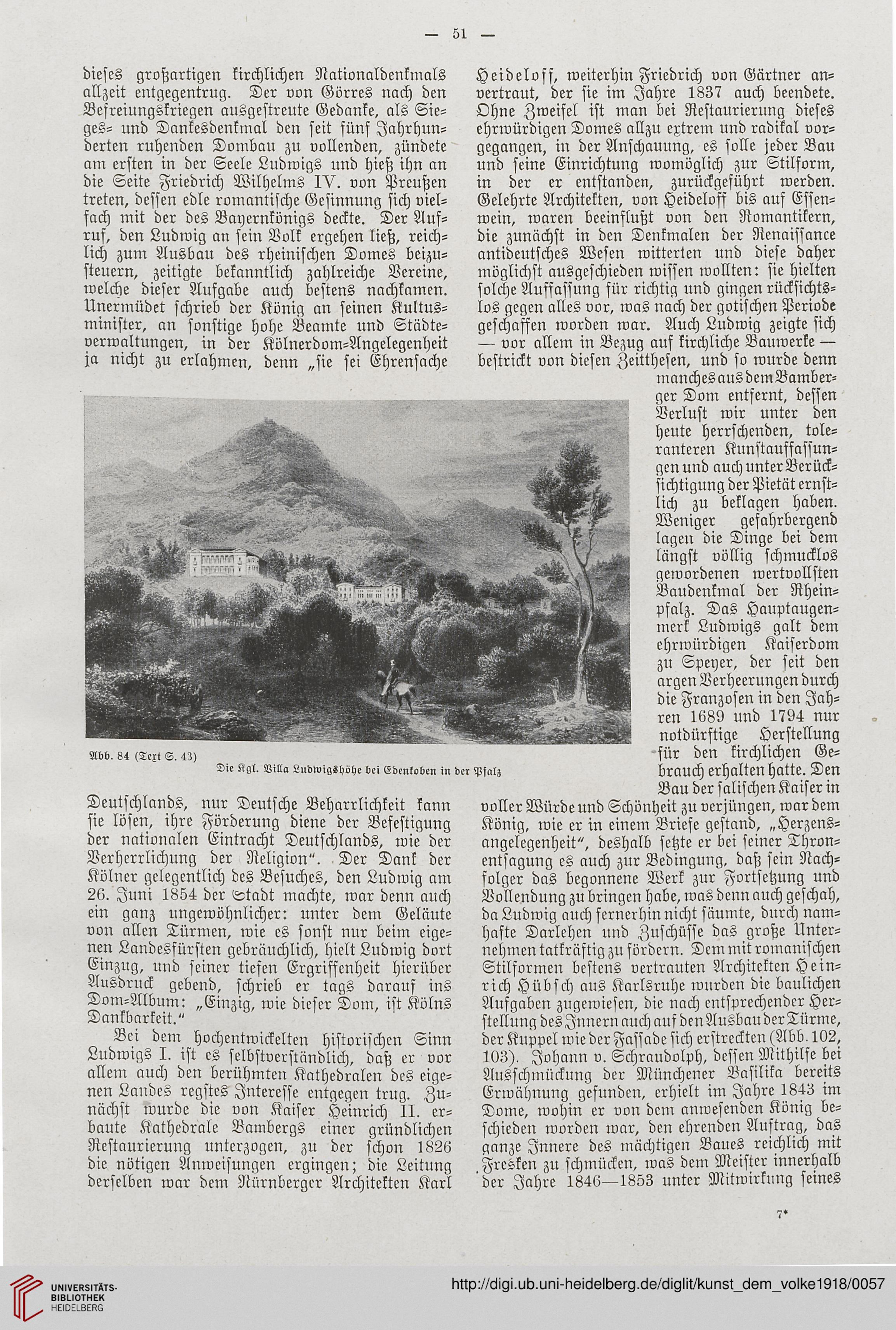51
dieses großartigen kirchlichen Nationaldenkmals
allzeit entgegentrug. Der von Görres nach den
Befreiungskriegen ausgestreute Gedanke, als Sie-
ges- und Dankesdenkmal den seit fünf Jahrhun-
derten ruhenden Dombau zu vollenden, zündete
am ersten in der Seele Ludwigs und hieß ihn an
die Seite Friedrich Wilhelms IV. von Preußen
treten, dessen edle romantische Gesinnung sich viel-
fach mit der des Bayernkönigs deckte. Der Auf-
ruf, den Ludwig an sein Volk ergehen ließ, reich-
lich zum Ausbau des rheinischen Domes beizu-
steuern, zeitigte bekanntlich zahlreiche Vereine,
welche dieser Aufgabe auch bestens nachkamen.
Unermüdet schrieb der König an seinen Kultus-
minister, an sonstige hohe Beamte und Städte-
verwaltungen, in der Kölnerdom-Angelegenheit
ja nicht zu erlahmen, denn „sie sei Ehrensache
Deutschlands, nur Deutsche Beharrlichkeit kann
sie lösen, ihre Förderung diene der Befestigung
der nationalen Eintracht Deutschlands, wie der
Verherrlichung der Religion". Der Dank der
Kölner gelegentlich des Besuches, den Ludwig am
26. Juni 1854 der Llladt machte, war denn auch
ein ganz ungewöhnlicher: unter dem Geläute
von allen Türmen, wie es sonst nur beim eige-
nen Landesfürsten gebräuchlich, hielt Ludwig dort
Einzug, und seiner tiefen Ergriffcnheit hierüber
Ausdruck gebend, schrieb er tags darauf ins
Dom-Album: „Einzig, wie dieser Dom, ilt Kölns
Dankbarkeit."
Bei dem hochentwickelten historischen Sinn
Ludwigs I. ist es selbstverständlich, daß er vor
allem auch den berühmten Kathedralen des eige-
nen Landes regstes Jnteresse entgegen trug. Zu-
nächst wurde die von Kaiser Heinrich II. er-
baute Kathedrale Bambergs einer gründlichen
Restaurierung unterzogen, zu dcr schon 1826
die nötigen Anweisungen ergingen; die Leitung
derselben war dem Nürnberger Architekten Karl
Heideloff, weiterhin Friedrich von Gärtner an-
vertraut, der sie im Jahre 1837 auch beendete.
Ohne Zweifel ist man bei Restaurierung dieses
ehrwürdigen Domes allzu extrem und radikal vor-
gegangen, in der Anschauung, es solle jeder Bau
und seine Einrichtung womöglich zur Stilform,
in der er entstanden, zurückgeführt werden.
Gelehrte Architekten, von Heideloff bis auf Essen-
wein, waren beeinflußt von den Romantikern,
die zunächst in den Denkmalen der Nenaissance
antideutsches Wesen witterten und diese daher
möglichst ausgeschieden wissen wollten: sie hielten
solche Auffassung für richtig und gingen rücksichts-
los gegen alles vor, was nach der gotischen Periode
geschaffen worden war. Auch Ludwig zeigte sich
— vor allem in Bezug auf kirchliche Bauwerke —
bestrickt von diesen Zeitthesen, und so wurde denn
manchesausdemBamber-
ger Dom entfernt, dessen
Verlust wir unter den
heute herrschenden, tole-
ranteren Kunstauffassun-
gen und auch unterBerück-
sichtigung der Pietät ernst-
lich zu beklagen haben.
Weniger gefahrbergend
lagen die Dinge bei dem
längst völlig schmucklos
gewordenen wertvollsten
Baudenkmal der Rhein-
pfalz. Das Hauptaugen-
merk Ludwigs galt dem
ehrwürdigen Kaiserdom
zu Speyer, der seit den
argen Verheerungen durch
die Franzosen in den Jah-
ren 1689 und 1794 nur
notdürftige Herstellung
für den kirchlichen Ge-
brauch erhalten hatte. Den
Bau der salischen Kaiser in
voller Würde und Schönheit zu vcrjüngen, war dem
König, wie er in einem Briefe gestand, „Herzens-
angelegenheit", deshalb setzte er bei seiner Thron-
entsagung es auch zur Bedinguug. daß sein Nach-
folger das begonnene Werk zur Fortsetzung und
Vollendung zu bringen habe, was denn auch geschah,
da Ludwig auch fernerhin nicht säumte, durch nam-
Hafte Darlehen und Zuschüsse das große Unter-
nehmen tatkräftig zu fördern. Dcm mit romanischen
Stilformen bestens vertrauten Architekten Hein-
rich Hübsch aus Karlsruhe wurdeu die baulichen
Aufgaben zugewiesen, die nach entsprechendcr Her-
stellungdesJnnern auchaufdenAusbauderTllrme,
der Kuppel wie der Fassade sich erstreckten (Abb. 102,
103). Johann v. Schraudolph, dessen Mithilfe bei
Ausschmückung der Münchener Basilika bereits
Erwähnung gefunden, erhielt im Jahre 1843 im
Dome, wohin er von dem anwesenden König be-
schieden worden war, den ehrenden Auftrag, das
ganze Jnnere des mächtigen Baues reichlich mit
Fresken zu schmücken, was dem Meister innerhalb
'der Jahre 1846—1853 unter Mitwirkung seines
Abb. 84 (Text S. 43)
Die Kgl. Villa Ludwigshöhe bei Edenkoben in der Pfalz
dieses großartigen kirchlichen Nationaldenkmals
allzeit entgegentrug. Der von Görres nach den
Befreiungskriegen ausgestreute Gedanke, als Sie-
ges- und Dankesdenkmal den seit fünf Jahrhun-
derten ruhenden Dombau zu vollenden, zündete
am ersten in der Seele Ludwigs und hieß ihn an
die Seite Friedrich Wilhelms IV. von Preußen
treten, dessen edle romantische Gesinnung sich viel-
fach mit der des Bayernkönigs deckte. Der Auf-
ruf, den Ludwig an sein Volk ergehen ließ, reich-
lich zum Ausbau des rheinischen Domes beizu-
steuern, zeitigte bekanntlich zahlreiche Vereine,
welche dieser Aufgabe auch bestens nachkamen.
Unermüdet schrieb der König an seinen Kultus-
minister, an sonstige hohe Beamte und Städte-
verwaltungen, in der Kölnerdom-Angelegenheit
ja nicht zu erlahmen, denn „sie sei Ehrensache
Deutschlands, nur Deutsche Beharrlichkeit kann
sie lösen, ihre Förderung diene der Befestigung
der nationalen Eintracht Deutschlands, wie der
Verherrlichung der Religion". Der Dank der
Kölner gelegentlich des Besuches, den Ludwig am
26. Juni 1854 der Llladt machte, war denn auch
ein ganz ungewöhnlicher: unter dem Geläute
von allen Türmen, wie es sonst nur beim eige-
nen Landesfürsten gebräuchlich, hielt Ludwig dort
Einzug, und seiner tiefen Ergriffcnheit hierüber
Ausdruck gebend, schrieb er tags darauf ins
Dom-Album: „Einzig, wie dieser Dom, ilt Kölns
Dankbarkeit."
Bei dem hochentwickelten historischen Sinn
Ludwigs I. ist es selbstverständlich, daß er vor
allem auch den berühmten Kathedralen des eige-
nen Landes regstes Jnteresse entgegen trug. Zu-
nächst wurde die von Kaiser Heinrich II. er-
baute Kathedrale Bambergs einer gründlichen
Restaurierung unterzogen, zu dcr schon 1826
die nötigen Anweisungen ergingen; die Leitung
derselben war dem Nürnberger Architekten Karl
Heideloff, weiterhin Friedrich von Gärtner an-
vertraut, der sie im Jahre 1837 auch beendete.
Ohne Zweifel ist man bei Restaurierung dieses
ehrwürdigen Domes allzu extrem und radikal vor-
gegangen, in der Anschauung, es solle jeder Bau
und seine Einrichtung womöglich zur Stilform,
in der er entstanden, zurückgeführt werden.
Gelehrte Architekten, von Heideloff bis auf Essen-
wein, waren beeinflußt von den Romantikern,
die zunächst in den Denkmalen der Nenaissance
antideutsches Wesen witterten und diese daher
möglichst ausgeschieden wissen wollten: sie hielten
solche Auffassung für richtig und gingen rücksichts-
los gegen alles vor, was nach der gotischen Periode
geschaffen worden war. Auch Ludwig zeigte sich
— vor allem in Bezug auf kirchliche Bauwerke —
bestrickt von diesen Zeitthesen, und so wurde denn
manchesausdemBamber-
ger Dom entfernt, dessen
Verlust wir unter den
heute herrschenden, tole-
ranteren Kunstauffassun-
gen und auch unterBerück-
sichtigung der Pietät ernst-
lich zu beklagen haben.
Weniger gefahrbergend
lagen die Dinge bei dem
längst völlig schmucklos
gewordenen wertvollsten
Baudenkmal der Rhein-
pfalz. Das Hauptaugen-
merk Ludwigs galt dem
ehrwürdigen Kaiserdom
zu Speyer, der seit den
argen Verheerungen durch
die Franzosen in den Jah-
ren 1689 und 1794 nur
notdürftige Herstellung
für den kirchlichen Ge-
brauch erhalten hatte. Den
Bau der salischen Kaiser in
voller Würde und Schönheit zu vcrjüngen, war dem
König, wie er in einem Briefe gestand, „Herzens-
angelegenheit", deshalb setzte er bei seiner Thron-
entsagung es auch zur Bedinguug. daß sein Nach-
folger das begonnene Werk zur Fortsetzung und
Vollendung zu bringen habe, was denn auch geschah,
da Ludwig auch fernerhin nicht säumte, durch nam-
Hafte Darlehen und Zuschüsse das große Unter-
nehmen tatkräftig zu fördern. Dcm mit romanischen
Stilformen bestens vertrauten Architekten Hein-
rich Hübsch aus Karlsruhe wurdeu die baulichen
Aufgaben zugewiesen, die nach entsprechendcr Her-
stellungdesJnnern auchaufdenAusbauderTllrme,
der Kuppel wie der Fassade sich erstreckten (Abb. 102,
103). Johann v. Schraudolph, dessen Mithilfe bei
Ausschmückung der Münchener Basilika bereits
Erwähnung gefunden, erhielt im Jahre 1843 im
Dome, wohin er von dem anwesenden König be-
schieden worden war, den ehrenden Auftrag, das
ganze Jnnere des mächtigen Baues reichlich mit
Fresken zu schmücken, was dem Meister innerhalb
'der Jahre 1846—1853 unter Mitwirkung seines
Abb. 84 (Text S. 43)
Die Kgl. Villa Ludwigshöhe bei Edenkoben in der Pfalz