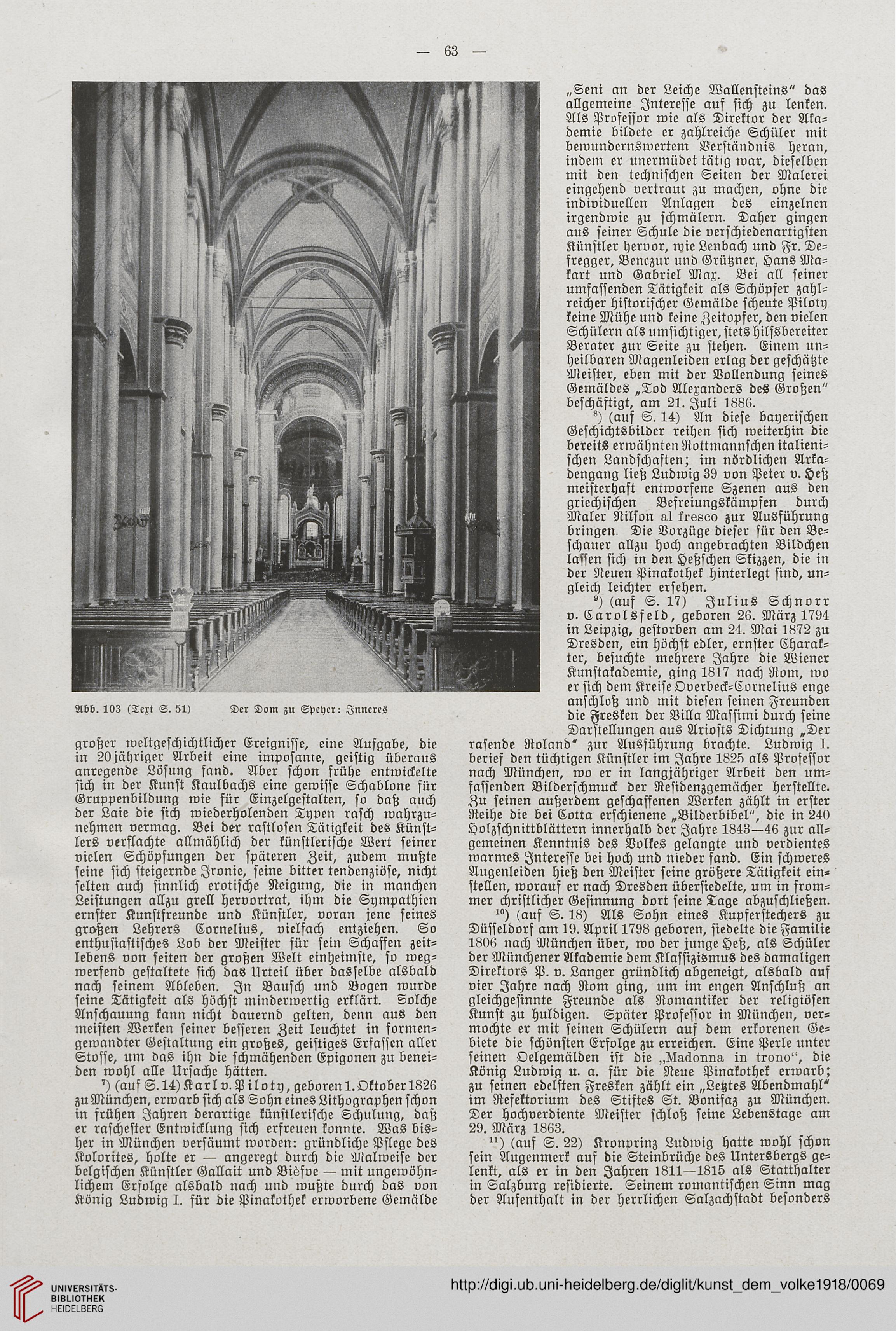63
Abb. 103 (Text S. 51) Der Dom zu Speycr: Jnneres
großer woltgeschichtlicher Ereignisse, eine Aufgabe, die
in SOjähriger Arbeit eine imposame, gcistig überans
anregende Lösung fand. Aber schon frühe entwickelte
sich in der Kunst Kaulbachs eine gewisse Schablone für
Gruppenbildung wie für Einzelgestalten, so datz auch
der Laie die sich wiederholenden Typen rasch wahrzu-
nehmen vermag. Bei der rastlosen Täiigkeit des Künst-
lers verflachte allmählich der künstlerische Wert seiner
vielen Schöpfungen der späteren Zeit, zudem mutzte
seine sich steigernde Jronie, seine bitter tendenziöse, nicht
selten auch sinnlich erotische Neigung, die in manchen
Leistungen allzu grell hervortrat, ihm die Sympathien
ernster Kunstfreunde und Künstler, voran jene seines
grvtzen Lehrers Cornelius, vielfach entziehen. So
enthusiastisches Lob der Meister sür sein Schaffen zeit-
lebens von seiten der grotzen Welt einheimste, so weg-
werfend gestaltete sich das Urteil über dasselbe alsbald
nach seinem Ableben. Jn Bausch und Bogen wurde
seine Tätigkeit als höchst minderwertig erklärt. solche
Anschauung kann nicht dauernd gelten, denn aus den
meisten Werken seiner besseren Zeit leuchtet in formen-
gewandter Gestaltung ein grotzes, geistiges Erfasscn aller
Stoffe, um das ihn dic schmähenden Epigonen zu benei-
den wohl alle Ursache hätten.
') (auf S. 14) Karl v. P iloty, geboren 1.Oktober1826
zu München, erwarb sich als Sohn eines Lithographen schon
in frühen Jahren derartige künstlerische Schulung, datz
er raschester Entwicklung sich erfreuen konnte. Was bis-
her in München versäumt worden: gründliche Pflege des
Kolorites, holte er — angeregt durch die Malweise der
belgischen Künstler Gallait und Bisfve — mit ungewöhn-
lichem Erfolge alsbald nach und wutzte durch das von
König Ludwig I. für die Pinakothek erworbene Gemälde
„Seni an der Leiche Wallensteins" das
allgemeine Jnteresse auf sich zu lenken.
Als Professor wie als Direktor der Aka-
demie bildete er zahlreiche Schüler mit
bewundernswertem Verständnis heran,
indem er unermüdet tätig war, dieselben
mit den technischen Seilen der Malerei
eingehend vertraut zu machen, ohne die
individuellen Anlagen des einzelnen
irgendwie zu schmälern. Daher gingen
aus seiner Schule die verschiedenartigsten
Künstler hervor, wie Lenbach und Fr. De-
fregger, Benczur und Grützner, Hans Ma-
kart und Gabriel Max. Bei all seiner
umfassenden Tätigkeit als Schöpfer zahl-
reicher historischer Gemälde scheute Piloty
keine Mühe und keine Zeitopfer, den vielen
Schülern als umsichtiger, stets hilfsbereiter
Berater zur Seite zu stehen. Einem un-
heilbaren Magenleiden erlag der geschätzte
Meister, eben mit der Vollendung seines
Gemäldes „Tod Alexandcrs des Grotzen"
beschäftigt, am 21. Juli 1886.
°) (auf S. 14) An diese bayerischen
Geschichtsbilder reihen sich weiterhin die
bereits erwähnten Rottmannschen italieni-
schen Landschaften; im nördlichen Arka-
dengang lietz Ludwig 39 von Peter v. Hetz
meisterhaft entworfene Szenen aus den
griechischcn Befreiungskämpfen durch
Maler Nilson al Irssso zur Ausführung
bringen. Die Vorzüge dieser für den Be-
schauer allzu hoch angebrachten Bildchen
lassen sich in den Hetzschen Skizzen, die in
der Neuen Pinakothek hinterlegt sind, un-
gleich leichter ersehen.
°) (auf S. 17) Julius Schnorr
v. Carolsfeld, geboren 26. März 1794
in Leipzig, gestorben am 24. Mai 1872 zu
Dresden, ein höchst edler, ernster Charak-
ter, besuchte mehrere Jahre die Wiener
Kunstakademie, ging 1817 nach Rom, wo
er sich dem KreiseOverbeck-Cornelius enge
anschloh und mit diesen seinen Freunden
die Fresken der Villa Masstmi durch seine
Darstellungen aus Ariosts Dichtung „Der
rasende Roland" zur Aussührung brachte. Ludwig I.
berief den tüchtigen Künstler im Jahre 1825 als Professor
nach München, wo er in langjähriger Arbeit den um-
fassenden Bilderschmuck der Residenzgemächer herstellte.
Zu seinen autzerdem geschaffenen Werken zählt in erster
Reihe die bei Cotta erschienene „Bilderbibel", die in 240
Holzschnittblättern innerhalb der Jahre 1843—46 zur all-
gemeinen Kenntnis des Volkes gelangte und verdientes
warmes Jnteresse bei hoch und nieder fand. Ein schweres
Augenleiden hieh den Meister seine grötzere Tätigkeit ein-
stellen, worauf er nach Dresden übersiedelte, um in from-
mer christlicher Gesinnung dort seine Tage abzuschlietzen.
'") (auf S. 18) Als Sohn eines Kupferstechers zu
Düsseldorf am 19. April 1798 geboren, siedelte die Familie
1806 nach München über, wo der junge Hetz, als Schüler
der Münchener Akademie dem Klassizismus des damaligen
Direktors P. v. Langer gründlich abgeneigt, alsbald auf
vier Jahre nach Rom ging, um im engen Anschlutz an
gleichgesinnte Freunde als Romantiker der religiösen
Kunst zu huldigen. Später Professor in München, ver-
mochte er mit seinen Schülern auf dem erkorenen Ge-
biete die schönsten Erfolge zu erreichen. Eine Perle unter
seinen Oelgemälden ist die „Naäonna in trono", die
König Ludwig u. a. für die Neue Pinakothek erwarb;
zu seinen edelsten Fresken zählt ein „Letztes Abendmahl"
im Refektorium des Stiftes St. Bonifaz zu München.
Der hochverdiente Meister schloh seine Lebenstage am
29. März 1863.
") (auf S. 22) Kronprinz Ludwig hatte wohl schon
sein Augenmerk auf die Steinbrüche des Untersbergs ge-
lenkt, als er in den Jahren 1811—1815 als Statthalter
in Salzburg residierte. Seinem romantischen Sinn mag
der Aufenthalt in der herrlichen Salzachstadt besonders
Abb. 103 (Text S. 51) Der Dom zu Speycr: Jnneres
großer woltgeschichtlicher Ereignisse, eine Aufgabe, die
in SOjähriger Arbeit eine imposame, gcistig überans
anregende Lösung fand. Aber schon frühe entwickelte
sich in der Kunst Kaulbachs eine gewisse Schablone für
Gruppenbildung wie für Einzelgestalten, so datz auch
der Laie die sich wiederholenden Typen rasch wahrzu-
nehmen vermag. Bei der rastlosen Täiigkeit des Künst-
lers verflachte allmählich der künstlerische Wert seiner
vielen Schöpfungen der späteren Zeit, zudem mutzte
seine sich steigernde Jronie, seine bitter tendenziöse, nicht
selten auch sinnlich erotische Neigung, die in manchen
Leistungen allzu grell hervortrat, ihm die Sympathien
ernster Kunstfreunde und Künstler, voran jene seines
grvtzen Lehrers Cornelius, vielfach entziehen. So
enthusiastisches Lob der Meister sür sein Schaffen zeit-
lebens von seiten der grotzen Welt einheimste, so weg-
werfend gestaltete sich das Urteil über dasselbe alsbald
nach seinem Ableben. Jn Bausch und Bogen wurde
seine Tätigkeit als höchst minderwertig erklärt. solche
Anschauung kann nicht dauernd gelten, denn aus den
meisten Werken seiner besseren Zeit leuchtet in formen-
gewandter Gestaltung ein grotzes, geistiges Erfasscn aller
Stoffe, um das ihn dic schmähenden Epigonen zu benei-
den wohl alle Ursache hätten.
') (auf S. 14) Karl v. P iloty, geboren 1.Oktober1826
zu München, erwarb sich als Sohn eines Lithographen schon
in frühen Jahren derartige künstlerische Schulung, datz
er raschester Entwicklung sich erfreuen konnte. Was bis-
her in München versäumt worden: gründliche Pflege des
Kolorites, holte er — angeregt durch die Malweise der
belgischen Künstler Gallait und Bisfve — mit ungewöhn-
lichem Erfolge alsbald nach und wutzte durch das von
König Ludwig I. für die Pinakothek erworbene Gemälde
„Seni an der Leiche Wallensteins" das
allgemeine Jnteresse auf sich zu lenken.
Als Professor wie als Direktor der Aka-
demie bildete er zahlreiche Schüler mit
bewundernswertem Verständnis heran,
indem er unermüdet tätig war, dieselben
mit den technischen Seilen der Malerei
eingehend vertraut zu machen, ohne die
individuellen Anlagen des einzelnen
irgendwie zu schmälern. Daher gingen
aus seiner Schule die verschiedenartigsten
Künstler hervor, wie Lenbach und Fr. De-
fregger, Benczur und Grützner, Hans Ma-
kart und Gabriel Max. Bei all seiner
umfassenden Tätigkeit als Schöpfer zahl-
reicher historischer Gemälde scheute Piloty
keine Mühe und keine Zeitopfer, den vielen
Schülern als umsichtiger, stets hilfsbereiter
Berater zur Seite zu stehen. Einem un-
heilbaren Magenleiden erlag der geschätzte
Meister, eben mit der Vollendung seines
Gemäldes „Tod Alexandcrs des Grotzen"
beschäftigt, am 21. Juli 1886.
°) (auf S. 14) An diese bayerischen
Geschichtsbilder reihen sich weiterhin die
bereits erwähnten Rottmannschen italieni-
schen Landschaften; im nördlichen Arka-
dengang lietz Ludwig 39 von Peter v. Hetz
meisterhaft entworfene Szenen aus den
griechischcn Befreiungskämpfen durch
Maler Nilson al Irssso zur Ausführung
bringen. Die Vorzüge dieser für den Be-
schauer allzu hoch angebrachten Bildchen
lassen sich in den Hetzschen Skizzen, die in
der Neuen Pinakothek hinterlegt sind, un-
gleich leichter ersehen.
°) (auf S. 17) Julius Schnorr
v. Carolsfeld, geboren 26. März 1794
in Leipzig, gestorben am 24. Mai 1872 zu
Dresden, ein höchst edler, ernster Charak-
ter, besuchte mehrere Jahre die Wiener
Kunstakademie, ging 1817 nach Rom, wo
er sich dem KreiseOverbeck-Cornelius enge
anschloh und mit diesen seinen Freunden
die Fresken der Villa Masstmi durch seine
Darstellungen aus Ariosts Dichtung „Der
rasende Roland" zur Aussührung brachte. Ludwig I.
berief den tüchtigen Künstler im Jahre 1825 als Professor
nach München, wo er in langjähriger Arbeit den um-
fassenden Bilderschmuck der Residenzgemächer herstellte.
Zu seinen autzerdem geschaffenen Werken zählt in erster
Reihe die bei Cotta erschienene „Bilderbibel", die in 240
Holzschnittblättern innerhalb der Jahre 1843—46 zur all-
gemeinen Kenntnis des Volkes gelangte und verdientes
warmes Jnteresse bei hoch und nieder fand. Ein schweres
Augenleiden hieh den Meister seine grötzere Tätigkeit ein-
stellen, worauf er nach Dresden übersiedelte, um in from-
mer christlicher Gesinnung dort seine Tage abzuschlietzen.
'") (auf S. 18) Als Sohn eines Kupferstechers zu
Düsseldorf am 19. April 1798 geboren, siedelte die Familie
1806 nach München über, wo der junge Hetz, als Schüler
der Münchener Akademie dem Klassizismus des damaligen
Direktors P. v. Langer gründlich abgeneigt, alsbald auf
vier Jahre nach Rom ging, um im engen Anschlutz an
gleichgesinnte Freunde als Romantiker der religiösen
Kunst zu huldigen. Später Professor in München, ver-
mochte er mit seinen Schülern auf dem erkorenen Ge-
biete die schönsten Erfolge zu erreichen. Eine Perle unter
seinen Oelgemälden ist die „Naäonna in trono", die
König Ludwig u. a. für die Neue Pinakothek erwarb;
zu seinen edelsten Fresken zählt ein „Letztes Abendmahl"
im Refektorium des Stiftes St. Bonifaz zu München.
Der hochverdiente Meister schloh seine Lebenstage am
29. März 1863.
") (auf S. 22) Kronprinz Ludwig hatte wohl schon
sein Augenmerk auf die Steinbrüche des Untersbergs ge-
lenkt, als er in den Jahren 1811—1815 als Statthalter
in Salzburg residierte. Seinem romantischen Sinn mag
der Aufenthalt in der herrlichen Salzachstadt besonders