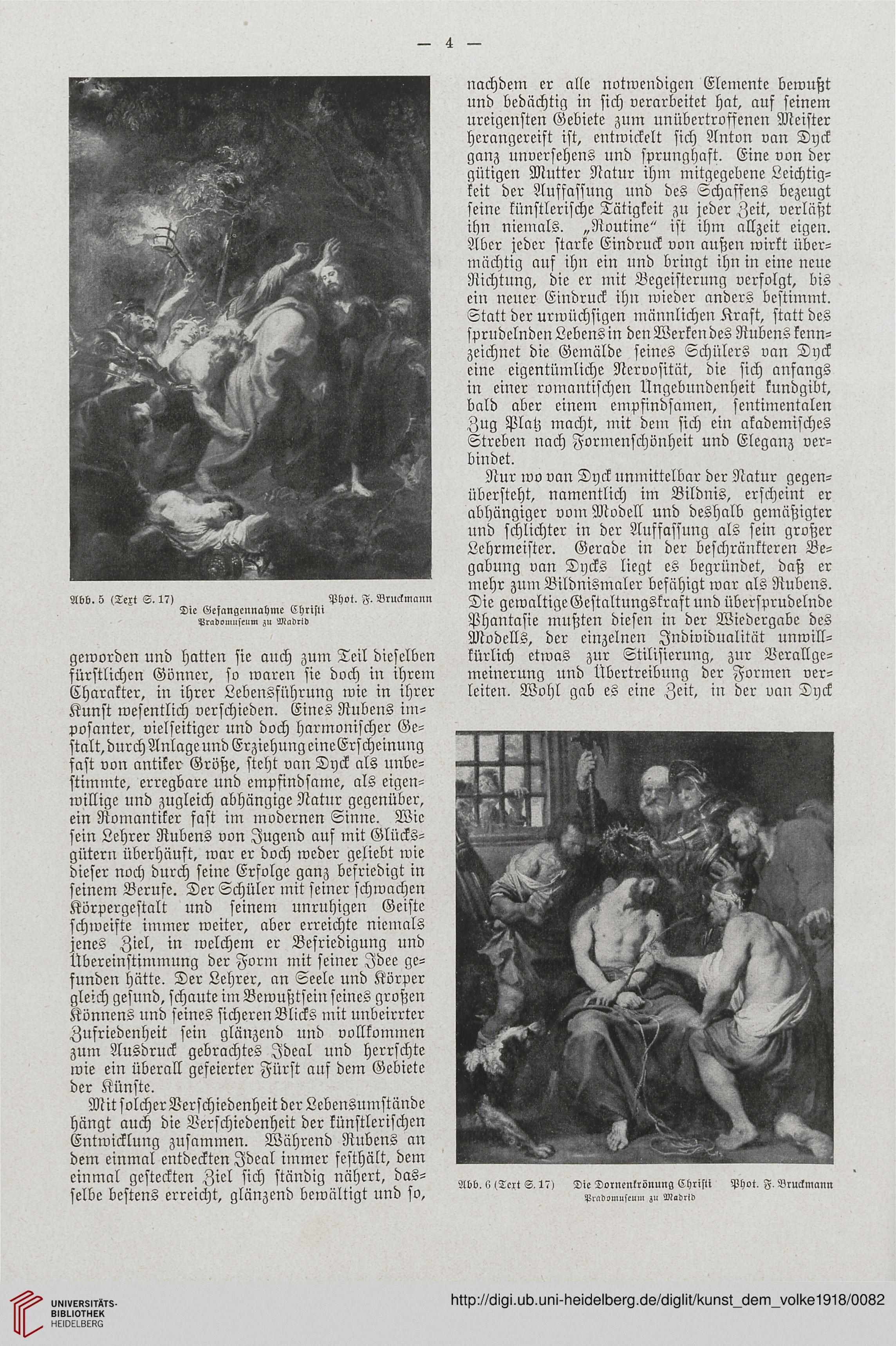4
Abb. S (Text S. 17> Phot. F. Bruckmann
Die Gesangcnnahmc Christi
geworden und hatten sie auch zum Teil dieselben
fürstlichen Gönner, so waren sie doch in ihrem
Charakter, in ihrer Lebensführung wie in ihrer
Kunst wesentlich verschieden. Eines Rubens im-
posanter, vielseitiger und doch harmonischer Ge-
stalt, durch Anlage und Erziehung eineErscheinung
fast von antiker Größe, steht van Dyck als unbe-
stimmte, erregbare und empfindsame, als eigen-
willige und zugleich abhängige Natur gegenüber,
ein Romantiker fast im modernen Sinne. Wic
sein Lehrer Rubens von Jugend auf mit Glücks-
gütern überhäuft, war er doch weder geliebt wie
dieser noch durch seine Erfolge ganz befriedigt in
seinem Berufe. Der Schüler mit seiner schwachen
Körpergestalt und seinem unruhigen Geiste
schweifte immer weiter, aber erreichte niemals
jenes Ziel, in welchem er Besriedigung und
Ubereinstimmung der Form mit seiner Jdee ge-
funden hätte. Der Lehrer, an Seele und Körper
gleich gesund, schaute im Bewußtsein seines großen
Könnens und feines sicheren Blicks mit unbeirrter
Zufriedenheit sein glänzend und vollkommen
zum Ausdruck gebrachtes Jdeal und herrschte
wie ein überall gefeierter Fürst auf dem Gebiete
der Künste.
Mit solcherVerschiedenheitderLebensumstände
hängt auch die Verschiedenheit der künstlerischen
Entwicklung zusammen. Während Rubens an
dem einmal entdeckten Jdeal immer festhält, dem
einmal gesteckten Ziel sich ständig nähert, das-
selbe bestens erreicht, glänzend bewältigt und so.
nachdem er alle notwendigen Elemente bewußt
und bedächtig in sich verarbeitet hat, auf seinem
ureigensten Gebiete zum unübertroffenen Meister
herangereift ist, entwickelt sich Anton van Dyck
ganz unversehens und sprunghaft. Eine von der
gütigen Mutter Natur ihm mitgegebene Leichtig-
keit der Ausfassung und des Schaffens bezeugt
seine künstlerische Tätigkeit zu jeder Zeit, verläßt
ihn niemals. „Noutine" ist ihm allzeit eigen.
Aber jeder starke Eindruck von außen wirkt über-
mächtig auf ihn ein und bringt ihn in eine neue
Nichtung, die er mit Begeisterung verfolgt, bis
ein neuer Eindruck ihn wieder anders bestimmt.
Statt der urwüchsigen männlichen Kraft, statt des
sprudelndenLebensin denWerkendes Rubens kenn-
zeichnet die Gemälde seines Schülers van Dyck
eine eigentümliche Nervosität, die sich anfangs
in einer romantischen Ungebundenheit kundgibt,
bald aber einem empfindsamen, sentimentalen
Zug Platz macht, mit dem sich ein akademisches
Streben nach Formenschönheit und Eleganz ver-
bindet.
Nur wo van Dyck unmittelbar der Natur gegen-
übersteht, namentlich im Bildnis, erscheint er
abhängiger vom Modell und deshalb gemäßigter
und schlichter in der Auffassung als sein großer
Lehrmeister. Gerade in der beschränkteren Be-
gabung van Dycks liegt es begründet, daß er
mehr zum Bildnismaler befähigt war als Rubens.
Die gewaltigeGestaltungskraft und übersprudelnde
Phantasie mußten diesen in der Wiedergabe des
Modells, der einzelnen Jndividualität unwill-
kürlich etwas zur Stilisierung, zur Verallge-
meinerung und Ilbertreibung der Formen ver-
leiten. Wohl gab es eine Zeit, in der van Dyck
Abb. k (Tcrt S. 17) Die Dorncnkrönung Christi Phot. F. Bruckmann
Abb. S (Text S. 17> Phot. F. Bruckmann
Die Gesangcnnahmc Christi
geworden und hatten sie auch zum Teil dieselben
fürstlichen Gönner, so waren sie doch in ihrem
Charakter, in ihrer Lebensführung wie in ihrer
Kunst wesentlich verschieden. Eines Rubens im-
posanter, vielseitiger und doch harmonischer Ge-
stalt, durch Anlage und Erziehung eineErscheinung
fast von antiker Größe, steht van Dyck als unbe-
stimmte, erregbare und empfindsame, als eigen-
willige und zugleich abhängige Natur gegenüber,
ein Romantiker fast im modernen Sinne. Wic
sein Lehrer Rubens von Jugend auf mit Glücks-
gütern überhäuft, war er doch weder geliebt wie
dieser noch durch seine Erfolge ganz befriedigt in
seinem Berufe. Der Schüler mit seiner schwachen
Körpergestalt und seinem unruhigen Geiste
schweifte immer weiter, aber erreichte niemals
jenes Ziel, in welchem er Besriedigung und
Ubereinstimmung der Form mit seiner Jdee ge-
funden hätte. Der Lehrer, an Seele und Körper
gleich gesund, schaute im Bewußtsein seines großen
Könnens und feines sicheren Blicks mit unbeirrter
Zufriedenheit sein glänzend und vollkommen
zum Ausdruck gebrachtes Jdeal und herrschte
wie ein überall gefeierter Fürst auf dem Gebiete
der Künste.
Mit solcherVerschiedenheitderLebensumstände
hängt auch die Verschiedenheit der künstlerischen
Entwicklung zusammen. Während Rubens an
dem einmal entdeckten Jdeal immer festhält, dem
einmal gesteckten Ziel sich ständig nähert, das-
selbe bestens erreicht, glänzend bewältigt und so.
nachdem er alle notwendigen Elemente bewußt
und bedächtig in sich verarbeitet hat, auf seinem
ureigensten Gebiete zum unübertroffenen Meister
herangereift ist, entwickelt sich Anton van Dyck
ganz unversehens und sprunghaft. Eine von der
gütigen Mutter Natur ihm mitgegebene Leichtig-
keit der Ausfassung und des Schaffens bezeugt
seine künstlerische Tätigkeit zu jeder Zeit, verläßt
ihn niemals. „Noutine" ist ihm allzeit eigen.
Aber jeder starke Eindruck von außen wirkt über-
mächtig auf ihn ein und bringt ihn in eine neue
Nichtung, die er mit Begeisterung verfolgt, bis
ein neuer Eindruck ihn wieder anders bestimmt.
Statt der urwüchsigen männlichen Kraft, statt des
sprudelndenLebensin denWerkendes Rubens kenn-
zeichnet die Gemälde seines Schülers van Dyck
eine eigentümliche Nervosität, die sich anfangs
in einer romantischen Ungebundenheit kundgibt,
bald aber einem empfindsamen, sentimentalen
Zug Platz macht, mit dem sich ein akademisches
Streben nach Formenschönheit und Eleganz ver-
bindet.
Nur wo van Dyck unmittelbar der Natur gegen-
übersteht, namentlich im Bildnis, erscheint er
abhängiger vom Modell und deshalb gemäßigter
und schlichter in der Auffassung als sein großer
Lehrmeister. Gerade in der beschränkteren Be-
gabung van Dycks liegt es begründet, daß er
mehr zum Bildnismaler befähigt war als Rubens.
Die gewaltigeGestaltungskraft und übersprudelnde
Phantasie mußten diesen in der Wiedergabe des
Modells, der einzelnen Jndividualität unwill-
kürlich etwas zur Stilisierung, zur Verallge-
meinerung und Ilbertreibung der Formen ver-
leiten. Wohl gab es eine Zeit, in der van Dyck
Abb. k (Tcrt S. 17) Die Dorncnkrönung Christi Phot. F. Bruckmann