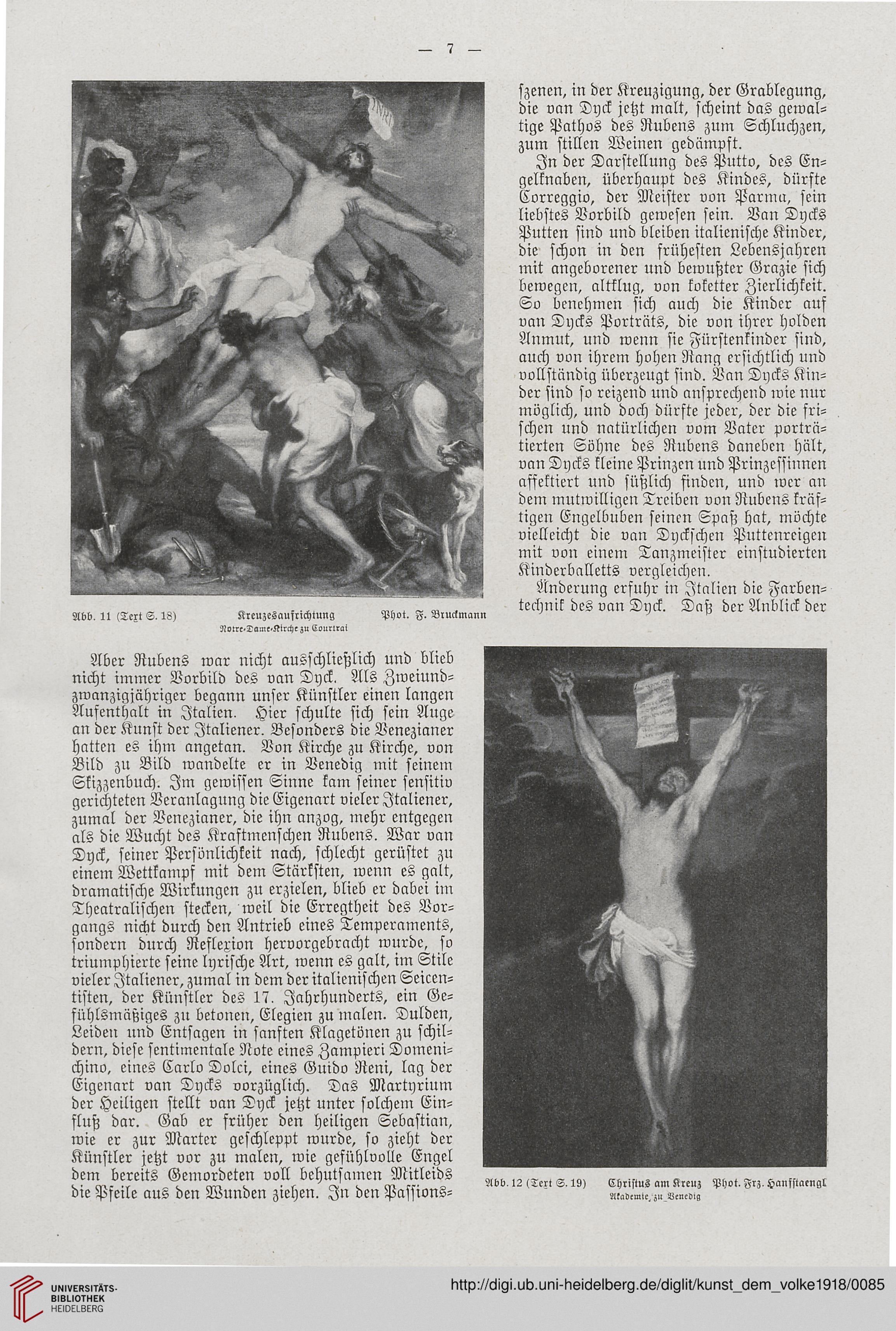7
Abb. 1l (Text S. 18) Kreuzesaufrichtung Phot. F. Bruclmann
szenen, in der Kreuzigung, der Grablegung,
die van Dyck jetzt malt, scheint das gewal-
tige Pathos des Rubens zum Schluchzen,
zum stillen Weinen gedämpft.
Jn der Darstellung des Putto, des En-
gelknaben, überhaupt des Kindes, dürfte
Correggio, der Meister von Parma, sein
liebstes Vorbild gewesen sein. Van Dycks
Putten sind und bleiben italienische Kinder,
die schon in den frühesten Lebensjahren
mit angeborener und bewußter Grazie sich
bewegen, altklug, von koketter Zierlichkeit.
So benehmen sich auch die Kinder auf
van Dycks Porträts, die von ihrer holden
Anmut, und wenn sie Fürstenkinder sind,
auch vvn ihrem hohen Rang ersichtlich und
vollständig überzeugt sind. Van Dycks Kin-
der sind so reizend und ansprechend wie nur
möglich, und doch dürfte jeder, der die fri-
schen und natürlichen vom Vater porträ-
tierten Söhne des Rubens daneben hält,
van Dycks kleine Prinzen und Prinzessinnen
affektiert und sühlich sinden, und wcr an
dem mutwilligen Treiben von Rubens kräf-
tigen Engelbuben seinen Spaß hat, möchte
vielleicht die van Dyckschen Puttenreigen
mit von einem Tanzmeister einstudierten
Kinderballetts vergleichen.
Änderung erfuhr in Jtalien die Farben-
technik des van Dyck. Daß der Anblick der
Aber Rubens war nicht ausschließlich und blieb
nicht immer Vorbild des van Dyck. Als Zweiund-
zwanzigjähriger begann unser Künstler einen langen
Ausenthalt in Jtalien. Hier schulte sich sein Auge
an der Kunst der Jtaliener. Besonders die Venezianer
hatten es ihm angetan. Von Kirche zu Kirche, von
Bild zu Bild wandelte er in Venedig mit seinem
Skizzenbuch. Jm gewissen Sinne kam seiner sensitiv
gerichteten Veranlagung die Eigenart vielerJtaliener,
zumal der Venezianer, die ihn anzog, mehr entgegen
als die Wucht des Kraftmenschen Rubens. War van
Dyck, seiner Persönlichkeit nach, schlecht gerüstet zu
einem Wettkampf mit dem Stärksten, wenn es galt,
dramatische Wirkungen zu erzielen, blieb er dabei im
Theatralischen stecken, weil die Erregtheit des Vor-
gangs nicht durch den Antrieb eines Temperaments,
sondern durch Reflexion hervorgebracht wurde, so
triumphierte seine lyrische Art, wenn es galt, im Stile
vieler Jtaliener, zumal in dem der italienischen Seicen-
tisten, der Künstler des 17. Jahrhunderts, ein Ge-
fühlsmäßiges zu betonen, Elegien zu malen. Dulden,
Leiden und Entsagen in sanften Klagetönen zu schil-
dern, diese sentimentale Note eines Zampieri Domeni-
chino, eines Carlo Dolci, eines Guido Reni, lag der
Eigenart van Dycks vorzüglich. Das Martyrium
der Heiligen stellt van Dyck jetzt unter solchem Ein-
sluß dar. Gab er früher den heiligen Sebastian,
wie er zur Marter geschleppt wurde, so zieht der
Künstler jetzt vor zu malen, wie gefühlvolle Engel
dem bereits Gemordeten voll behutsnmen Mitleids
die Pfeile aus den Wunden ziehen. Jn den Passions-
Abb. 12 (Tcrt S. 19) Christus am Kreuz Phot. Frz. Hansstacngl
Abb. 1l (Text S. 18) Kreuzesaufrichtung Phot. F. Bruclmann
szenen, in der Kreuzigung, der Grablegung,
die van Dyck jetzt malt, scheint das gewal-
tige Pathos des Rubens zum Schluchzen,
zum stillen Weinen gedämpft.
Jn der Darstellung des Putto, des En-
gelknaben, überhaupt des Kindes, dürfte
Correggio, der Meister von Parma, sein
liebstes Vorbild gewesen sein. Van Dycks
Putten sind und bleiben italienische Kinder,
die schon in den frühesten Lebensjahren
mit angeborener und bewußter Grazie sich
bewegen, altklug, von koketter Zierlichkeit.
So benehmen sich auch die Kinder auf
van Dycks Porträts, die von ihrer holden
Anmut, und wenn sie Fürstenkinder sind,
auch vvn ihrem hohen Rang ersichtlich und
vollständig überzeugt sind. Van Dycks Kin-
der sind so reizend und ansprechend wie nur
möglich, und doch dürfte jeder, der die fri-
schen und natürlichen vom Vater porträ-
tierten Söhne des Rubens daneben hält,
van Dycks kleine Prinzen und Prinzessinnen
affektiert und sühlich sinden, und wcr an
dem mutwilligen Treiben von Rubens kräf-
tigen Engelbuben seinen Spaß hat, möchte
vielleicht die van Dyckschen Puttenreigen
mit von einem Tanzmeister einstudierten
Kinderballetts vergleichen.
Änderung erfuhr in Jtalien die Farben-
technik des van Dyck. Daß der Anblick der
Aber Rubens war nicht ausschließlich und blieb
nicht immer Vorbild des van Dyck. Als Zweiund-
zwanzigjähriger begann unser Künstler einen langen
Ausenthalt in Jtalien. Hier schulte sich sein Auge
an der Kunst der Jtaliener. Besonders die Venezianer
hatten es ihm angetan. Von Kirche zu Kirche, von
Bild zu Bild wandelte er in Venedig mit seinem
Skizzenbuch. Jm gewissen Sinne kam seiner sensitiv
gerichteten Veranlagung die Eigenart vielerJtaliener,
zumal der Venezianer, die ihn anzog, mehr entgegen
als die Wucht des Kraftmenschen Rubens. War van
Dyck, seiner Persönlichkeit nach, schlecht gerüstet zu
einem Wettkampf mit dem Stärksten, wenn es galt,
dramatische Wirkungen zu erzielen, blieb er dabei im
Theatralischen stecken, weil die Erregtheit des Vor-
gangs nicht durch den Antrieb eines Temperaments,
sondern durch Reflexion hervorgebracht wurde, so
triumphierte seine lyrische Art, wenn es galt, im Stile
vieler Jtaliener, zumal in dem der italienischen Seicen-
tisten, der Künstler des 17. Jahrhunderts, ein Ge-
fühlsmäßiges zu betonen, Elegien zu malen. Dulden,
Leiden und Entsagen in sanften Klagetönen zu schil-
dern, diese sentimentale Note eines Zampieri Domeni-
chino, eines Carlo Dolci, eines Guido Reni, lag der
Eigenart van Dycks vorzüglich. Das Martyrium
der Heiligen stellt van Dyck jetzt unter solchem Ein-
sluß dar. Gab er früher den heiligen Sebastian,
wie er zur Marter geschleppt wurde, so zieht der
Künstler jetzt vor zu malen, wie gefühlvolle Engel
dem bereits Gemordeten voll behutsnmen Mitleids
die Pfeile aus den Wunden ziehen. Jn den Passions-
Abb. 12 (Tcrt S. 19) Christus am Kreuz Phot. Frz. Hansstacngl